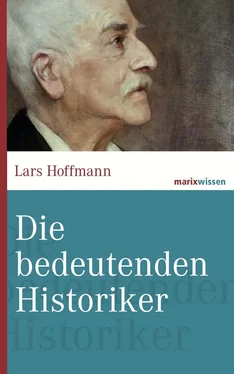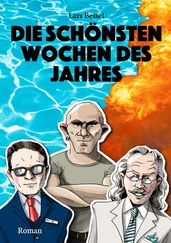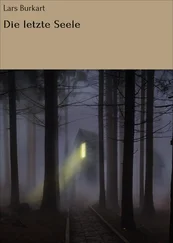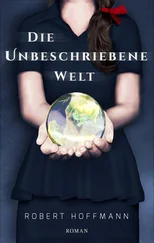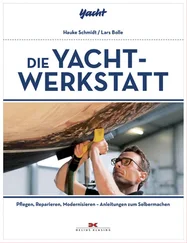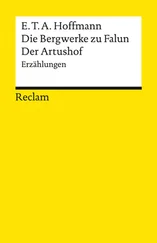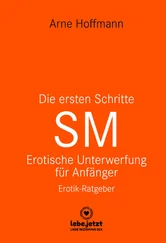Seine literarische Tätigkeit dürfte Xenophon erst nach dem Jahr 371 v. Chr. entfaltet haben. Von seinen 15 bekannten Werken kann neben der Anabasis vor allem ein weiteres für die Geschichtsschreibung in Anspruch genommen werden. Dabei handelt es sich um seine Hellenika , eine aus sieben Büchern bestehende Geschichte Griechenlands, die sich mit den Jahren 411 bis 362 v. Chr. beschäftigt. Sie setzt damit den Peloponnesischen Krieg des Thukydides fort und stellt sich so als ein Teil der sog. Historia perpetua dar, einer durchgängig bis zur osmanischen Eroberung Konstantinopels im Jahr 1453 aufgezeichneten Geschichte der griechischen Welt. Sicherlich gehört dieses Werk nicht zu den bedeutendsten Schriften Xenophons, der seine große Popularität in der Nachwelt mehr seinen sokratischen Schriften , der Kyropädie sowie der Anabasis verdankte. Offenbar wurde es in mehreren Etappen verfasst, und eine Endredaktion, die dem ganzen Text ein einheitliches Gepräge hätte verleihen können, blieb aus. Die beiden ersten Bücher führen in Stil und Aufbau durchaus dem Thukydides vergleichbar die Ereignisse des Peloponnesischen Krieges bis zu seinem Ende aus, worauf der Bericht über die tyrannische Herrschaft der 30 Oligarchen in Athen (404-403 v. Chr.) und die daran anschließende Restitution der attischen Demokratie folgt. Die Bücher III bis VII setzen zunächst mit Xenophons Anabasis ein, um von dort ausgehend eher kursorisch die allgemeine politische Entwicklung vom Jahr 403 bis zum Jahr 362 v. Chr. und der zweiten Schlacht von Mantineia darzulegen. Seinerzeit standen sich die Böoter unter Epaminondas auf der einen sowie Sparta und Athen auf der anderen Seite gegenüber. Diese Auseinandersetzung, bei der Epaminondas sein Leben ließ, endete mit einem militärischen Patt und führte zum Abschluss eines allgemeinen Friedens, der sämtlichen Stadtstaaten in Griechenland den gleichen Rang einräumte. Keine Polis war also dazu in der Lage, eine Vormachtstellung zu erreichen oder die politischen Verhältnisse grundlegend neu zu ordnen, ein Zustand, der später dem Vordringen der Makedonen unter König Philipp II. und dem Scheitern der Demokratie einen wesentlichen Vorschub leistete.
Was die Darstellung in den Hellenika angeht, ist es keinesfalls Absicht Xenophons gewesen, alle Ereignisse aufzuzeichnen, die ihm zugänglich waren. Dafür war seine Abneigung gegen Athen zu groß, das seiner Meinung nach seinen geschätzten Lehrer Sokrates mit einer erfundenen Klage umgebracht hatte, und dessen Demokratie er nur mit großem Misstrauen begegnete. Andererseits bringt er seine Sympathie für Sparta und dessen König Agesialos II., mit dem er sich freundschaftlich verbunden sah, offen zum Ausdruck. Weiterhin übergeht er einzelne Jahre, wenn dies dem Zweck seiner Darstellung entsprach. So hebt er die Freundschaft zwischen Athen und Sparta nach dem Jahr 371 v. Chr. sehr positiv hervor, während er eine ganze Reihe anderer Ereignisse, die ihn selbst nicht so sehr betrafen, einfach ausfallen lässt. Was für ihn in ganz besonderem Maße zählte, waren die Leistungen des militärischen Befehlshabers, d. h. Charakterstärke und persönliche Erfolge des Einzelnen standen für ihn über diplomatischen Erfolgen oder Vereinbarungen, die zwischen Stadtstaaten oder bestimmten Territorien getroffen wurden.
Andere Werke Xenophons bieten ebenfalls historische Informationen, wie etwa sein Agesilaos . Allerdings steht in diesem Text in sophistischer Manier das Lob seines königlichen Freundes und Gönners im Vordergrund, während sich die historische Darstellung im Wesentlichen auf die zu Beginn geschilderte Biographie seines Helden beschränkt. Ähnliches gilt für seine Verfassung der Spartaner : Als Historiker gewinnt man aus dieser Quelle zwar wichtige Informationen über das lakedämonische (= spartanische) Staatswesen, auch wenn er dessen Entstehung auf einen legendären Gesetzgeber zurückführt, den es niemals gegeben hat. Doch Xenophons Anliegen ist es in erster Linie, auf diese Weise die besondere Stellung und die großen militärischen, auf persönlichem Einsatz beruhenden Leistungen Spartas zu begründen.
Werke:
Xenophon, Anabasis. Der Zug der Zehntausend. Griechisch-Deutsch. Hrg. u. übersetzt v. W. MÜRI u. B. ZIMMERMANN. München 1990.
Xenophon, Hellenika. Griechisch-deutsch. Hrg. von G. STRASBURGER. München 1970.
Weiterführende Literatur:
Chr. MUELLER-GOLDINGEN, Xenophon. Philosophie und Geschichte. Darmstadt 2007.
O. STOLL,1 bis 29
Gemeinschaft in der Fremde. Xenophons Anabasis als Quelle zum Söldnertum im Klassischen Griechenland?, in: Göttinger Forum f. Altertumswissenschaft 5 (2002) 123–183.
B. SCHIFFMANN, Untersuchungen zu Xenophon. Tugend, Eigenschaft, Verhalten, Folgen. Göttingen 1993.
R. NICKEL, Xenophon. Darmstadt 1979.
Polybios wurde um das Jahr 200 v. Chr. in der arkadischen Stadt Megalopolis auf der Peloponnes geboren. Sein Vater Lykortas, zeitweilig einer der Generäle des Achaiischen Bundes , einer aus zehn bzw. zwölf Städten der Landschaft Achaia zur gegenseitigen Unterstützung gebildeten Zweckgemeinschaft, die sich in einer früheren Phase gegen die Vormachtbestrebungen Philipps II. von Makedonien gebildet hatte, gehörte im Vorfeld des Dritten Makedonischen Krieges (173-168 v. Chr.) der romfeindlichen Partei an. In diesem Krieg setzten sich die verbündeten Griechen gemeinsam mit den Makedonen gegen die römische Invasion ihrer Heimat zur Wehr, doch scheiterte das alliierte Heer, das unter dem Oberbefehl des Makedonen Perseus stand, endgültig bei der Schlacht von Pydna im Jahr 168 v. Chr. Polybios selbst wirkte bei diesen Kämpfen als Hipparchos (Reiterkommandant) mit, er hatte somit eines der höchsten militärischen Ämter innerhalb des Achaiischen Bundes inne. Da diese Funktion ein Mindestalter von 30 Jahren voraussetzt, ergibt sich daraus ein wichtiger Anhaltspunkt für sein Lebensalter. Nach der griechischen Niederlage wurden – nach römischer Auffassung als friedenserhaltende Maßnahme – 1000 griechische Geiseln nach Rom verbracht, zu denen auch Polybios gehörte. Dort lebte er im Haus des Generals Lucius Aemilius Paullus, der nach dem römischen Sieg von Pydna den Ehrennamen Macedonicus erhielt. In Rom hochgeschätzt, stieg er zum Lehrer des Publius Cornelius Scipio auf, wodurch er insbesondere zum Berichterstatter über den Dritten Punischen Krieg (149-146 v. Chr.) wurde, der mit der Zerstörung Karthagos endete. Um 150 v. Chr. wurde er aus der Geiselhaft entlassen, musste dann aber im Jahr 146 v. Chr. die Zerstörung seiner Heimat Achaia sowie Korinths durch die Römer miterleben. Polybios selbst erwähnt längere Reisen, die er mit Scipio unternommen habe, wobei er auch den Weg Hannibals über die Alpen nachgegangen sein will. Nach Pseudo-Lukian soll er im Alter von 82 Jahren an den Folgen eines Sturzes vom Pferd gestorben sein, das hieße um das Jahr 120 v. Chr., doch kann man dieser Angabe nicht unbedingt Glauben schenken.
Seine Historiai beschreiben in 40 Büchern den Aufstieg Roms zur Weltmacht für die Jahre 220 bis 144 v. Chr. Dabei war das Werk ursprünglich bis zur Ausdehnung der römischen Dominanz über Griechenland nach der Schlacht von Pydna angelegt. Der erste Teil umfasst die Bücher I bis XXIX, während sich die Bücher XXX bis XL der westlichen Ausdehnung des Römischen Reiches und insbesondere der Zerschlagung des punischen Reiches widmen. Da sich innerhalb des Gesamtwerks auch zwei Vorreden finden, muss man davon ausgehen, dass sich Polybios zunächst auf den ersten Teil beschränken wollte, den er wohl auch noch selbst zur Veröffentlichung gebracht hat: Immerhin handelte es sich dabei um die Ereignisse, an denen er zumindest partiell, wenn auch aus der Sicht des Unterlegenen, aktiv beteiligt war. Der zweite Hauptteil des Werkes hingegen ist mit großer Sicherheit erst nach seinem Tod publiziert worden. Dabei ist auch Teil I in sich klar strukturiert. Im Sinne der sog. historia perpetua knüpft er in den ersten beiden Büchern für den Osten und Westen getrennt an seine Vorläufer Aratos aus Soloi auf Zypern sowie Timaios aus Tauromenion (heute Taormina; beide Werke sind nicht erhalten) an, um seinen Lesern einen ununterbrochenen Fortlauf der Geschichte zu bieten. Darauf folgen in den Büchern III bis V für die Jahre 216-220 v. Chr. die Kriege Hannibals, der innergriechische Bundesgenossenkrieg (220-217 v. Chr.) sowie der Vierte Syrische Krieg (219-217 v. Chr.) zwischen Ptolemäern und Seleukiden. Zunächst berichtet Polybios die Ereignisse noch getrennt nach Osten und Westen, ab Buch VII jedoch gibt er dies mit dem politischen und militärischen Zusammentreffen von Griechenland und Rom auf, ein Schema, das durchaus auch an Herodot erinnert. Somit reicht die Darstellung bis zum Ende des Dritten Makedonischen Krieges (168 v. Chr.) im XXIX. Buch. Daran schließt sich der zweite Hauptteil an. Eine Sonderstellung nimmt allerdings Buch VI sein, das nach der römischen Niederlage bei Cannae (216. v. Chr.) einsetzt, um die römische Verfassung in ihren Stärken und Schwächen zu beschreiben. Zweck dieses Einschubs ist es, Gründe dafür aufzuzeigen, warum sich Rom von dieser schweren Niederlage erholen und seinen Aufstieg zur Weltmacht fortsetzen konnte.
Читать дальше