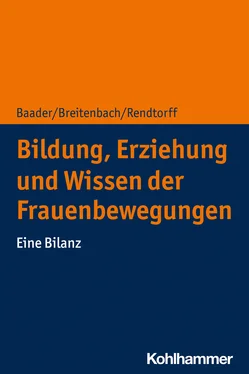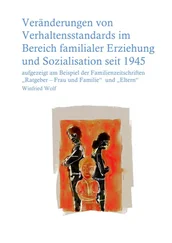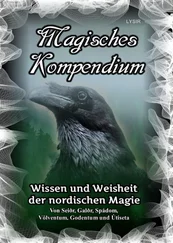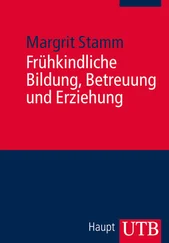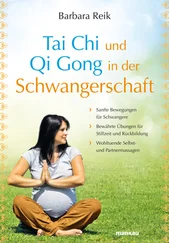1 ...7 8 9 11 12 13 ...17 Die Zulassung zum Abitur wiederum zwang die Universitäten sukzessive, sich für Studentinnen zu öffnen, was anderswo schon länger gang und gäbe war – Deutschland bildete hier im europäischen Vergleich und dem zur USA (in Bezug auf das Medizinstudium sogar international; Brinkschulte 2005: 105) ein Schlusslicht. Dabei spielte es eine Rolle, dass in Deutschland der Zugang zu den Professionen über ein akademisches Studium geregelt war, während etwa in der Schweiz, die ihre Tore früh öffnete, ein akademisches Studium in der Regel nicht entscheidend für den Zutritt zu den Professionen war (vgl. Costas 1992). Damit wird deutlich, um welche Privilegien bei der Zulassung zu den Universitäten gekämpft wurde, ging es dabei doch stark um Zugang zu prestigeträchtigen und einflussreichen akademischen Berufen. In Frankreich erfolgte der Zugang zu den Eliteuniversitäten erst Mitte des 20. Jahrhunderts, und separierte Eliteeinrichtungen für Frauen wurden erst 1940 den männlichen gleichgestellt (ebd.: 125). Der Weg, eigene Hochschulen für Frauen zu gründen, wie er etwa auch in England erfolgte, wurde in Deutschland nicht beschritten. Helene Lange besuchte 1889 das Frauencollege in Cambridge, und vermutlich erschien ihr dieses Modell aufgrund der hohen Normierung des Bildungssystems im Deutschen Reich nicht übertragbar (Jacobi 2010: 105).
Insgesamt ist die Öffnung der Universitäten für Frauen durch viele Ungleichzeitigkeiten und Widersprüche gekennzeichnet, insbesondere auch im internationalen Vergleich. Dabei sind die unterschiedlichen Abschlüsse und ihre Bedeutung sowie die verschiedenen Qualifikationen im Universitätswesen, wie Promotionen und Habilitationen zu berücksichtigen. Eine bedeutsame Rolle spielten auch die Unterschiede in der Organisation der Universitäten, korrigiert werden müssen aber auch Vorstellungen von typischen Frauenfächern (vgl. Maurer 2010: 18), gehörten doch zu den Pionierinnen des Frauenstudiums sehr viele Naturwissenschaftlerinnen. Dies hatte um 1900 auch mit der Expansion der Naturwissenschaften und entsprechend geringeren Konkurrenzängsten zu tun, so dass den Frauen weniger Widerstände entgegengesetzt wurden. So war es beispielsweise an der Universität Heidelberg die naturwissenschaftliche Fakultät, die eine Vorreiterrolle für die Zulassung von Frauen übernahm. Sie setzte sich ab 1891 für die Zulassung von Gasthörerinnen und 1895 – gegen das Votum des Senats der Universität – für das Promotionsrecht für Frauen ein. Grundsätzlich fügten sich die Gremien der Universität nur widerwillig den politischen Erlassen der Badischen Landesregierung aus dem Jahre 1900, Frauen zum »Heiligtum der Universität« (Hedwig Dohm) zuzulassen (vgl. Baader 1995).
Zu den Gemeinsamkeiten der Auseinandersetzungen um das Frauenstudium im internationalen Vergleich gehören insbesondere zwei Aspekte. Übereinstimmend ist zum einen die enge Verbindung von Aktivistinnen, die für die Zulassung stritten, mit der Frauenbewegung (vgl. Maurer 2010: 20). Zum anderen wurden in allen Ländern bei der Diskussion um das Frauenstudium die Auswirkungen auf die männlichen Geschlechtsgenossen diskutiert (ebd.: 19). Dies macht deutlich, dass die Universitäten nicht nur Räume der Bildung und Wissenschaft, sondern auch der männlichen Sozialisation waren (ebd.: 10). So stellte etwa der Alkoholkonsum wie auch andere Rituale der männlichen Studentenverbindungen für die erste Generation von Studentinnen ein Thema dar. Diese trafen an der Universität entweder auf Galanterie und Kavaliershaltung seitens der männlichen Studenten (vgl. Baader 1992: 227) – oder auch auf ein feindseliges Klima: Nicht nur von Seiten der Lehrenden, denn auch die männlichen Kommilitonen würden den Studentinnen gerne »›unabsichtlich‹ aufs Kleid treten, ihnen beim Besetzen der Plätze Knüffe beibringen, ihnen Kleckse in die Hefte machen, sie an den Kleiderhaken und beim Aufsuchen der Sitze wegdrängen«, schreibt ein Anonymus 1911 in der Münsteraner Universitätszeitung (Brinkschulte 2005: 111).
Ein Thema der frühen Studentinnen war aber auch das Verhältnis zur älteren Generation der frauenbewegten Kämpferinnen für das Frauenstudium. So wollte beispielsweise der Verein »Frauenstudium-Frauenbildung«, der sich für die Zulassung von Frauen eingesetzt hatte und dem in Heidelberg unter anderen die Protagonistin der bürgerlichen Frauenbewegung Marianne Weber (1870–1954) angehörte, die erste Generation von Studentinnen zu ihrer Jugendgruppe machen. Diese aber rebellierte gegen die Generation ihrer kollektiven Mütter. »Wir waren jung und wollten unabhängig sein, wir wollten keine alten Tanten und wollten nicht gegängelt werden«, so die erste Medizinstudentin in Heidelberg, Rahel Straus (1880–1963) (Straus 1961: 94). Sie hatte am ersten Mädchengymnasium in Deutschland, das auf Betreiben des Vereins »Frauenstudium-Frauenbildung« 1893 in Karlsruhe gegründet wurde, 1899 Abitur gemacht und in der ersten Abiturrede einer Frau in Deutschland über die Bildungschancen von jungen Mädchen und das akademische Studium gesprochen. Um ihre Freiheit und Unabhängigkeit zu wahren, gründeten die ersten Studentinnen eine eigene Studentinnengruppe, die »Vereinigung studierender Frauen«, den Verein von Marianne Weber und anderen nannten sie spöttisch »Frauentugend-Frauenmilde« (vgl. Baader 1992: 221ff.).
Mit dem skizzierten Generationenkonflikt ist zugleich eine Konstellation angesprochen, die sowohl die alte als auch die neue Frauenbewegung immer wieder beschäftigte: die Jüngeren wollten mit den Älteren, die Rechte erkämpft hatten, nichts mehr zu tun haben, sie wollten unabhängig sein und den Älteren nichts verdanken, auch wenn sie sich unter Umständen selbst als Frauenrechtlerinnen verstanden, wie es bei Rahel Straus dezidiert der Fall war. Aber diese Konflikte weisen auch noch eine andere Dimension auf, die mit dem Verhältnis zwischen Kultur- und Naturwissenschaften zu tun haben. Denn der von Marianne Weber und anderen geführte Verein »Frauenstudium-Frauenbildung« hatte ein distanziertes Verhältnis zu den Naturwissenschaften. Marianne Weber entfaltete in ihrem Text »Die Beteiligung der Frau an der Wissenschaft« aus dem Jahre 1904 ganz in der Logik von der spezifischen »Kulturaufgabe der Frau«, dass die Frauen in den Kulturwissenschaften aufgrund ihrer »Gabe, sich in die Gefühlswelt anderer zu versetzen« und »einer spezifischen Stoffauswahl nach besonderen weiblichen ›Gesichtspunkten‹ der Wissenschaft weibliche Werte hinzuzufügen würden« (Weber 1919: 5). Diese Möglichkeit sah Weber in der Naturwissenschaft mit ihrer Orientierung an »Objektivität« nicht (ebd.). Sie wertete in ihren Überlegungen zur »Kulturbedeutung geistiger Frauenarbeit«, bei der es nicht um die »Förderung des objektiven Kosmos unseres Wissens« gehe (ebd.: 7), zum einen die Naturwissenschaft und zum anderen ökonomische Aspekte ab, denn sie zielte vorrangig auf die »geistige Emanzipation« (Weber 1948: 446). Naturwissenschaftlerinnen wie die erste habilitierte Frau an der Universität Heidelberg, Gerta von Ubisch, die die Gymnasialkurse von Helene Lange besucht hatte, kritisierten die stark idealistisch ausgerichtete Bildungsauffassung Langes und der bürgerlichen Frauenbewegung (vgl. Baader 1995: 450).
Der Glaube an die Kulturaufgabe der Frau und ihre besondere Zuständigkeit für den sozialen Sektor durchzog auch die Bildungsbemühungen der Frauenbewegung bei dem Ziel, für Berufstätigkeiten von bürgerlichen Mädchen und Frauen im Bereich der Fürsorge und des Sozialen auszubilden. »Aus diesem Grund«, so Alice Salomon, ab 1900 im Vorstand des BDF, »fordert die Frauenbewegung die Vertiefung der Mädchenbildung nicht nur, um den Frauen volle Entfaltungsfreiheit zu sichern, sondern auch um der Eigenart der Frauen Raum zur Anteilnahme am Kulturleben, am öffentlichen und sozialen Leben zu schaffen. So unterstützt sie ihre Forderung nach wissenschaftlicher Bildung durch den Glauben an die soziale Mission der Frau« (Salomon 1904). Bei der Eröffnung der von Salomon gegründeten Sozialen Frauenschule in Berlin im Jahre 1908 erklärte sie, dass es ihr um eine »moderne Bildung« gehe, die kein Luxuswissen darstelle, sondern die eine Grundlage für Beruf und Erwerbstätigkeit in der sozialen Arbeit bilde und die Frauen befähige, »zu handeln, etwas zu leisten« und »der Menschheit in irgendeiner Form – in der Familie oder im größeren Kreis – zu dienen« (Salomon 1908).
Читать дальше