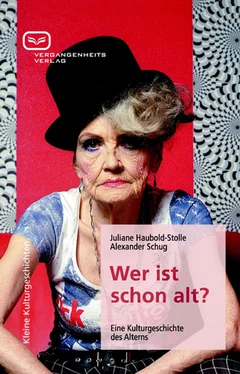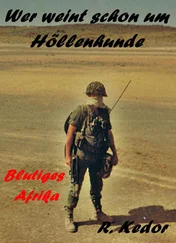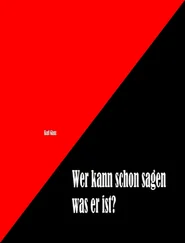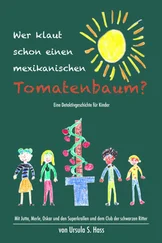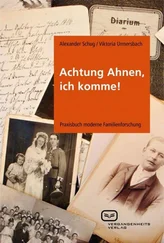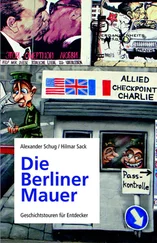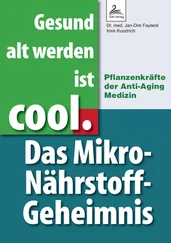In das europäische Mittelalter hinein wurden antike Traditionen weitergetragen – wie die der Lebenstreppe, die schon in Griechenland als Vorstellung entwickelt wurden. Eingeteilt in vier große Abschnitte oder in sieben mal sieben Jahresstufen erschien das Leben als Aufstieg bis zum mittleren Lebensalter, um dann wieder abzusteigen bis hin zum Tod.
Aber auch die auf die Ewigkeit gerichtete Altersignoranz der Christen blieb maßgeblich für die weitere Sicht auf das Alter in Europa. 28
Im Mittelalter bis in das 16. Jahrhundert hinein war zwar die durchschnittliche Lebenserwartung nicht sehr hoch (sie lag bei 40 Jahren), da viele Kinder in den ersten Lebensjahren starben. Aber diejenigen, die die Kindheit überlebt hatten, wurden durchaus auch 60 oder 70 Jahre, manche sogar 80 und 90, auch Hundertjährige kamen vor. 29Die Zahl der Alten in der Gesellschaft schwankte zwischen fünf und acht Prozent. 30
Im öffentlichen Leben des Mittelalters hatten Alte in manchen Bereichen eine besondere Stellung inne. In den Zünften gab es die „Ältesten“ als Autorität. In Städten wie Magdeburg oder Augsburg wurden ausgewählte Alte im 14. und 15. Jahrhundert als Rechtszeugen gefragt, sie galten als diejenigen, die aufgrund ihrer großen Erfahrung und ihrer langen Erinnerung in bestimmten Rechtsfragen entscheiden sollten. 31Auch in der Kirche verloren die alten Männer (und auch die alten Äbtissinnen) nicht ihre Würden. Meist kam man auch erst spät in höhere Ämter. Einmal erlangt, konnte – und musste – man den Dienst bis zum Tod versehen. 32Anders war es für Fürsten und Bauern. Hier war der Einfluss des germanischen Rechts größer. Und im germanischen Recht wurde der Verfall des Körpers mit dem Verfall des Geistes gleichgesetzt, der von den Jungen auf die Probe gestellt wurde. Der Sachsenspiegel und andere germanische Rechtstexte kannten die Altersprobe: Leistungsprüfungen vor den Augen der Gemeinschaft. Ein alter Mann musste beweisen, dass er noch allein ein Ross besteigen und ohne Stock und Hilfe laufen konnte, um seinen Besitz und seine Rechtsfähigkeit zu behalten. 33Wenn nicht, drohte ihm die Enteignung und Bevormundung. Die Angst vor einer politischen Entmachtung können wir auch den Lebensbeschreibungen des französischen Königs Ludwig XI. entnehmen. Er starb 1483 mit 61 Jahren und hatte sich zuvor intensiv bemüht, jung und fit zu bleiben, um nicht bevormundet zu werden. 34
Ab 60, manchmal auch ab 70 wurden Männer von bestimmten Aufgaben (Steuern, Wachdiensten, Kriegseinsätzen) befreit, aber die Frage nach der Lebenskraft machte eben auch vor den hohen Repräsentanten nicht halt. 35Wesentlich zugespitzter sah man das Altern bei Frauen. Frauen galten im Mittelalter spätestens mit dem Ende der Gebährfähigkeit als alt. Ihr Alter war noch verdammungswürdiger als das der Männer; alte Frauen waren Symbol für Unfruchtbarkeit und den Winter, aber auch für schlechte Eigenschaften wie Heuchelei, Neid, Verrat, Habgier. 36
Versuchten Frauen aber, ihre körperliche Attraktivität zu verlängern, wurde das von der Kirche scharf kritisiert. Das Alter der Frauen sollte nur der Vorbereitung auf den Tod dienen. 37
Für Männer wie Frauen galt, dass die Versorgung der Alten der Familie oder der Mildtätigkeit oblag. In Westeuropa sind schon aus dem 13. Jahrhundert Ruhestandsverträge belegt. Gleichzeitig setzte jedoch auch schon der Trend zu einem späten Heiratsalter ein – die Eheschließung wurde nur dann möglich, wenn mit ihr die Hausstandsgründung einherging, und das war meist erst beim Tod der Eltern der Fall. Diese Besonderheit Europas – das „european marriage patern“ – findet sich in Mittel- und Westeuropa, während in Osteuropa eher jüngere Heiratsalter belegt sind und andere Formen des Zusammenlebens daraus resultierten. Das Verhältnis zwischen den Generationen, das Abschließen von „Generationenverträgen“ wie grundsätzlich die Frage, ob und wie Alte versorgt werden sollten, war immer ein „heißes Eisen“.
Im Hochmittelalter verlor in Nord- und Mitteleuropa ein Bauer durch die Hofübergabe oftmals mit dem Besitzrecht seine eigene Freiheit und lebte unter der Vormundschaft des ihm nachfolgenden Hausherren, eine Tatsache, die viele alte Leute zu lebenslanger Arbeit nötigte. 38Selbst wenn ein Bauer aber nicht die Freiheit, sondern nur sein Prestige als Haushaltsvorstand verlor, war dies ein harter Einschnitt. Aus der zeitgenössischen Literatur und aus Sprichwörtern wissen wir, dass „die Bank der Kinder […] hart für die Alten“ war. 39Dennoch war der Generationenvertrag meist die einzige Vorsorge, die Menschen für das Alter treffen konnten. Von einer Art frühem Generationenvertrag erzählt eine Geschichte, die in den Gesta Romanorum übermittelt ist. Ein Schmied rechtfertigte seine Feiertagsarbeit damit, dass er täglich für sich zwei Pfennige und zwei für seine Frau verdienen müsse, zwei für seinen Vater (der ihm früher zwei gegeben habe) und zwei für seinen Sohn (der ihm später zwei Pfennige geben werde). Diese familieninterne Versorgung der Alten entsprach dem Ideal der mittelalterlichen Gesellschaft. 40Doch aus dieser Geschichte erkennen wir auch eine ganz grundlegende Aussage: Altersversorgung konnte nur geleistet werden, wenn die junge Generation innerhalb einer Familie genug erwirtschaften konnte, um auch die ältere Generation zu versorgen. Oder aber, wenn die ältere Generation selbst reich genug war, sich zur Ruhe zu setzen: Das galt für manche Adlige, aber auch für reiche Bürger in den Städten. 41Da dies jedoch nicht immer der Fall war, waren alle, die von ihrer eigenen Familie nicht versorgt werden konnten – oder die keine Familie (mehr) hatten – auf Almosen und Nächstenliebe angewiesen. Daher entwickelte sich auch im Mittelalter schon eine institutionalisierte und spezialisierte Altersversorgung. Private, größere wie kleinere wohltätige Stiftungen versorgten alte Menschen, meist richtete sich die Stiftung auf eine bestimmte Zielgruppe, z. B. auf Handwerker oder Witwen. Und aus der burgundischen Verwaltung des 15. Jahrhunderts sind erste Beamtenpensionen bekannt. 42
Ausgeformte Altersvorstellungen begegnen uns vor allem in den Lebenstreppen, die auch im Mittelalter weiter existieren – so die Idee von den sieben Zehnjahresstufen, mit dem Höhepunkt des Lebens zwischen dem 30. und 40. Lebensjahr und dem Ende des Lebens nach dem 70. Jahr. Andere Lebenstreppen verglichen in drei (Wachstum, Stillstand, Niedergang) oder vier Stufen (Frühling, Sommer, Herbst und Winter) das Leben mit der Ordnung in der Natur. 43Die Lebenstreppen waren weit verbreitet, doch dienten sie zur Orientierung bzw. zur Vergewisserung der Lebenseinheit und -ordnung, nicht als Abbild dessen, was die Menschen wirklich erlebten oder von einem bestimmten Alter erwarteten. 44Denn wenige Menschen erreichten im Mittelalter das 70. Lebensjahr und noch weniger das Alter, das in der Lebenstreppe mit „90. Jahr Kinderspott“ 45beschrieben wurde. Diese Lebenstreppen bleiben bis Ende des 19. Jahrhunderts aktuell, sie prägten die Sicht aufs Alter, besonders die auf das hohe, gebrechliche Alter. Oft wurden die Altersjahre mit Tierbildern illustriert, die letzten Jahre des Menschen waren dann die Affenjahre, die Jahre, in denen der Alte/die Alte kindisch oder eben affenähnlich sei. 46

Lebenstreppen spiegelten und prägten Altersvorstellungen – bis ins 20. Jahrhundert.
Auch gab es in Gesellschaften, die vom Rhythmus der Landwirtschaft bestimmt waren, keine festen Lebenszeiten: Kindheit, Jugend, Erwachsenenzeit und Alter gingen ineinander über und hingen an der Arbeitskraft und dem gesellschaftlichen Stand (z. B. ob verheiratet oder nicht) der Menschen, nicht an ihrem kalendarischen Alter. Die Lebenstreppen waren daher nicht so zu verstehen, dass für die mittelalterlichen Menschen mit 40 oder 50 Jahren das Alter begann. Sie waren vielmehr eine Ordnungsvorstellung und eine Erinnerung daran, dass es wichtig war, das Leben auf jeder Stufe zu genießen und zu nutzen. Ihre Verbreitung erkennen wir etwa daran, dass Shakespeare sie in „Wie es Euch gefällt“ aufnahm. Alter setzte dennoch unweigerlich dann ein, wenn man weniger leistungsfähig wurde. An den Beschreibungen der Lebenstreppen ist jedoch zu sehen, dass Altern im Mittelalter insofern problematisch war, weil alte Menschen Gefahr liefen, zum Kinderspott zu werden. Das Alter hatte im Mittelalter seine Stelle im Lauf des Lebens, eine herausgehobene Bedeutung hatte es jedoch nicht.
Читать дальше