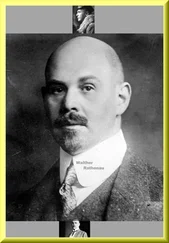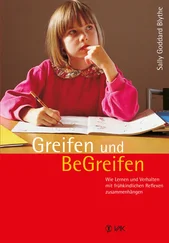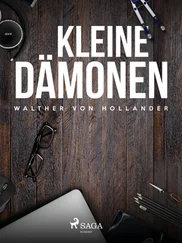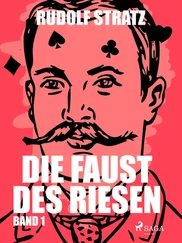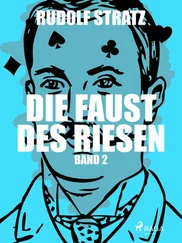Aber wir sind dankbar: Seit uns K. H. Bohrer während des Falklandkrieges der Baronin Thatcher daran erinnerte, woran es uns Schlappschwänzen gebricht (»höheres Ethos, letzte causa und brinkmanship«), haben wir derlei nicht mehr gelesen, nicht einmal in der FAZ, die uns anlässlich des Golfkriegs »härtere Zeiten« (16.2.91) androhte.
Aber das ist nur der harmlose Anfang des Volkstrauerspiels. B. Seebacher-B. rückt den Toten und den Lebenden direkt auf den Leib, vor allem aber dem Volk, das seine »innere Einheit, die zeitlos ist und anderes bedeutet als die Angleichung von Lebensverhältnissen«, einfach vergessen hat. Kaum aus der Volksgemeinschaft der Nazis und der Zwangskommune DDR entkommen, verleugnet doch dieses deutsche Volk (nebenbei: eine sehr zeitgebundene Erfindung von 1813), unter der »geistigen Herrschaft« des Antifaschismus (Globke, Oberländer, Filbinger, Kiesinger e tutti quanti?) die »innere Einheit«, die vor allem deshalb den Stempel »zeitlos« verdient, weil es sie gar nie gegeben hat. Mit der Verabschiedung vom Trugbild Nation und Volksgemeinschaft sind die BRD-Deutschen nicht etwa normal geworden nach ihrem Horror-Trip seit 1871, sondern haben sich ein »Ausnahmebewusstsein« zugelegt, »das uns noch heute wie Blei auf der Seele liegt und nicht nur die Selbstvergewisserung nach außen behindert, sondern auch nach innen«.
Spätestens mit dem Blei wird die Sache ernst, denn dabei denken wir eher an die Millionen Toten, denen das Blei vielleicht auch »auf der Seele liegt«, aber mit Sicherheit vorher den Körper zerfetzt hat. Die Normalität, die B.Seebacher-B. beschwört, ist ganz anders: »Stolz«, »Vaterland«, »Härte« und – mit »Blei« und der Logistik von Verteidigungsminister Rühe – »Selbstvergewisserung nach außen«. Von der wilhelminischen Parole vom »Platz an der Sonne«, mit der man Bürger und Proletarier nach 1900 verblendete und zu Hurra-Patrioten machte, steigen wir jetzt um ins Kanonenboot »Seebacher-Rühe« und brechen auf zur »Selbstvergewisserung nach außen«.
Der Antifaschismus, der nicht illegitim wurde, weil ihn die SED als Herrschaftsmittel und Staatsideologie instrumentalisierte, verleitete nach B. Seebacher-B. die westlichen Sonderweg-Deutschen zum Grübeln über die Vergangenheit und obendrein dazu, »sich am eigenen Unglück zu weiden«. Statt forsch loszumarschieren und »sich auf Sinn und Zweck des Ganzen zu verständigen«, um nach innen und außen »Selbstvergewisserung« zu betreiben, »klammert man sich« hausbacken an Antifaschismus. Die Antifaschisten verhindern also direkt, dass es mit der Finanzierung der Einheit vorangeht; sie sind verantwortlich dafür, dass »nicht gelingen kann, was nicht gelingen darf«, wie sie noch einmal – in direkter Anlehnung an Nolte – formuliert.
Über einen zwanzigzeiligen Abschnitt, in dem B. Seebacher-B. sechs Mal mit dem Begriff »Normalität« herumfuchtelt, kann ich gar nichts sagen, außer dass ich ziemlich froh bin, nicht zu den Normalen zu gehören, denen der syntaktisch vertrackte und total-normale Rat gegeben wird: »Wer sich nicht als Deutscher fühlt, wird nie lernen, ein Europäer zu sein und der Welt zugewandt«. Albaner, Finnen und Portugiesen sollen bereits wie verrückt Deutsch lernen, Le Monde, Times und der Corriere della Sera erscheinen ob dieser Drohung ab sofort in deutscher Sprache, damit deren Leser nicht ausgebürgert werden aus dem Seebacher-B.-Europa.
Alpinisten wissen: Wer einen steilen Einstieg wählt, stürzt eher ab. B. Seebacher-B. nahm die Vaterlandsroute und strauchelte schon beim fünften Schritt über die vermeintlich unbeantwortbare Frage, »für welches deutsche Vaterland ... die Armee preisgegeben« worden sei. Preisgegeben? Wer wen? Dass Teile der Armee sich keiner bis jetzt bekannt gewordener Verbrechen schuldig gemacht haben, ändert natürlich gar nichts an der wissenschaftlich erhärteten Tatsache, dass zwischen Hitlers Herrschaft und dem ganz überwiegenden Teil der Wehrmachtführung kein Haar Platz hatte. Der mainstream arrangierte sich nach unwesentlichen Reibungen zu Beginn bestens mit dem Gefreiten als neuem Chef. Der Widerstand war ehrenwert, aber doch bescheiden.
Weil der Widerstand so minimal war, versuchen Pfiffige immer wieder den Umweg über den »nationalen Verrat«. Wie allerdings die tonangebende »nationale Opposition« (wie NSDAP und Deutschnationale sich nannten), die im Juli 1932 fast 45 % der Stimmen erreichte, ausgerechnet »nationalen Verrat« begehen sollte (an sich selbst?), nachdem sie im Januar 1933 an die Macht gekommen war und unter dem Beifall einer nicht mehr messbaren, aber auf jeden Fall deutlichen Mehrheit Deutschland zügig deutscher machte, bleibt ein Geheimnis. Im Detail liegt B. Seebacher-B. fernab von Tatsachen und behauptet z. B., sozialdemokratische Opfer des Terrors fehlten in »jeder Aufzählung«. Das Gegenteil ist richtig: Jedes halbwegs anständige Buch über die Naziherrschaft enthält detaillierte Angaben – verleugnet oder vergessen werden da schon eher andere (Sinti, Roma, Russen, Polen, Kommunisten und Schwule).
Schon vor derlei Proseminar-Kapriolen stürzte die Rednerin ins Bodenlose, wie jeder, der noch glaubt, mit der Nation festen Boden zu betreten: »Aber zu gedenken ist – aller Opfer, die in diesem Jahrhundert in deutschem Namen gebracht wurden«. Wem hat zunächst die kaiserliche Armee, dann die Wehrmacht welche denkwürdigen »Opfer gebracht«? Die jetzt zu erwartende erneute historische Revision, dieses Mal unter dem Banner der »Ideen von 1989« kündigt sich einigermaßen flott an mit der Umwidmung deutscher Angriffskriege zum Opfergang. Genau diesen Verdacht hatten wir immer schon bei den Veranstaltungen unter der Firma »Volkstrauertag«. Es ging nie um die wirklichen Opfer, weder um die eigenen und schon gar nicht um die fremden, sondern um ein staatliches Trauertheater, in dem die Niederlagen in zwei selbst provozierten Kriegen »zustimmungs- und gemeinsinnsfähig« (Lübbe) inszeniert wurden. Und weil man an Niederlagen ungern einfach als Niederlagen erinnern mochte, wählte man namenlose Opfer als Staatsfeierstunden-Dekoration. Diese kann man – Schützen und Erschossene amalgamierend wie in der verlogenen, seit 1969 offiziellen Formel von den »Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft« – risikolos als die »in diesem Jahrhundert in deutschem Namen gebrachten Opfer« instrumentalisieren. Das erklärt auch die von B. Seebacher-B. pompös als Ouvertüre präsentierte Fanfare von der Einzigartigkeit der Veranstaltung (»Kein anderes Volk der Welt hat sich je vorgenommen, an einem einzigen, regelmäßig wiederkehrenden Tag seine Toten zu betrauern«). Welcher andere (Nachfolger-)Staat muss einen ganz und einen maßgeblich verschuldeten Weltkrieg als Opfergang kaschieren?
5 »Les Temps modernes« wurden 50 – »Es gibt nur noch beschädigte Ideen«
Verglichen mit den fünfzig Laufmetern, die die rot gebundenen Prachtbände der »Revue des deux mondes« im Magazin der Bibliothek beanspruchen, nehmen sich die zehn von »Les Temps modernes« bescheiden aus. Die berühmte »Revue« wurde 1829 im Geist des Positivismus gegen den »Systemgeist« (so die erste Nummer) gegründet und zählt seither die Eliten aus Wissenschaft, Kultur, Verwaltung und Politik zu ihren Autoren. Im Ehrenkomitee zu ihrem 150. Geburtstag saß 1979 auch Staatspräsident Valery Giscard d’Estaing.
Bei »Les Temps modernes« wäre derlei undenkbar. 1995 wurde die am 1. Oktober 1945 von Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Raymond Aron, Maurice Merleau-Ponty, Michel Leiris, Jean Paulhan und Albert Ollivier gegründete Zeitschrift fünfzig Jahre alt. Mit dem Selbstbewusstsein einer wirklich unabhängigen Institution, schrieb der jetzige »directeur« – der Filmemacher Claude Lanzmann – im Editorial zur Jubiläumsnummer solche kalendarischen Zwänge als Kleingeisterei beiseite: »Seit langem schon macht die Verspätung gegenüber dem, was man so Aktualität nennt, unsere spezifische Modernität aus.« Das ist kein Understatement, sondern hat Tradition: Die Nummer 500 war kein Thema, aber 50 Nummern später lud die Redaktion ihre Leser erstmals in ihrer Geschichte zu einem Fest – das war vor vier Jahren. Zur spezifischen Modernität von »Les Temps modernes« gehört ihre intellektuelle Radikalität – ob es nun um Philosophie, Sozialwissenschaft und Politik oder Literatur, Kunst, Musik und Film geht.
Читать дальше