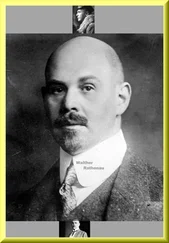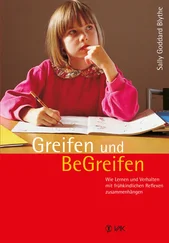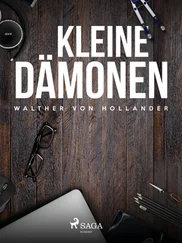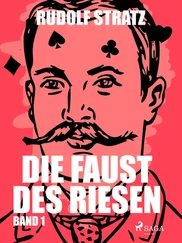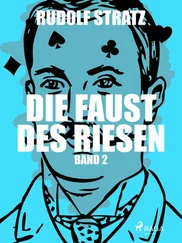Den geraden Weg zur »Normalität« versperrten bislang ein paar Millionen Vergaste, in wissenschaftlichen Experimenten Ermordete, in der Haft Erschlagene, durch Zwangsarbeit Vernichtete, von Einsatzgruppen und Wehrmacht Ermordete, von furchtbaren Juristen in den Tod Geschickte. Diese sperrige Last sollte weggeschafft werden – dauerhaft und im Namen des »Volkstrauertags«. Das ist ein durch und durch verlogenes, in keine europäische Sprache übersetzbares Wort, das seine Entstehung (1923) dem Geist von Dolchstoßlegenden und seine Wiederbelebung (1952) dem bigotten Adenauer-Regime verdankt. Seine einzig stimmige und mögliche Übersetzung erhielt es 1934 von den Nazis, die aus dem heuchlerischen »Volkstrauertag« den »Heldengedenktag« machten. Sie sollen ihren Tag wiederhaben, jene, die nach der Rede von B. Seebacher-B. in der Paulskirche »Ich hatt’ einen Kameraden« anstimmten (FR 15.11.93).
Anderes als Ballast wegräumen wollte auch Nolte 1986 nicht, aber bevor ich auf die bemerkenswerte Reprise im Geiste der »Ideen von 1989« eingehe, lohnt sich ein Blick zurück.
Der Zeithistoriker M. Broszat forderte schon 1985 eine »Historisierung« des Nationalsozialismus. Er redete damit allerdings nicht einer verharmlosenden Einordnung der Nazi-Zeit und der Nazi-Verbrechen ins Kontinuum der Geschichte das Wort (wie neuerdings R. Zittelmann, K. Weissmann, G. Schöllgen u. a.). Im Gegenteil: Gerade wer auf der Einmaligkeit des Verbrechens industrieller Menschenvernichtung besteht, muss zwingend – um die Einmaligkeit begreifen zu können – historische Vergleiche anstellen, um das Geschehen im historischen Kontext zu verstehen. Dieses aufklärerische Unternehmen, kritisch verstanden und nicht apologetisch im Sinne jener, die das Ganze endlich vergessen machen wollen, richtete sich auch gegen die nur noch mit beschwörenden Chiffren und pathetischen Formeln operierende Redeweise über die Nazi-Verbrechen. Dazu gehören das raunende Herzitieren von »Auschwitz« bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit ebenso wie das immunisierende Gerede über »Singularität« oder »Zivilisationsbruch« (Dan Diner), das sich jedem rationalen Verstehen und Begreifen entziehe und entziehen solle.
Die im Historikerstreit kulminierende Debatte hat ihren Ursprung in der »geistig-moralischen Wende«, die Kohl 1981 programmatisch verkündete. Konservative Historiker und Publizisten entdeckten daraufhin, woran es den Deutschen angeblich besonders mangelte – an »Identität«, die einige bald »nationale Identität« nannten, womit dann jeder wusste, wohin die Reise gehen sollte. Sinn- und Identitätsbastler hatten von nun an Konjunktur.
Zum 30.1.1983, d. h. zur fünfzigsten Wiederkehr des Tages, an dem die bürgerliche Elite in Deutschland die Macht den Nationalsozialisten übergab, hielt H. Lübbe eine Rede im Berliner Reichstagsgebäude (FAZ 24.1.1983). Diese Rede markiert die konservative Trendwende mit dem Anspruch, die Nation wiederzubeleben, was freilich nur funktioniert, wenn gleichzeitig die Verbrechen, die in deren Namen begangen wurden, »normalisiert« werden. »Identität« und »Normalität« sind die Parolen, unter denen Ideologieproduzenten seither zum Halali blasen, weil Nation pur vielen noch zu schrill klang. Nach 1989 ist »Verantwortung« als Passepartout fürs Weltpolitische hinzugekommen. Im Namen der populistischen Dreifaltigkeit von »Identität«, »Normalität« und »Verantwortung« legen sie nun los, seit wir wieder »ein« Volk sind – von ganz rechts bis post-links.
Zwar gestand Lübbe ein, dass bis 1968 »im Schutz öffentlich wiederhergestellter normativer Normalität« von den Nazi-Verbrechen außerhalb wissenschaftlicher Zirkel kaum die Rede war. Geschichte und Erinnerung (gar solche an Verbrechen, an denen Hunderttausende deutscher Männer beteiligt waren) hätten Wiederaufbau und Wirtschaftswunder nur behindert. Flächendeckende Verdrängung bestimmte die politische Kultur, bis die Studentenbewegung das »kollektive Beschweigen« (Lübbe) nationalsozialistischer Verbrechen am Nierentisch ziemlich abrupt beendete. Lübbe plädierte 1983 für eine »gemeinsinnsfähige moralische und politische Normalität« als Sicherung für »die Immunität einer politischen Kultur gegen die totalisierende Machtergreifung ideologischer Heilsgläubigkeit«. Praktisch lief die Beschwörung solcher »Normalität« auf die Empfehlung hinaus, die Verbrechen gemeinsinnsfördernd Verbrechen sein zu lassen und sich im Übrigen »so einzurichten, dass, wenn auch diese Gegenwart schließlich Vergangenheit geworden ist, sie dem zustimmungsfähigen Teil der Vergangenheit zuzurechnen sein wird«.
Normalisierte Geschichte hat eine ziemlich späte Geburt. Die Normalisierung der Vergangenheit wurde gleichzeitig regierungsamtlich vorangetrieben. Kohl traf sich am 8.5.1985 mit Reagan im Konzentrationslager Bergen-Belsen und am gleichen Tag auf dem Soldatenfriedhof in Bitburg. Gewaltsamer wurde nie versucht, Täter – und dazu gehörten auch Wehrmacht, Reichsbahn und Verwaltungen, ohne die das System der Lager nicht funktioniert hätte – und Opfer symbolisch zusammenzuzwingen. Dazu passte, dass der damalige Fraktionschef der CDU/CSU, Alfred Dregger, der Öffentlichkeit seine Sicht des Zweiten Weltkriegs verriet: Er präsentierte sich als ein Ehrenmann, der am 8.5.1945 in Marklissa (Schlesien) nichts anderes als den Westen gegen den Bolschewismus verteidigt habe. Schneidig. Ins Deutsche übersetzt: Die alliierten Truppen, die Europa von Westen her von der Barbarei befreiten, fielen Dregger und seinesgleichen in den Rücken – mitten im Kampf gegen den Bolschewismus. Notorisch waren in jener Zeit die Zurufe des Vernunft-Atlantikers und Herz-Jesu-Nationalisten F. J. Strauß, endlich die »Büßerhemden« auszuziehen, um aus dem »Schatten der Vergangenheit« herauszutreten.
Stil und intellektuelles Niveau des übrigen Bonner Personals verschaffen dem Bundespräsidenten Weizsäcker einen Bonus, worüber er auch immer redet. Diesen Heimvorteil nutzte er trefflich mit seiner Rede zum 8.5.1985 und erhielt dafür viel Lob. Es gab jedoch in Weizsäckers Rede auch bedenkliche Stellen, etwa jene, in der er sich dazu verstieg zu behaupten, Hitler habe »das ganze Volk zum Werkzeug« seines Judenhasses gemacht und die industrielle Menschenvernichtung habe »in der Hand weniger« gelegen. Eine restlos trübe Passage war geeignet, den Revisionseifer der Historiker zu beflügeln: »Während des Krieges hat das nationalsozialistische Regime viele Völker gequält und geschändet. Am Ende blieb nur noch ein Volk übrig, um gequält, geknechtet und geschändet zu werden: das eigene, das deutsche Volk«. Die Deutschen als Opfer ihres eigenen Krieges? Wenn dem so wäre, gäbe es hierzulande nur noch Opfer. Weizsäckers abgründigen Satz verrät ein Webfehler: Die anderen Völker erscheinen gleichsam als Komparativ (»gequält und geschändet«), wir aber sind der Superlativ (»gequält, geknechtet und geschändet«). Die anständig zelebrierte präsidiale Trauer hat ein vermeintliches Super-Opfer im Hinterkopf, um das sie vor allem trauert – und demaskiert sich allein damit als verlogen.
Von Gustav Heinemann wissen wir, dass er seine Frau liebte, seine Kinder und seine Freunde, aber nicht den Staat, das Land oder gar die nation introuvable. Nach 1989 und speziell bei B. Seebacher-B. ist das natürlich ganz anders. Nichts findet sie süßer als den Traum, auch hier wieder einmal mit »Trauer« und Horaz’ obligatem »Stolz« vor einem jener meist grässlichen Kriegerdenkmale stehen zu dürfen, die man tatsächlich in jedem französischen Nest antrifft und auf denen für 1870/71, 1914/18, 1939/45, 1946/54, 1958/62 unentwegt »pour la patrie« gestorben wird. »Die« Franzosen brauchen den Firlefanz nicht. Aber die französischen Regierungen jeder Couleur beherrschen die Klaviatur des nationalistischen Pathos, mit dem man je nach Lage der Dinge gegen Einwanderer aus dem Maghreb, »boches«, Maastricht oder die deutsche Bundesbank mobil macht, um von der hausgemachten Misere abzulenken. B. Seebacher-B. nimmt den versteinerten Schwachsinn (mort pour la patrie) als Vaterlandsliebe ernst, »ohne die nichts oder nicht viel gelingen und kein noch so großer Geldtransfer Wirkung zeigen kann«. Als Frau hat sie eine etwas größere Chance, sich an Heldengedenktagen vom süßen Traum an tote, aber virile Kerle durchschütteln lassen, während man als Mann aller historischen Erfahrung nach halt nur zu jenen gehören dürfte, die im »Ernstfall« bereits von unten her zuschauen, wie die oben wieder einmal auf »Volkstrauertag« machen.
Читать дальше