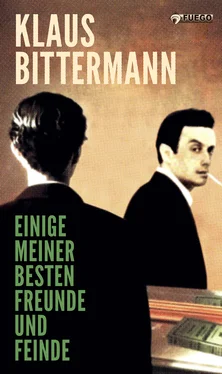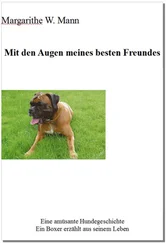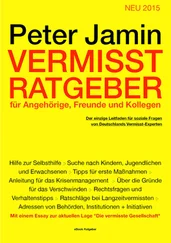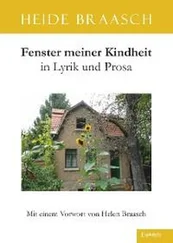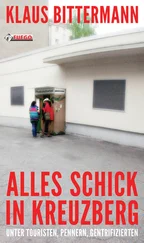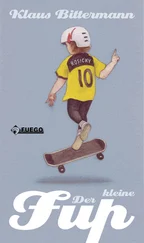Bei den Linken, deren Liebe zu den Palästinensern besonders heftig brannte, ließ sich diese Entlastung für Deutschland besonders schön beobachten:
»Dreihundert von der südafrikanischen Polizei in Soweto erschossene Schüler kümmern niemand. Drei erschossene Schüler in Hebron machen die westdeutsche Linke vor Empörung fassungslos. Die Unterdrückung und Verfolgung der Palästinenser durch Israel wird so genau beobachtet und so leidenschaftlich angeprangert, weil sie beweisen soll: es gibt keinen Unterschied. So merkt die westdeutsche Linke nicht, dass ihr der Unterschied zwischen Deutschland und den anderen Nationen mit jedem Versuch, ihn zu verwischen und zu tilgen, nur umso kolossaler entgegentritt.«
Dieses Nicht-Begreifen der deutschen Geschichte leistete einem Denken Vorschub, welches jedes Massaker, das einem politisch in den Kram passte, mit Auschwitz gleichsetzte, um unter der Flagge von Humanität und Menschenrechten staatliche Souveränität missachten und Kriege anzetteln zu können. Die deutsche Linke hatte dafür die Argumente geliefert, die die rot-grüne Regierung im Bürgerkrieg in Jugoslawien nur noch zu übernehmen brauchte.
Am 1. November 1983 hielt Pohrt im großen Saal der Berliner »Akademie der Künste« vor ca. tausend Zuhörern einen Vortrag über den »Krieg als wirklichen Befreier und wahren Sachwalter der Menschlichkeit«. Anschließend gab es eine Diskussion mit dem Friedensbewegten Fritz Vilmar und dem ehemaligen Frankfurter Sponti und Mitglied der »Revolutionärer Kampf«-Gruppe Thomas Schmid, der heute als konservativer Leitartikler die Öffentlichkeit vor linken Irrtümern warnt. Das Publikum war so gespalten wie das Podium, und Pohrt war in seinem Element. Die heftigen Reaktionen ließen ihn zur Höchstform auflaufen, und je mehr es im Saal brodelte, desto spöttischer und beißender wurden seine Diskussionsbeiträge. Nichts war ihm unangenehmer als eine reglos dasitzende Zuhörerschaft, und deshalb begann er jeden Vortrag mit einer auf die Veranstalter und die Themenstellung gemünzten provozierenden Anmerkung, um die Zuhörer aus der Reserve zu locken. Das setzt jedoch immer ein Publikum voraus, das uneins ist und sich zumindest teilweise auf die Seite Pohrts schlägt. Auf dem Konkret -Kongress im Sommer 1993, auf dem sich zum letzten Mal so etwas wie eine unabhängige Linke traf, war die Ablehnung Pohrts massiv und einhellig. Er selbst war enttäuscht und genervt.
Nach sechs Essay-Bänden, die mit Witz und Verve geschrieben sich als kritische Chronik der siebziger und achtziger Jahre lesen lassen, war mit dem Fall der Mauer eine neue Epoche angebrochen. Für Pohrt höchste Zeit, sich den Ereignissen auf andere Weise zu nähern als mit feuilletonistischer Kommentierung. Er machte Reemtsma das Angebot, das Massenbewusstsein der Deutschen in der Umbruchsphase zu untersuchen und die Chancen für einen neuen Faschismus zu sondieren. Im Hamburger Institut zusammen mit Ulrich Bielefeld zu forschen kam für ihn allerdings nicht in Frage. »Da hat der vereinte Sachverstand gründlich nachgedacht, und es kam der originelle Vorschlag heraus, dass sich fünf Leute in Hamburg treffen sollen, um von ihren nicht vorhandenen konkreten Vorschlägen zu erzählen«, machte sich Pohrt über »Forschungsprojekte«, wie sie Bielefeld betrieb, lustig und beharrte darauf, als Einmannforschungsteam die Studie zu erstellen, die sich an der sozialwissenschaftlichen Methode der Frankfurter Schule und an dem 1950 erschienenen »The Authoritarian Personality« orientierte.
Pohrt traktierte seine Freunde, Verwandten und Bekannten mit einem 58 Aussagen umfassenden Papier, in dem Sätze bewertet werden sollten wie: »Im Wohlstand verkümmern die inneren Werte der Menschen, weil jeder nur auf den eigenen Wohlstand bedacht ist.« Er führte ausführliche Interviews und Gespräche, protokollierte sie und wertete sie aus, er zog sämtliche Register der Statistik und empirischen Sozialforschung, um schließlich zu dem von seitenlangen Ziffern und Koeffizienten untermauerten Ergebnis zu gelangen, dass die Werte »auf eine antizivilisatorische, antidemokratische Überzeugung schließen lassen, deren unerhörte Einhelligkeit ferner die ungebrochene Neigung zur freiwilligen Selbstgleichschaltung verrät«.
Pohrt hatte im Alleingang und in nur einem Jahr ein über 300seitiges Forschungsergebnis vorgelegt, womit sich ein größeres Wissenschaftsteam zehn Jahre lang die Zeit hätte vertreiben können. Auf eine nennenswerte Resonanz stieß diese Arbeit nicht, obwohl man zur Beurteilung der drei zentralen Ereignisse Anfang der neunziger Jahre in der Zone (Ausländerverfolgung), in Jugoslawien (Serbienfeldzug) und im Irak (Golfskriegspazifismus) auf die Studie Pohrts gut hätte zurückgreifen können.
Im Abstand von jeweils einem Jahr folgten mit »Das Jahr danach« und »Harte Zeiten« zwei weitere Bücher, die allerdings nicht mehr in Form einer empirischen Sozialstudie erschienen, sondern als »Analysen zur Zeitgeschichte, deren bescheidener Nutzen darin besteht, dass sie die spätere Legendenbildung erschweren könnten«. Pohrt hatte auf die Katastrophe hingewiesen, »als welche die Wiedervereinigung und der Zusammenbruch des Ostblocks sich entpuppten«, ohne dass eine gesellschaftlich relevante Gruppe den Versuch unternommen hätte, diese Entwicklung aufzuhalten.
1994 begann die Entwicklung schließlich an Dynamik zu verlieren, sie wurde zum Dauerzustand. Das Elend wurde chronisch, aber niemals Grund zur Einsicht oder gar größerer und nachhaltiger Proteste. Die Intellektuellen wurden noch national gesinnter und die Bevölkerung war jederzeit bereit, weitere Einschneidungen im Sozialsystem hinzunehmen. Stattdessen wurden Pohrt in der taz für seine Studien folgende Komplimente gemacht: er sei ein »deutscher Apokalyptiker«, ein »außer Rand und Band geratener Utopist«, ein »deutscher Rassist par excellence« und ein »manischer Inländerfeind«. Das behauptete jedenfalls Reinhard Mohr, der sich mit solchen Artikeln für einen Job beim Spiegel empfahl.
Pohrt wurde in einem ungeheuren publizistischen Kraftakt zum führenden politischen Kommentator, der im Dunstkreis einer unabhängigen Restlinken und von Konkret , in der er regelmäßig veröffentlichte, den Ton und manchmal auch die Richtung vorgab und dennoch immer ein Fremdkörper blieb, weil ihm jede Gefolgschaft suspekt war. Die Abwendung vom Palästinenserfeudel hin zu einer Pro-Israel-Haltung, die im Golfkrieg 1991 offensiv vertreten wurde und Konkret mehrere hundert existenzgefährdende Abonnenten kostete, kam nicht zuletzt durch seine vehemente Fürsprache der amerikanischen Einmischung zustande, die in seinem Wunsch kulminierte, die Israelis würden sich der Bedrohung durch den Irak notfalls mit einer Atombombe zur Wehr setzen. Später bedauerte er die Äußerung, die aus der Erregung darüber entstanden war, dass man in Deutschland Saddams Scud-Raketen als selbstverschuldete Bedrohung bagatellisierte. Inzwischen hat sich im Nahen Osten einiges geändert, weshalb er das unreflektierte Festhalten an dieser Position später als Unfähigkeit kommentierte, sich von einer liebgewonnenen Einsicht wieder zu verabschieden, wenn die gesellschaftlichen Prämissen andere geworden sind.
1997 erschien seine letzte Untersuchung, noch einmal von Reemtsma finanziert, von diesem aber schließlich nicht mehr gut geheißen. In »Brothers in Crime« ging es um die Auflösung der Politik und deren Transformation in ein klassisches Bandenwesen, und im Untertitel bereits klang an, das die Aussichten trübe waren: »Die Menschen im Zeitalter ihrer Überflüssigkeit.« Auch diesem Werk war trotz beachtlicher Resonanz kein großer Erfolg beschieden. Pohrts Kritik war zu radikal und verzichtete weitgehend auf populäre Thesen und Agentenromantik, wie sie Dagobert Lindlau in seinem Bestseller »Der Mob« verwendete.
Читать дальше