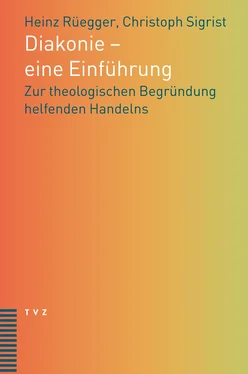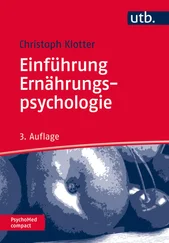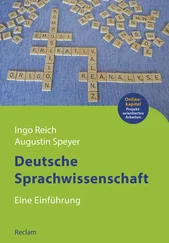1 ...6 7 8 10 11 12 ...17 Im Deuteronomium wird nun zum ersten Mal ein umfassendes sozialrechtliches Konzept entwickelt, durch das zwei Gruppen der Gesellschaft speziell sozial gesichert werden sollen. Die eine Gruppe sind die Armen, die andere die Landlosen. Normativer Leitgedanke dabei ist, dass der Reichtum, der durch Gottes Gabe und menschliche Arbeit entsteht, durch die gerechte Partizipation aller zum Segen und zum Wohlstand führen soll.
Im Blick auf die Landlosen, die nicht an Land und Reichtum teilhaben, wird das Gesetz über den Zehnten eingeführt: «Vom ganzen Ertrag deiner Saat sollst du den Zehnten geben, von dem, was auf dem Feld wächst, Jahr für Jahr, und du sollst vor dem HERRN, deinem Gott, […] den Zehnten deines Korns, deines Weins und deines Öls verzehren» (Dtn 14,22 f.). In jedem dritten Jahr soll diese Steuer des Zehnten an Menschen ohne Grund- und Erbbesitz ausbezahlt werden. So wird den Leviten, Witwen, Waisen und Fremden die Existenz gesichert (Dtn 14,28 f.). «Das ist die erste Sozialsteuer der Weltgeschichte, die Urzelle rechtlicher und staatlicher Verantwortung für die Schwächsten aus dem allgemeinen Steueraufkommen.»66 Nach Frank Crüsemann kann man diese Steuer sozialpolitisch nicht hoch genug einschätzen: «Dass alle Besitzenden und Produzierenden eine regelmässige Abgabe in Form einer Steuer zugunsten der materiell Ungesicherten und sozial Schwachen leisten sollen, diese also dadurch einen festen und geregelten Unterhalt haben, wird hier zum ersten Mal formuliert.»67 Diese Sozialsteuer des Zehnten ist eine der grundlegenden, schriftlich tradierten rechtlichen Regelungen zur Sicherung der materiellen Existenz von Landlosen.
Ebenso grundlegend ist das Zinsverbot. «Leihst du Geld dem Armen aus meinem Volk, der bei dir ist, so sei nicht wie ein Wucherer zu ihm. Ihr sollt ihm keinen Zins auferlegen» (Ex 22,24). Das Verbot kommt neben |53| dem Bundesbuch noch in veränderter Gewichtung und Form an zwei weiteren Stellen vor, im deuteronomistischen Gesetzbuch (Dtn 23,20 f.) und im Heiligkeitsgesetz (Lev 25,35–38). Alle drei Stellen verbieten, unter Volksgenossen Zinsen zu nehmen. So soll vermieden werden, dass der, der ein Darlehen aufnehmen muss, immer tiefer in den Strudel der Verarmung und Verschuldung gerät.68
Der Schuldenerlass ist das dritte Instrument, um gegen die Verarmung anzukämpfen. Armut ist eine Falle, aus der verschuldete Menschen oft nicht mehr herauskommen. Deswegen ist ein regelmässiger Schuldenerlass vorgesehen: «Alle sieben Jahre sollst du einen Schuldenerlass gewähren. Und so soll man es mit dem Schuldenerlass halten: Jeder Gläubiger soll das Darlehen erlassen, das er seinem Nächsten gegeben hat. Er soll seinen Nächsten und Bruder nicht drängen, denn man hat einen Schuldenerlass ausgerufen zu Ehren des HERRN […] Was du aber deinem Bruder geliehen hast, das sollst du ihm erlassen. Doch Arme wird es bei dir nicht geben, denn der HERR wird dich segnen in dem Land, das dir der HERR, dein Gott, zum Erbbesitz gibt» (Dtn 15,1–4).69
Solche grundlegenden rechtlichen Regeln konnten in der Zeit des Königs Joschija, in der viele von ihnen schriftlich formuliert wurden, aber auch bei seinen Nachfolgern faktisch kaum durchgesetzt werden. Es blieb also eine spannungsvolle Differenz zwischen sozial gerechtem Sollen und realpolitischem Sein, zwischen moralisch-theologischem Anspruch und gelebter Praxis.70 Dennoch wurden diese Regeln interessanterweise als Teil der Tora Israels weiter überliefert und nicht als realpolitisch nicht implementierbar wieder ausgeschieden. Sie wurden weiter überliefert, offenbar als bleibende kritische Anfrage an reale gesellschaftliche Verhältnisse und als Impuls zu |54| deren Humanisierung in Richtung auf mehr soziale Gerechtigkeit und weniger menschliche Not und Verelendung.
3.1.6 Errichtung von öffentlichen Räumen für die Klage von Not
Nach Frank Crüsemann ist «für die Menschen der Bibel die Klage die erste, wichtigste und alles andere erst ermöglichende Reaktion auf sie treffende Nöte. Wer in aktuelle Not gerät, klagt – laut, unüberhörbar, massiv, wild. Nahezu ein Drittel der Psalmen gehören zur Gruppe der Klagen einzelner, in Not geratener Menschen.»71
Ein Beispiel dafür ist Ps 13:
Wie lange, HERR! Willst du mich ganz vergessen?
Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir?
Wie lange soll ich Sorgen tragen in meiner Seele,
Kummer in meinem Herzen, Tag für Tag?
Wie lange noch soll mein Feind sich über mich erheben?
Sieh mich an, erhöre mich, HERR, mein Gott.
Mache meine Augen hell, damit ich nicht zum Tod entschlafe,
damit mein Feind nicht sage: Ich habe ihn überwältigt,
meine Gegner nicht jauchzen, dass ich wanke.
Ich aber vertraue auf deine Güte,
über deine Hilfe jauchze mein Herz.
Singen will ich dem HERRN,
denn er hat mir Gutes getan.
Geklagt wird in drei Richtungen: 1. Gegenüber dem einen Gott, der als für alles zuständig erachtet wird. Klagen sind insofern immer Gebete. 2. Im Blick auf sich selbst, und zwar mit ganz allgemeinen, stereotypen Aussagen, die auch heute von Leid Geplagten Sprache verleihen können. 3. Gegenüber den Feinden, indem schonungslos ausgesprochen wird, was alles als das eigene Leben bedrohend und als verängstigend erfahren wird.
Die überlieferten Klagepsalmen sind bis auf den heutigen Tag immer wieder benutzte Gebete, obwohl die Antworten Gottes genauso wie die Riten, in die die Gebete einst eingebunden waren, nicht überliefert sind. Die Klagen können für sich stehen, weil in ihnen die authentische Stimme der sozial, wirtschaftlich, kulturell und gesundheitlich Bedrängten zu hören ist. |55| Nach Herbert Haslinger kommen in den Klagen «die Stimmen der von Not betroffenen Menschen authentisch zu Gehör. Folglich muss das Klagen in der Diakonie notwendig einen Ort haben und die Ermöglichung des Klagens in sich als eine Realisierung der Diakonie gesehen werden.»72
Nicht nur die Klage an und für sich gehört zur Hilfekultur Israels. Das bedeutsame Moment liegt im Öffentlichmachen privater Not. Denn «diese Öffentlichkeit der menschlichen Anklage und des göttlichen Zuspruchs, bei der die Notsituation aus dem Raum des individuellen Erlebens der betroffenen Person herausgeholt, in den Raum der Gesellschaft hineingestellt und so zur Sache aller wird, kann eine Hilfe sein, den Mechanismus von Notlage, gesellschaftlicher Isolierung und existentieller Bedrohung aufzubrechen».73
Tempelplatz und Vorhof waren öffentliche Räume der Klage. Weniger Trostzuspruch oder Segenswort, sondern vielmehr die Möglichkeit öffentlicher Klage auf öffentlichen Plätzen war das Hilfreiche, was religiöses Handeln anzubieten hatte.74 Diese Vernetzung von individueller Ohnmachtserfahrung und öffentlicher, kollektiv wahrgenommener Klage kann gesellschaftlichen Zusammenhalt restituieren und Sprachlosigkeit überwinden helfen.
3.1.7 Gottes Sein als Mit-Sein in Solidarität
Die Möglichkeit der Klage steht auf dem Hintergrund der Gewissheit, dass der Gott Israels ein Gott ist, der sich für die sozial Schwachen engagiert. Ein klassischer Ausdruck dieser wichtigen Verbindung von Gott und sozialem Engagement ist in Psalm 82 zu finden:75
|56| Gott steht in der Gottesversammlung, inmitten der Götter hält er Gericht: Wie lange wollt ihr ungerecht richten und die Frevler begünstigen? Schafft Recht dem Geringen und der Waise, dem Elenden und Bedürftigen verhelft zum Recht. Rettet den Geringen und den Armen, befreit ihn aus der Hand der Frevler. Sie wissen nichts und verstehen nichts, im Finstern tappen sie umher, es wanken alle Grundfesten der Erde. Ich habe gesprochen: Götter seid ihr und Söhne des Höchsten allesamt. Doch fürwahr, wie Menschen sollt ihr sterben und wie einer der Fürsten fallen. Stehe auf, Gott, richte die Erde, denn dein Eigentum sind die Nationen alle.
Читать дальше