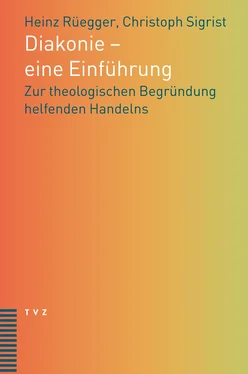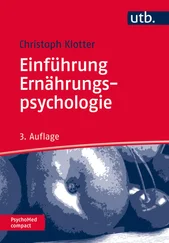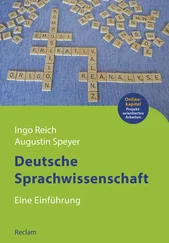Schliesslich werden die theologisch sensibilisierten Leserinnen und Leser unseres Buches wohl da und dort herausspüren, dass unser kirchlicher |41| Hintergrund reformiert, nicht lutherisch ist.50 Dazu kommt, dass wir uns auf die evangelische Diakonie-Tradition beschränkt haben; wir sind uns bewusst, dass dadurch die Entwicklung der katholischen Caritas-Praxis wie auch das diakonische Wirken anderer Konfessionen nicht gebührend gewürdigt werden können. Auch das wollen wir transparent machen. Denn es ist unseres Erachtens einfacher, ein faires Gespräch mit anderen Positionen zu führen, wenn man von vornherein offenlegt, woher man kommt und was die eigene Perspektive mit bestimmt.
|43| Teil 2: Hintergründe
|45| 3. Biblische Grundlagen
3.1 Alttestamentliche Perspektiven
Im alttestamentlichen Kontext geschieht helfendes Handeln in mancherlei Form. Wir wenden uns im Folgenden drei spezifischen Aspekten zu: Hilfe geschieht einmal als individuelles soziales Handeln zwischen Personen in vielfältigsten Lebenslagen, und zwar meist im Horizont einer Grossfamilie. Das unmittelbare mitmenschliche Hilfehandeln erfährt sodann im Laufe der Zeit eine Erweiterung in kodifiziertem Recht. Eine besondere alttestamentliche Form von Hilfe kann schliesslich in der Errichtung öffentlicher Räume für die Klage erfahrener Not gesehen werden.
3.1.1 Hilfe als soziales Handeln im Kontext von Sippensolidarität
Hilfe kommt im Alten Testament vor allem als Lebenshilfe im Rahmen der Familien- bzw. Sippensolidarität in den Blick. Solidarisches Handeln kam in diesem gesellschaftlichen Kontext ohne spezielle Institutionen und Expertenwissen aus. Die Sippe war in vorstaatlicher wie auch in staatlicher Zeit lange der einzige Bezugsrahmen, der Leben und Überleben ermöglichte. Beispiele solch gelebter Solidarität sind etwa die sogenannte Schwager- oder Leviratsehe (Dtn 25,5–10), also die Verpflichtung eines Mannes, beim vorzeitigen Tod seines Bruders dessen verwitwete Frau zu heiraten, damit deren soziale Einbindung und materielle Absicherung gewährleistet blieb; oder das Gebot, Vater und Mutter zu ehren (Ex 20,12), was konkret deren materielle Unterstützung und soziale Würdigung im Alter meint.
In den alttestamentlichen Texten kommen immer wieder typische existenzielle Notsituationen zur Sprache, zu deren Behebung Menschen auf die unmittelbare Hilfe anderer angewiesen waren. So zeigt etwa die Rut-Novelle in der Person von Rut sehr schön, wie im Horizont der Sippensolidarität die Probleme der Witwenschaft, der Kinderlosigkeit und des drohenden Hungers gelöst wurden: Ruth wurde ermöglicht, bei ihrem Verwandten Boas Ähren auf dem Feld zu sammeln (Rut 2,3 ff.), um so sich und ihre ebenfalls |46| verwitwete Schwiegermutter Noomi zu ernähren. Zugleich verhalf Boas Rut zu einer neuen (Schwager-)Ehe und zeugte mit ihr einen Sohn (Rut 3,1–17). Dadurch war sie bis an ihr Lebensende rechtlich, sozial und materiell abgesichert.
Für helfendes Handeln erweist sich das Ethos der selbstverständlichen Gastfreundschaft immer wieder als massgebend. Die Gastfreundschaft, insbesondere gegenüber Fremden, gehört zur allgemeinen altorientalischen Kultur und kommt in der Szene des Besuchs der drei Fremden beim Erzvater Abraham und seiner Frau Sara exemplarisch zum Ausdruck (Gen 18,1 ff.). Helfen heisst, Fremde als Gäste aufnehmen, sie mit Höflichkeit und Respekt behandeln, ihnen Schutz, Obdach und Speise gewähren. Die eigene Erfahrung von Fremdsein und Angewiesensein auf die Gastlichkeit Einheimischer prägt dabei die ganze Geschichte der Erzväter (Abraham: Gen 17,8; 23,4; Isaak: Gen 26,3; Jakob: Gen 28,4) sowie die Exodus-Tradition (Ex 6,4).
Exemplarisch für Notsituationen, die zu helfendem Handeln herausfordern, werden einerseits immer wieder Menschengruppen genannt, die ihre fundamentalen Lebensbedürfnisse nicht selbst abdecken können: Hungrige etwa, die darauf angewiesen sind, dass jemand ihnen Nahrung gibt, oder Nackte, die der Kleidung bedürfen (Ez 18,7). Andererseits kommen stereotyp Menschen in den Blick, die selbst nicht rechtsfähig und darum besonders leicht zu manipulieren und zu unterdrücken sind: Fremde, Witwen und Waisen (Jer 7,6).51
Die Funktion des Helfens im Blick auf in Not geratene Menschen wird nicht nur als selbstverständliche Pflicht jedes Israeliten verstanden. Beispielhaft dafür stehen weise Frauen oder Ratgeberinnen. Neben Prophetinnen kennt die alttestamentliche Tradition «weise» Frauen, die sich in politischen Notsituationen hilfreich einmischen und sich so massgeblich für die Rettung von Menschenleben einsetzen (vgl. 2Sam 14,1 ff.; 20,14 ff.). Explizit wird erwähnt, dass Frauen bei der Geburt helfen (Ex 1,15–22), Fluchthilfe betreiben (Jos 2), diplomatische Verhandlungen führen und durch weise Vermittlungsarbeit Konflikte für das ganze städtische Gemeinwesen schlichten (1Sam 25; 2Sam 20,14–22) sowie Fremde aufnehmen (1Kön 17).52
|47| Der explizite Auftrag des Helfens wird jedoch auch exemplarisch der Funktion des Königs zugeschrieben. In Psalm 72 wird das Idealbild eines Königs entworfen und von ihm erwartet, dass er «Recht schaffe den Elenden des Volkes, helfe den Armen und zermalme die Unterdrücker. […] Denn er rettet den Armen, der um Hilfe schreit, den Elenden, dem keiner hilft. Er erbarmt sich des Schwachen und Armen, das Leben der Armen rettet er. Aus Bedrückung und Gewalttat erlöst er ihr Leben» (Ps 72,4.12–14). Die Ausübung von Herrschaft wird an der Hilfekultur und Sorge im Blick auf die Armen gemessen.53 Die Kategorie Arme umfasst dabei sehr weit verstanden Menschen in irgendwelchen Situationen von Not und Bedrängnis.
3.1.2 Das Gebot der Nächstenliebe
Zentral für das alttestamentliche Ethos ist das Gebot der Nächstenliebe in Lev 19,18: «Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.» Herbert Haslinger macht deutlich, dass dieses Gebot «nichts von der individualistischen Pflege eines harmlosen, diffusen Sympathiegefühls an sich hat, aber – wie an seiner Rückbindung an die eigene Person (‹wie dich selbst›) abzulesen ist – auch nichts von der Naivität einer altruistischen Aufopferungsideologie. Die unmittelbar vorausgehenden bzw. nachfolgenden Bestimmungen zur Armenfürsorge (Lev 19,9 f.), zum Verbot von Diebstahl und Meineid (Lev 19,11 f.), zum Verbot der Ausbeutung und Schädigung Schwacher (Lev 19,13 f.), zum Verzicht auf Parteilichkeit oder Verleumdung (Lev 19,15 f.), zum Respekt vor Alten (Lev 19,32), zur Fremdenliebe (Lev 19,33 f.) und zur Ehrlichkeit vor Gericht (Lev 19,35 f.) definieren die Qualität des Gebots der Nächstenliebe. Es ist eingebunden in das Bemühen um Gerechtigkeit speziell für sozial benachteiligte Menschen und zielt auf die Verwirklichung einer solidarischen, humanen Gesellschaft, die getragen ist von dem Bewusstsein, dass jedem Menschen gleiche Würde und gleicher Wert zukommen.»54 Meint der Begriff Nächster hier wohl primär den Volksgenossen (unter Einschluss der in Israel ansässig gewordenen Fremden), tendiert die geforderte Haltung solidarischer Liebe doch ganz entschieden |48| dazu, die engen Volksgrenzen zu sprengen, was sich daran zeigt, dass in Lev 19,34 das Gebot der Nächstenliebe mit der gleichen Redewendung zum Gebot, den Fremden zu lieben, erweitert wird: «Du sollst ihn (sic. den Fremden) lieben wie dich selbst.»
Diese Haltung von Lev 19 macht deutlich – v. a. wenn sie noch zusammen gesehen wird mit Dtn 6,5 («Du sollst den HERRN, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit deiner ganzen Kraft») –, dass die für das Diakonieverständnis verhängnisvolle Behauptung Gerhard Uhlhorns, das Liebesgebot sei eine christliche Neuerung, weil die Welt vor Christus eine Welt ohne Liebe gewesen sei,55 vollkommen verfehlt ist. Im Gegenteil erweist sich das sogenannte Doppelgebot der Liebe, das immer wieder als christliches Proprium gedeutet wurde, als eindeutiges Erbe des Alten Testaments.
Читать дальше