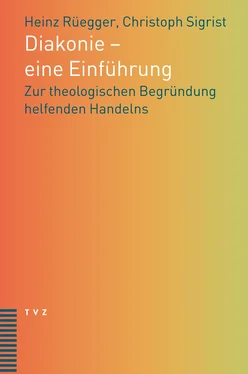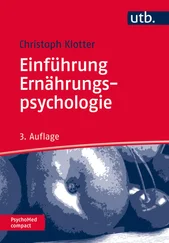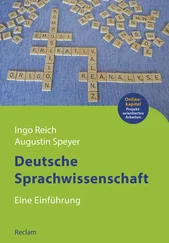Die andere, entgegengesetzte, «Falle» zeigt sich bei Diakoniewerken in einem manchmal geradezu zwanghaft anmutenden Versuch, sich in den eigenen sozialen Dienstleistungen von anderen, nicht religiös fundierten Institutionen abzugrenzen. Diakonie wird dann als «Sozialarbeit plus» verstanden und die eigene Daseinsberechtigung davon abhängig gemacht, dass man eben anders sei als andere. In diesem «anders» schwingt – oft unbewusst, zuweilen bestritten, aber von vielen doch spürbar wahrgenommen! – ein «besser» mit. Das Anderssein wird als Auftrag empfunden und zur Forderung an Mitarbeitende erhoben. Hier geschieht ein Stück theologische Überhöhung sozialen Handelns, die nicht hilfreich ist, sondern für manche Mitarbeitende Probleme schafft und deshalb ebenfalls einer Klärung bedarf.
Geht es also bei der ersten «Falle» um ein theologisches Defizit in der diakonischen Identität von kirchlichen Mitarbeitenden, so bei der zweiten «Falle» um eine problematische theologische Überhöhung helfenden Handelns in diakonischen Institutionen.
1.4 Die Absicht dieses Buches
Es ist die Absicht dieses Buches, hier eine Klärung vorzunehmen, und zwar eine theologische Klärung. Wir sind der Auffassung, dass eine solche um der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im kirchlichen Diakonat wie in Diakoniewerken willen notwendig ist.
Als Autoren dieser Schrift kommen wir selbst beruflich aus beiden anvisierten Bereichen: Christoph Sigrist hat seinen beruflichen Hintergrund im Rahmen der kirchlichen Diakonie und der universitären Diakoniewissenschaft; Heinz Rüegger verfügt über einen beruflichen Hintergrund in verschiedenen Diakoniewerken.
Im Blick auf die erste «Falle» geht es uns um eine Klärung des Ortes der Diakonie im Ganzen des kirchlichen Auftrags, im Blick auf die zweite «Falle» um eine Entmythologisierung und Versachlichung der alten Diskussion um das diakonische Proprium, also um das Besondere an diakonischem Handeln. In beiderlei Hinsicht geht es uns um einen Beitrag dazu, dass helfendes Handeln in der Kirche und in diakonischen Werken möglichst sachlich |26| und ohne Überheblichkeit, aber mit einer engagierten, in beiden Bereichen je eigenen Identität geschehen kann.
Darüber hinaus wollen die folgenden Kapitel eine allgemeine Einführung in die Diakonie geben. Sie soll Interessierten helfen, sich einen Überblick über die mit diesem Begriff bezeichneten Phänomene und Grundfragen zu verschaffen.
Wir möchten einen Beitrag leisten zu einem Gespräch, das auf breiterer Ebene in Kirchen und in diakonischen Werken zu führen ist. Wichtig wäre uns, dass dieser unser Beitrag in Kirchen und in diakonischen Werken auf dem Hintergrund der Herausforderungen durch die konkreten, alltäglichen Aufgaben gelesen und diskutiert wird und – in Zustimmung oder in Widerspruch – zu einer Klärung der eigenen «diakonischen» Identität beitragen kann. Es ist uns bewusst, dass die folgenden Kapitel notwendigerweise im Allgemeinen bleiben. Das gehört zu den Grenzen einer überblicksartigen Einführung. Wir hoffen allerdings, dass v. a. die Orientierungspunkte im sechsten Kapitel deutlich genug skizzieren, in welcher Richtung diakonische Praxis zu überprüfen und zu gestalten wäre.
Das Buch ist in drei Teile gegliedert. Der erste Teil stellt eine Hinführung zum Thema dar, beschreibt die Ausgangslage (Kap. 1) und enthält einige methodische Überlegungen (Kap. 2). Der zweite Teil behandelt die geschichtlichen Hintergründe der Tradition diakonischen Handelns, indem biblische Grundlagen skizziert werden (Kap. 3) und den geschichtlichen Entwicklungen von Diakonie nachgegangen wird (Kap. 4). Daran schliessen sich im dritten Teil grundsätzlich-systematische Überlegungen an: Kap. 5 entfaltet ein Diakonieverständnis, das davon ausgeht, dass praktizierte Nächstenliebe als solidarisches Helfen etwas Allgemein-Menschliches ist. Theologisch gesprochen gehen wir von einer schöpfungstheologischen Begründung helfenden Handelns aus, derzufolge Gott als Quelle aller Liebe alle Menschen mit prosozialen Fähigkeiten begabt hat und es insofern keinen grundsätzlichen Unterschied zwischen christlichem und nichtchristlichem Helfen gibt. Von daher setzen wir uns kritisch mit den in weiten Teilen der deutschsprachigen Diakonie und Diakoniewissenschaft zu beobachtenden Profilierungsversuchen auseinander und versuchen, das Selbstverständnis sowohl von diakonischen Institutionen wie auch von kirchlicher Diakonie sachgemäss zu bestimmen. Kap. 6 bietet im Sinne einer kleinen Ethik des Sozialen grundlegende Orientierungspunkte für helfendes Handeln im heutigen Kontext. Ein abschliessendes Kapitel (Kap. 7) gilt der Reflexion, was es bedeutet, dass sich Diakonie heute auf einem Sozialmarkt vorfindet und sich deshalb in einer Konkurrenzsituation mit vielen anderen sozialen Akteuren zu behaupten hat.
|27| In den Kap. 5–7 bringen zusammenfassende Thesen jeweils am Schluss des Kapitels oder Unterkapitels die wesentlichen Orientierungspunkte nochmals auf den Punkt und laden dazu ein, im Gespräch unter Mitarbeitenden konkrete Folgerungen für die eigene Praxis zu ziehen.
|29| 2. Nach dem Wesen von Diakonie fragen: methodische Überlegungen
Bei der Frage nach dem Wesen und der Identität von Diakonie gibt es eine weitverbreitete Tendenz, ein Vorgehen zu wählen, das durch dreierlei Voraussetzungen bestimmt ist:
Erstens setzt man beim Begriff der Diakonie ein, der sich auf das griechische Verb diakonein (dienen) bzw. das entsprechende Substantiv diakonia (Dienst) im Neuen Testament zurückführen lässt.
Das bedeutet zweitens, dass man mit der theologischen Vergewisserung im Blick auf das, was Diakonie sein soll, bei Jesus und beim Neuen Testament einsetzt. Klassisch zeigt sich dieses Vorgehen etwa noch am Ansatz des umfangreichen Diakonielehrbuchs von Reinhard Turre:13 Dieses Buch beginnt auf Seite 1 mit einem Kapitel über Grundlegung und Voraussetzung der Diakonie. Gleich der erste Satz hält fest, heutige diakonische Arbeit habe «ihren Grund im Auftrag Jesu Christi und ihre Voraussetzung in den geschichtlichen Ausprägungen dieses Auftrages in den verschiedenen Epochen der Kirchengeschichte». Das erste Unterkapitel (1.1) setzt dann sofort bei der «Diakonie nach dem Neuen Testament» ein, die so beschrieben wird, dass zuallererst einmal auf die «Begriffe» (1.1.1) rekurriert wird, insbesondere auf denjenigen des diakonein.
Zu dem weit verbreiteten Vorgehen bei der Bestimmung der Identität von Diakonie gehört drittens, dass es von Anfang an darauf ausgerichtet ist, das spezifisch Christliche an diakonischem Helfen herauszustellen. Das Interesse der Rückfrage nach dem Wesen von Diakonie liegt nicht primär auf dem Phänomen des Helfens als solchem, sondern ganz auf dem «Besonderen des Christlichen»14 in diakonischem Handeln.
|30| Wir halten diesen traditionellen Ansatz, das Wesen von Diakonie zu bestimmen, für ausgesprochen problematisch und wollen darum in jeder der drei Hinsichten einen anderen Weg einschlagen.
2.1 Die Sache, nicht der Begriff steht im Zentrum
Üblicherweise wird also Diakonie zu bestimmen versucht, indem man die sprachliche Herleitung des Begriffs zurückverfolgt und dann die Frage stellt, was das Nomen diakonia bzw. das Verb diakonein im Neuen Testament, in seinem kulturellen Umfeld und in der Alten Kirche bedeutete. Bloss: So wird man kaum zu einer hilfreichen Antwort gelangen, weil das, was man heute unter Diakonie und diakonischem Handeln versteht, nämlich die verschiedenen Formen sozialen, helfenden Intervenierens, im Neuen Testament in der Regel gar nicht mit den Begriffen diakonia bzw. diakonein bezeichnet wird, sondern eher in Texten zur Sprache kommt, die von Nächstenliebe sprechen, oder in Aufforderungen zu einem dem Willen Gottes entsprechenden Umgang miteinander.15 Es ist nicht zu übersehen, dass es im Neuen Testament viele Phänomene des Helfens gibt, die nicht mit dem Begriffsfeld diakonia bezeichnet werden, während viele Tätigkeiten mit diesem Begriff zum Ausdruck gebracht werden (zum Beispiel das apostolische Wirken des Paulus ganz allgemein16), die wenig bis gar nichts mit dem gemein haben, was uns heute vor Augen steht, wenn wir uns über die Identität «diakonischen» oder «sozialen» Handelns mitsamt den entsprechenden Institutionen, die sich daraus entwickelt haben, Gedanken machen.17
Читать дальше