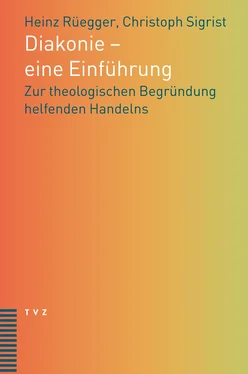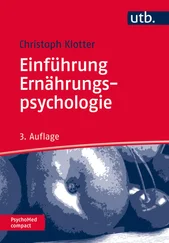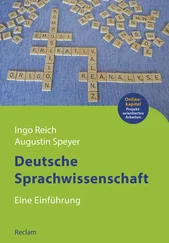3.1.3 Theologisierung sozialer Forderungen
Im Verlauf der Reflexion und Verschriftung der mündlichen Tradition wurden die vorerst einmal einfach als weise erfahrenen und ethisch evidenten Forderungen an ein humanes Zusammenleben theologisiert, d. h. als in Gottes Willen und im göttlichen Gebot begründet interpretiert. «Es ist nicht zufällig, dass das biblische Liebesgebot der krönende Abschluss einer Reihe von Schutzbestimmungen für die Armen, die Fremdlinge, die Tagelöhner, die Tauben und die Blinden ist (Lev 19,9–18); und es ist auch nicht zufällig, dass biblische Rechtssetzungen und Gebote im Laufe der Entwicklung immer deutlicher religiös verstanden wurden, nämlich als Entsprechungen zum Handeln Gottes. Der barmherzige und gnädige Gott (Ex 34,6; Ps 103,8 etc.) selbst verschafft den Waisen und Witwen ihr Recht, liebt die Fremden und gibt ihnen Nahrung und Kleidung (Dtn 10,18). Er ist Vater der Waisen und Anwalt der Witwen (Ps 68,6). Sein Verhalten gilt es nachzuahmen.»56
Helfen beinhaltet Handlungen, die die Tendenz zeigen, die individuelle bzw. die Sippenmoral zu überschreiten. Das in der israelitischen Gesellschaft sich manifestierende Gefälle zwischen reich und arm wurde zuerst einmal durch den moralischen Appell an die Wohltätigkeit der Reichen zu lindern versucht: «Denn es wird immer Arme geben im Land, darum gebiete ich dir: Du sollst deine Hand willig auftun für deinen bedürftigen und armen Bruder in deinem Land» (Dtn 15,11).
|49| Weisheitliche Texte begründen die Evidenz der den Armen geschuldeten Hilfe schon früh in der Königszeit mit der Einbettung allen Lebens in den Schöpfungszusammenhang: «Reiche und Arme begegnen sich, erschaffen hat sie alle der Herr» (Spr 22,2). Es ist fundamental mit dem Menschsein gegeben, dass einer, der dem Armen das kärgliche Brot vorenthält, ein Blutsauger ist (Sir 34,25). Wer dem Mitmenschen den Unterhalt wegnimmt, ist ein Mörder (Sir 34,26). Und wer dem Arbeiter den Lohn vorenthält, vergiesst Blut (Sir 34,27 f.). Helfen gehört fundamental zum Menschensein, hat in der Sippe seinen Ort und wird von ausgewiesenen Personen oder dem König vermehrt erwartet. Mit Manfred Oeming ist allerdings auch festzuhalten: «Sozialhilfe in Form von Mildtätigkeit für die Unterschicht ist nichts Spezifisches für Israel, eher allgemein altorientalisch, besonders im Kontext der Königsideologie, ja, allgemein menschlich. Die diakonischen Ansätze sind in den gesellschaftlichen Verhältnissen nur bescheiden entwickelt; Israel war eine hierarchische, auch ökonomisch elitär organisierte Agrargesellschaft, in die kaum demokratische Strukturen oder ein gesicherter Mittelstand implantiert waren. Vieles, ja alles wird vom König oder vom kommenden Messias erwartet, statt klare Programme zu entwickeln.»57
3.1.4 Die Erweiterung individuellen Helfens zu Ansprüchen kodifizierten Rechts
In der Tradition des Alten Testaments liegen neben vielfältigen ethischen Handlungsprinzipien vor allem ausformulierte Grundsätze sozialen Rechts vor. Silvia Schroer weist auf «die drei grossen Säulen der israelitischen Religion und Theologie» hin: Gesetz, Propheten und Schriften. «Alle drei Traditionskreise haben sich mit den Grundrechten von Menschen befasst, vorab mit den Grundrechten von freien israelitischen Männern, aber auch mit denen von verarmten und verschuldeten IsraelitInnen, mit denen der Fremden, der GastarbeiterInnen im Land oder der KriegssklavInnen.»58 Mit den Grundrechten ist nicht die auf dem westlich-abendländischen Menschenbild |50| fussende Rechts- und Gesellschaftsordnung gemeint. «So gab es unseren Begriff von Eigentum, der individuelle freie Verfügung beinhaltet, nicht. Es ging vielmehr um Nutzungsrechte Einzelner, aber zugunsten einer ganzen Sippe. […] Innerhalb der patriarchalen Herrschaftspyramide gibt es ein erschreckendes Ausmass von Verfügungsgewalt von Vätern über den Körper ihrer Töchter, von Männern über ihre Frauen. Der damalige Staat bemühte sich um die Schaffung eines für alle verbindlichen Rechts, hatte aber noch wenig Möglichkeiten, Rechtsbrüche zu kontrollieren und zu sanktionieren. Er blieb darin abhängig vom engmaschigen Netz der Sippenkontrolle. Trotz allem ist es eine ungeheure Arroganz, wenn wir deshalb meinen, dass altorientalische Kulturen kein Rechtsempfinden oder keine Utopie von Gerechtigkeit gehabt hätten.»59
Die Inhalte der alttestamentlichen Sozialgesetze, die Gottes Liebe in klare Solidaritätsregeln gegenüber den sozial Schwachen und Benachteiligten giessen, erweitern das individuelle und soziale Helfen erheblich. Die Ausrichtung auf rechtliche Regelungen für das Helfen leistet an und für sich schon einen wichtigen Beitrag zu einer Hilfekultur.60 Frank Crüsemann hat in zwei grundlegenden Aufsätzen die Grundlinien alttestamentlicher Hilfekultur als Beitrag zu einem angemessenen Verständnis von Diakonie dargelegt.61 Sie sind auch für unsere Ausführungen wegleitend. Crüsemann ist überzeugt, dass die Diakonie vom alttestamentlichen Befund her dem «ausdrücklichen Bezug auf die den sozial Schwachen zustehenden Rechte und ihre deswegen anzuerkennenden Ansprüche»62 ein stärkeres Gewicht beimessen müsste.
Der Schutz des Fremden ist eine der zentralsten Pflichten aller alttestamentlichen Rechtssammlungen.63 Die älteste Sammlung aus dem 8. Jh. v. Chr. hält in einer Zeit grösserer Flüchtlingsströme nach Juda und Jerusalem, die von der aggressiven Deportationspolitik der Assyrer ausgelöst wurden, sozusagen als Grundregel fest: «Einen Fremden sollst du nicht bedrängen und nicht quälen, seid ihr doch selbst Fremde gewesen im Land Ägypten» |51| (Ex 22,20; 23,9). Darin eingebettet werden die Rechte der Witwen und Waisen (Ex 22,21–23) sowie der Armen (Ex 22,24–26). Diese vier Sozialgruppen werden exemplarisch für die chronische Gefährdung bestimmter Menschen eingeführt, eine Typologie, die später durch die prophetische und deuteronomistische Tradition aufgenommen wurde, die gegen die Unterdrückung dieser sozial schwachen Gruppen ankämpfen.
Der Schutz der Fremden wird radikal zugespitzt: «Ein und dasselbe Recht gilt für euch, für den Fremden wie für den Einheimischen» (Lev 24,22). Dieser Rechtssatz wird in Verbindung mit dem Gebot der Nächstenliebe (Lev 19,18) nun zum Gebot der Fremdenliebe: «Wie ein Einheimischer soll euch der Fremde gelten, der bei euch lebt. Und du sollst ihn lieben wie dich selbst, denn ihr seid selbst Fremde gewesen im Land Ägypten; ich bin der HERR, euer Gott» (Lev 19,34). Die Evidenz des hier postulierten Rechts des Fremden auf Schutz liegt in der Erfahrung eigenen Fremdseins und dadurch gegebener Lebensbedrohung. Mit der Erinnerung an eigene Erfahrung des Fremdseins in Ägypten wird das Engagement für die Fremden, die nun dieselbe Erfahrung in Israel machen, gefordert. Dieser Motivationszusammenhang von eigener Erfahrung und Schicksal fremder Menschen wird zur ethischen Begründung eines der fundamentalsten Rechtssätze in Israel. Und schliesslich wird dieses Gebot im autoritativen Zuspruch Gottes begründet: «Ich bin der HERR, euer Gott». In der ganz weltlich-praktischen Solidarität gegenüber dem Nächsten und dem Fremden erweist sich nach israelitischem Glauben nichts weniger als die Anerkennung des Gottseins Gottes und die Respektierung seines Willens.
3.1.5 Engagement für die «Armen»
Als Typos für auf Hilfe Angewiesene ist in der hebräischen Bibel oft von «Armen» die Rede. Wer ist nun im engeren Sinn die Gruppe, die mit diesem Begriff umschrieben wird? Die so umschriebenen Personen sind wohl nicht einfach besitzlose und obdachlose Outsider auf der untersten sozialen Stufe. Sie sind offenbar frei, aber verarmt und überschuldet, obwohl sie noch Land besitzen. Diese Kleingrundbesitzer, die durch ihre Verschuldung abhängig werden, riskieren, in eine Form von Schuldsklaverei zu geraten (Lev 25,39). Sie sind es, die mit dem Begriff «arm» im engeren Sinn bezeichnet werden.64 Diese Abhängigkeit geisselt der Prophet Amos, wenn er die Reichen kritisiert, dass «sie den Gerechten verkaufen für Geld und den |52| Armen für ein Paar Schuhe» (Am 2,6). Öffnet man den Blick auf die Gruppe der als «Arme» im weitesten Sinn bezeichneten Personen, so können auch Witwen, Waisen und Fremde unter diese Kategorie fallen. Die Hauptursache der Verarmung liegt dabei im Verlust des Versorgers sowie im Verlust der Heimat.65
Читать дальше