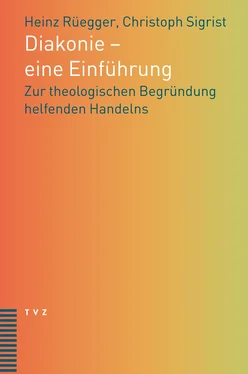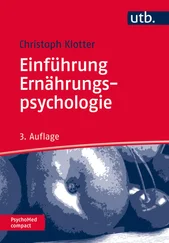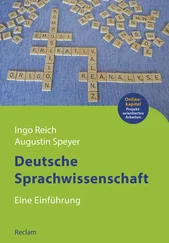1 ...7 8 9 11 12 13 ...17 Ohne auf die bis in die spätexilische Zeit verbreitete religionsgeschichtliche Vorstellung eines Pantheon (einer himmlischen Götterversammlung), zu dem der Nationalgott Israels dazugehörte, eingehen zu können, fällt die direkte Verbindung von Eintreten für den Elenden mit dem Gottsein Gottes auf. Gottes Gottsein wird hier verstanden als sein Mit-Sein in Solidarität.76 So also denken und reden die sozial Schwachen, die kleinen Leute wie auch die gebildeten Theologen über Gott: «Im Ringen der Armen und Elenden um ihr Leben und ihr Recht, im Kampf gegen die sie unterdrückenden Frevler, geht es um nichts Geringeres als um das Gottsein Gottes.»77 Denn die Wahrheit des göttlichen Anspruchs erweist sich eben darin, dass Gott mit den Geringen und Elenden solidarisch ist und ihnen zu ihrem Recht verhilft – ihnen, die ihre Not in öffentlicher Klage vor Gott bringen. Damit zeigt sich nochmals die diakonische Bedeutung, die dem Errichten öffentlicher Räume für die Klage über erfahrene Not zukommt.
|57| Aus alttestamentlicher Perspektive ist im Blick auf helfendes Handeln grundlegend festzuhalten:
Helfen orientiert sich weithin an den überlieferten moralischen Sitten und Gebräuchen, die über Israel hinaus im Alten Orient für das Zusammenleben in Sippe und Volk anerkannt waren. Man hilft, weil man weiss, was gut und recht ist (vgl. Mi 6,8).
Diese Praxis mitmenschlicher Solidarität und Nächstenliebe entwickelt sich zu einer Kultur sozialen Engagements, die sich auf Rechtssätze stützt. Helfen orientiert sich am Rechtsanspruch der sozial, politisch und kulturell Benachteiligten und greift über das private Engagement im Rahmen des Sippenverbandes hinaus. «Während die Liebe stets an das Subjekt des Handelnden gebunden bleibt, formuliert das Recht eben ein Recht des Betroffenen, des potentiellen Opfers. Dieses Recht sollte nach biblischer Tradition gerade nicht (allein) auf die manchmal schwankende Liebe, schon gar nicht die von Einflussreichen und Mächtigen gegründet werden.»78
Durch die Interpretation des Anspruchs der sozial Schwachen als Wille und Gebot Gottes wird helfendes Handeln in einem weiteren Kontext begründet. Zugleich gewinnt dadurch der Glaube an Gott, der sein Gottsein durch das Engagement für die Armen und Geringen erweist, ein besonderes theologisches und soziales Gepräge. Der Arme, der Gefangene und die Kranke, die Hungrige werden nicht nur Aufforderung zu helfendem Handeln, sondern zum Gegenstand theologischen Nachdenkens über Gottes Gottsein, und das gottesdienstliche Feiern am Sabbat lässt sich nicht mehr trennen von sozialer Verantwortung im Alltag. Gottes- und Nächstenliebe durchdringen sich aufs Engste.79
Es kann jedenfalls nicht übersehen werden, dass wir es beim Alten Testament in ausgeprägtem Mass mit einer «diakonisch ausgerichteten Schriftensammlung sozialer Gerechtigkeit und Barmherzigkeit»80 zu tun haben, die eine nicht zu unterschätzende, bleibende Bedeutung für diakonisches Handeln in der jüdischen, aber auch in der christlichen Tradition hat.
|58| 3.1.8 Eine frühjüdische Vision sozialen Handelns
Bevor wir uns den neutestamentlich-christlichen Aspekten zuwenden, sei mindestens noch ein kurzer Hinweis auf das diakonische Handeln des hellenistischen Judentums zur Zeit Jesu gegeben. Die Bedeutung des hellenistischen Judentums für die Diakonie liegt nach Klaus Berger darin, dass über die Überwindung der Volksgrenzen und die universale Ausweitung der praktizierten Nächstenliebe nachgedacht wird. Mehr noch: Praktische Nächstenliebe wird bei Philo von Alexandria zum Inbegriff der Gerechtigkeit.81
Eine eindrückliche Vision von dem Glauben entsprechendem sozialem Handeln zeigt sich in dem zwischen 100 v. Chr. und 100 n. Chr. entstandenen Testament des Hiob. In dieser Schrift wird Hiob als ein zum Judentum bekehrter Heide beschrieben. Ausgehend vom Hiobbuch der Bibel (vgl. Hiob 31,16 f.; 19,31 f.) wird gleichsam eine Vision vorbildlich organisierter Fürsorge beschrieben:
Es waren aber bei mir auch Tische in meinem Haus aufgestellt – dreissig an der Zahl und ständig zu allen Stunden, allein für Fremde. Ich hatte aber auch andere zwölf Tische für Witwen dastehen. Und wenn ein Fremder herantrat, Almosen zu erbitten, musste er erst an dem Tisch gespeist werden, bevor er das Benötigte empfing. Und ich gestattete nicht, dass man aus meiner Tür hinausging mit leerem Beutel. – Ich hatte 3500 Joch Rinder, und ich suchte daraus 500 Joch heraus und stellte sie zum Pflügen bereit, das einer auf jeglichem Acker machen konnte von denen, die sie nahmen. Und den Ertrag sonderte ich ab für die Armen zu ihrem Tisch. Ich hatte 50 Backöfen, von denen ich (einen Teil) bereitstellte zur Bedienung des Armentisches. (11,1) Es waren aber auch einige Fremde, die meine Bereitschaft sahen und die auch selbst beim Dienst (diakonia) dienen wollten. Und es gab auch bisweilen andere, die nichts hatten und nichts aufwenden konnten. Sie kamen und baten und sagten: Wir bitten dich, können wir auch diesen Dienst (diakonia) leisten? Aber wir besitzen nichts. Zeige Du Erbarmen mit uns und strecke uns Geld vor, damit wir in die grossen Städte gehen und Handel treiben und den Armen Dienst leisten können. Und danach werden wir dir dein Eigentum wiedererstatten. (10,1–11,4)82
|59| Hiobs «Diakonie» beschränkt sich nicht nur auf Unterstützung und Almosen, sondern «ist auf weit vorausschauende Planung und Aktivierung sowie (Wieder-)Eingliederung in das Erwerbsleben gerichtet. Dieses soziale Konzept ist, soweit ich sehe, für antike Verhältnisse einzigartig und erinnert eher an moderne soziale Massnahmen.»83
3.2 Neutestamentliche Aspekte
3.2.1 Jesu Heilungstätigkeit
Jesus half Menschen durch sein Wirken auf vielerlei Weise. Zum einen, indem er gesellschaftlich gesetzte Grenzen überwand. Er hatte keine Berührungsängste bei stigmatisierten Menschen und zeigte sich solidarisch mit ihnen, indem er zum Beispiel mit ihnen am selben Tisch ass, was ihm den Ruf eines «Fressers und Säufers, eines Freundes von Zöllnern und Sündern» eintrug (Mt 11,19; vgl. auch Lk 19,1–10). Durch seine Zuwendung zu ihnen drückte er Gottes Liebe aus, die allen Menschen gilt. Friedrich Wilhelm Horn sieht darin eine Leitlinie diakonischen Handelns bei Jesus.84
Zum andern half Jesus Menschen, indem er Kranke heilte.85 Horst Seibert beschreibt die Besonderheit von Jesu Heilungen im Kontext seiner Zeit. Jesus scheint so geholfen zu haben, dass er zuweilen auch von den auf Hilfe Angewiesenen erwartete, das Ihrige zur eigenen Heilung beizutragen (z. B. Mt 9,22). «Das Besondere am diakonischen Handeln Jesu war nicht, dass er Wunder tat. Mit dem Anspruch, Wunder tun zu können, traten auch andere auf. Aber Jesus besass die Gabe, ‹in anderen Menschen solche Fähigkeiten zu wecken› und die Bereitschaft, ihr ‹Recht, etwas zu tun›, anzuregen – anders als die Amtscharismatiker in Heilstätten, anders als die esoterischen Magier.»86 Ob nun Jesus bei anderen Menschen Energien, Kraftfelder oder Glauben freilegte, grundlegend ist: Jesus half, indem er heilte, und Menschen wurden gesund. Etwas von dieser unmittelbaren Hilfe kommt im folgenden Text zum Ausdruck:
|60| Und sie kommen nach Betsaida. Da bringen sie einen Blinden zu ihm und bitten ihn, er möge ihn berühren. Und er nahm den Blinden bei der Hand, führte ihn vor das Dorf hinaus, spuckte in seine Augen und legte ihm die Hände auf und fragte ihn: Siehst Du etwas? Der blickte auf und sprach: Ich sehe Menschen – wie Bäume sehe ich sie umhergehen. Da legte er ihm noch einmal die Hände auf die Augen. Und er sah klar und war wiederhergestellt und sah alles deutlich. (Mk 8,22–25)
Dass Jesus sich als Heiler betätigte, war offenbar ein auffallendes Kennzeichen seines Wirkens. Zwar wirkten auch andere Heiler zur Zeit Jesu. Dies ist jedoch kein Grund, Jesu heilendes Handeln zugunsten seiner Verkündigungspraxis herunterzuspielen und nur noch symbolisch zu deuten, wie dies häufig geschieht.87
Читать дальше