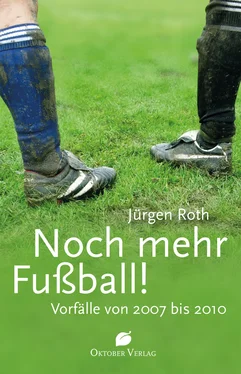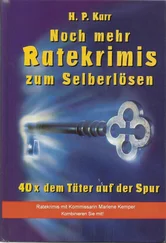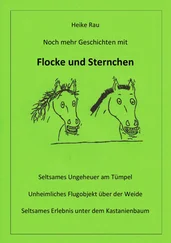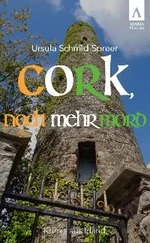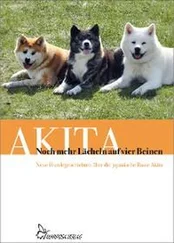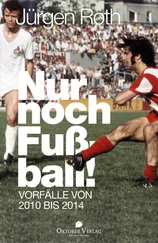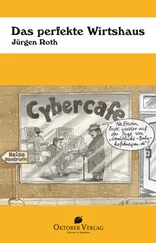Und wir ziehen noch zwei weitere Hüte: vor Henner Drescher und Fritz Weigle. Fritz hat nicht bloß die Zeichnungen des Zyklus »Goethe und die Eintracht« zur Verfügung gestellt, die den Anton-Hübler-Pfad unter dem hochhumanistischen Motto »Hier bin ich Fan, hier darf ich’s sein« auf siegestrunken wehenden Fahnen zieren; Fritz hat obendrein der Stadt Frankfurt und den Fans des GrünGürtels ein neues komisches Kunstwerk geschenkt: den Elfmeterpunkt aus der Sicht der Innenwelt des Feigenspan vorm Abschluß mit dem Außenspann.
Beziehungsweise: Was sagt derjenige, der die Installation »Der Elfmeterpunkt« entworfen und zusammen mit Henner Drescher in allen drei Raumdimensionen dieser Welt realisiert hat? Ich schalte um zu Fritz Weigle: »Die Erdachse wird in den GrünGürtel verlegt, und zwar in den Ostpark. Dort ist ein Biotop freilaufender Fußballspieler. Am Rande des Spielfeldes ragt jetzt die Erdachse, und sie trägt an ihrer Spitze den Elfmeterpunkt, der sonst vor dem Tor flachliegt. So wird der Rasen zugleich geschont und geschmückt.«
Auf dem Elfmeterpunkt liegt der Ball, ein klassischer WM-Ball aus Fünfecken wohlgemerkt, ein Ball, wie ihn Bernd Hölzenbein 1974 vor sich her trieb, bis ihn Wim Jansen von den Hölzenbeinen holte und Holz somit einen nicht ganz unbedeutenden Elfmeter rausholte. Dieser Ball aber liegt nicht eigentlich, sondern ragt – in den Himmel. Er ist, auf die Erdachsenfahnenstange gepfropft, gewissermaßen ein Fingerzeig, ein Hinweis auf die metaphysischen, ja numinosen Dimensionen des Elfmeters, auf das Inkalkulable des Strafstoßes (geht er rein – oder nicht?), auf die Abhängigkeit eines Spiels von der protogöttlichen Befugnissen geschuldeten, unumkehrbaren Entscheidung des Referees, auf die Verdichtung der menschlichen Existenz auf einen einzigen Augenblick, in dem das Befinden der Außenwelt, also der Zuschauer, auf Gedeih und Verderb der Verfassung der Innenwelt des Schützen ausgeliefert ist (hat er die Hosen voll, oder versenkt er die Pille eiskalt?). Ja, der Bernstein/Dreschersche »Elfmeterpunkt«, ist er nicht die zeitgemäße Antwort auf Michelangelos Fresko »Erschaffung Adams durch Gott«, ein Zitat des Motivs des ausgestreckten Fingers, ein Verweis auf den Funken (nicht Funkel!), der einer Mannschaft in einer verloren geglaubten oder auf der Kippe stehenden Partie neues Leben einhaucht – qua Elfmeterpfiff? Ist der aufgerichtete, im Winkel der Flugbahn eines Space Shuttles gen Firmament sich streckende Elfmeterpunkt samt Ball nicht ein Sinnbild des Strebens nach Höherem, nach Vollendung, ein Sinnbild der Sehnsucht, der Ebene, den Flachheiten des Lebens zu entkommen? Wollte nicht Goethe die Welt aus den Angeln heben, und war nicht der archimedische Elfmeterpunkt das geheime Zentrum seiner Studien und Schriften? Kreisten Goethes Sinnen und Trachten und Dichten und Denken nicht einzig und allein um die Idee, den erdgebundenen Menschen im Unendlichen, im Ewigen, im Triumph des Wahren, Schönen und Guten, das heißt im Moment, da die Eintracht die Deutsche Meisterschaft gewinnt, zu veredeln?
Meine sehr verehrten Damen und Herren, wie soll ich aus dieser Nummer wieder rauskommen? Mit der Hilfe von Henner Drescher. Ich schließe mit einer Strophe aus seiner »Lobeshymne auf Anton Hübler« und bitte Sie, sie genauso auswendig zu lernen wie den Fünfzeiler »Loy / Eigenbrodt, Höfer / Stinka, Lutz, Weilbächer / Kreß, Sztani, Feigenspan, Lindner, Pfaff / Ersatz: Goethe«:
»Vor Toni Hübler wußt’ man nicht / so recht, was ist des Zeugwarts Pflicht, / da Toni ist so aufgegangen, / so glorreich und so unbefangen, / träumt man heute vom Modell / Power-Toni aktuell.«
Ich danke Ihnen.
Eschatologische Epiphanie
Dieses dauernde Gefasel und Gemoser. Dieses mantraartige Gemotze. Dieses Genöle und rasend haltlose Geschnabel. Es ist schon alles allzu wunderbar dämlich.
Am Tag nach einem der denkwürdigsten Fußballspiele aller Zeiten entblödete sich der auf seine Weise auch äußerst notwendige TV-Sender N24 nicht, den ganzen Vormittag über die »Dusel-Bayern« zu sinnieren und zu quatschen, über das unverschämte Glück derer von der Säbener Straße, die nicht weniger zuwege gebracht hatten, als ein Drama von antikischem Ausmaß zu inszenieren, dessen Regeln neu zu schreiben und am Ende die Gesetze des Lebens außer Kraft zu setzen, jene Gesetze, denen zufolge alles stets in den immerfort gleichen Bahnen zu verlaufen habe.
Seien wir dankbar. Seien wir dankbar, so etwas in »nachmetaphysischen Zeiten« (Jürgen Habermas) erleben zu dürfen. In Zeiten der »transzendentalen Obdachlosigkeit« (Georg Lukács). Der schier unfaßbare Einzug der Bayern ins Halbfinale des UEFA-Cups, der »glückliche und unverdiente Einzug in die Runde der letzten Vier« ( www.sport1.de), er ist durch nichts und wieder nichts zu schmälern. Die reine Trunkenheit, der überwältigende Glanz des Einbruchs des Numinosen in die Tristesse des Hier und Jetzt – das wird von jenem Abend im Coliseum Alfonso Pérez in Madrid bleiben, konformes Lamentieren und gutmenschelndes Räsonieren über die ewig und drei Tage von Fortuna begünstigten Bayern hin oder her.
»Die armen Spanier«, tränendrüst Thomas Gsella, Chefredakteur der Titanic , am Telephon, »meine Seele schlägt für España.« Ach was. Der Spanier, das legte schon Egon Friedell in der Kulturgeschichte der Neuzeit dar, ist von »zähflüssiger Schneckenhaftigkeit« und treibt »die Kunst der Heuchelei« auf die allbekannte Spitze, »unsinnige Verbohrtheit, blinde Gier und unmenschliche Roheit« sowie »Genußsucht« und »gespreizte Bigotterie« sind die Hauptmerkmale seines Wesens. Wer Augen hat zu sehen, der sah, wie die Mannen dieses verbohrten Vorortklubs aus der Hauptstadt Spaniens bei jeder noch so sachten Berührung durch den Gegner den sterbenden Gallier mimten, wie diese albernen, im nachhinein als »aufopferungsvoll kämpfende Recken« titulierten Ramschschauspieler mit ihrem südeuropäischen Gehampel ein Spiel zu entscheiden versuchten, das, Gott sei es gedankt, die Roten durch unermüdlichen Einsatz und »das unfaßbare Ende« (N24), die zwei Treffer des, klar, südeuropäischen Hauptdarstellers Luca Toni, zu drehen vermochten.
Fußball ist keine Kunst, Fußball ist ein dezisionistischer Sport. »Im Fußball ist es immer so, daß man das Ende sieht«, merkte der aus Dubai zugeschaltete Topexperte Winfried Schäfer auf N24 völlig zu Recht und in eschatologischer Perspektive an. Wen interessieren da noch »taktische Defizite« (Uli Köhler, N24) oder technische Mängel (siehe insbesondere Flankenteufel Lahm)? Angesichts einer Epiphanie, die eine »offene Feldschlacht« (Horst Martin) mirakulös ins Unbegreifliche wendete?
Franck Ribéry soll auf dem Bankett nach dem Match des Jahrzehnts »Olli! Olli!«-Sprechchöre initiiert haben. Oliver Kahn gestand im Interview: »Ich war fix und fertig. Die psychische Belastung, der Sprint nach vorne, dann quer über das Feld und dann zurück durch irgendwelche jubelnde Menschen in Bayern-Trikots. Das war unglaublich. Der liebe Gott wollte heute anscheinend nicht, daß wir hier ausscheiden.«
Das ist die Wahrheit. Das 3:3 gegen Getafe, das war Fußball auf seinen Begriff gebracht, das war »Wahnsinn« (RTL) und deshalb die Wahrheit, denn nur im Irrsinn entbirgt dieser bekloppte Sport sein Geheimnis: in den raren Momenten der wahrhaftigen Peripetien mit der Ewigkeit verschwistert zu sein.
Die Zeitschrift 11 Freunde kürte mal das 1982er WM-Halbfinale zwischen Frankreich und Deutschland zum »Spiel des Jahrhunderts«. Es fand in Spanien statt, und Frankreich hatte in der Verlängerung 3:1 geführt, bevor Rummenigge und Klaus Fischer den Ausgleich erzielten.
Es meckere herum, wer mag. In unserer vom Fußball verbeulten Seele hat ein zweites Spiel seinen Platz gefunden, das Spiel des neuen Jahrhunderts. »Wir werden uns in zehn Jahren nicht über Real, Barca oder ManU unterhalten, sondern über Getafe«, sagt Oliver Kahn, und dazu nicken wir.
Читать дальше