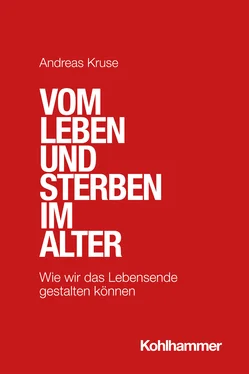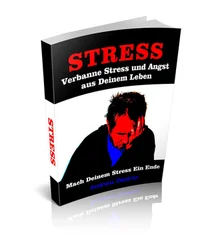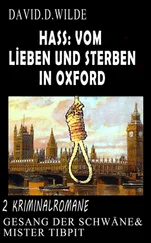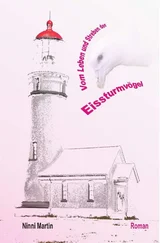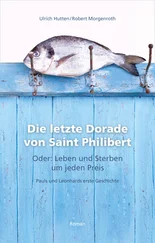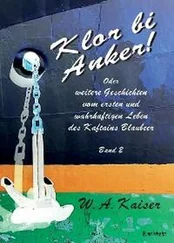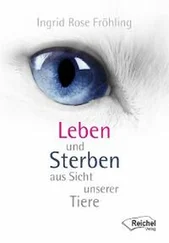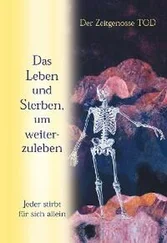1. Identität ist eine in allen Lebensphasen immer wieder neu zu erbringende und deshalb prinzipiell eine immer nur vorläufige Integrationsleistung;
2. Identität ist wesentlich von den angenommenen oder tatsächlichen Sichtweisen und Bewertungen anderer Menschen mitgeprägt;
3. Identität hat nicht allein privaten, sondern immer auch gemeinschaftsbezogenen Charakter.
Was ist damit ausgesagt? Bis in das hohe Alter, ja, bis zu unserem Lebensende ist uns die Aufgabe gestellt, an unserer Identität zu arbeiten: Sei dies durch den nach innen gerichteten Blick (Introversion), der in neue Einsichten und Erkenntnisse mündet, sei dies durch den Lebensrückblick, zum Beispiel in Form von Lebensgeschichten, die wir aufschreiben oder anderen Menschen in Gesprächen mitteilen, sei dies durch alte Interessengebiete, die wir neu aufleben lassen, sei dies durch ganz neue Interessengebiete, sei dies durch den intensiven Austausch mit nahestehenden Menschen der eigenen Generation oder nachfolgender Generationen, oder sei dies durch vertraute bzw. neue Formen spiritueller bzw. religiöser Aktivität. Entscheidend ist: Wir sollten das hohe Alter nicht mit einem seelisch-geistigen Stillstand gleichsetzen, dabei auch nicht dem Fehler verfallen, die größere Gelassenheit im Alter mit fehlendem Interesse an anderen Menschen bzw. an der Welt oder mit geringem Engagement für andere Menschen bzw. für die Welt gleichzusetzen. Nichts davon ist richtig. Vielmehr ist die Annahme korrekt, dass sich unsere Psyche (unser Selbst) im hohen Alter in besonderem Maße gefordert und herausgefordert sieht, was auch bedeutet, dass diese (bzw. dieses) ein hohes Maß an seelisch-geistiger Entwicklungsarbeit leisten muss. Und leisten kann, wenn die entsprechenden kognitiven und emotionalen Ressourcen gegeben sind, wenn das soziale Nahumfeld anregt, unterstützt, erwidert. Und damit ist der zweite Aspekt angesprochen: Nämlich jener der Einstellungen und Haltungen, die wir alten Menschen gegenüber (versteckt oder offen) zeigen: Wenn wir das hohe Alter diskreditieren, wenn wir alte Menschen diskriminieren: Dann fühlen sich diese in der Welt fremd, dann haben sie das Gefühl, »aus der Welt gefallen zu sein« (Else Lasker-Schüler). Sie fühlen sich mit und in ihrer Verletzlichkeit und Endlichkeit alleingelassen. Unter einer solchen Bedingung kann sich die Identität nicht mehr differenzieren, kann sich das Interesse an der Welt nicht mehr erhalten. Und dies bedeutet eben auch einen Verlust für die Welt. Hier füge ich meine (in vielen empirischen Untersuchungen gewachsene) Überzeugung an, dass der lebendige, fruchtbare Austausch mit alten Menschen – und dabei auch mit jenen, bei denen die Verletzlichkeit und Endlichkeit nicht nur nach innen fühlbar, sondern auch nach außen hin erkennbar ist – eine wirkliche Bereicherung bedeuten kann. Wenn aber alte Menschen das Interesse an der Welt aufgeben, dann ist damit eine Form der bereichernden Kommunikation dahin. Wir sehen: Die Identität, die Identitätsentwicklung hat immer auch gemeinschaftsbezogenen Charakter: Sie wird von der Gemeinschaft beeinflusst wie sie auch auf die Gemeinschaft einwirkt.
2.3 Die dritte theoretische Perspektive: »Verletzlichkeit und Reife in Sorgebeziehungen«
Die Analyse der persönlichen Einstellung und Haltung zum eigenen Tod kann an der Art und Weise, wie das Individuum versucht, Verletzlichkeitserfahrungen innerlich zu verarbeiten, nicht vorbeigehen. In den Verletzlichkeitserfahrungen – vor allem, wenn diese eine erhebliche Tiefe aufweisen und über lange Zeiträume bestehen oder gar nicht mehr abnehmen – klingen nicht selten Endlichkeitserfahrungen an: Denn das Individuum spürt und realisiert, dass es hier mit Grenzen konfrontiert ist, die es im günstigen Falle innerlich besser ertragen (»verarbeiten«) und äußerlich besser bewältigen (»lindern«), aber nicht mehr gänzlich aufheben kann. Gerade Patientinnen und Patienten, die an schweren Krankheiten leiden, die in Tiefe und Symptomschwere kontinuierlich zunehmen, assoziieren mit diesen Krankheiten Endgültigkeits- und Endlichkeitserfahrungen, sodass die Annahme einer thematischen Nähe zwischen Verletzlichkeit und Tod auch von daher naheliegend ist (siehe Kapitel 3). Dabei ist allerdings auch zu bedenken, dass diese thematische Nähe im Erleben des Individuums vielfach punktueller Natur ist, das heißt, dass nur zu einzelnen Zeitpunkten oder Zeiträumen Verletzlichkeit mit endgültigen Grenzen und über diese mit Tod assoziiert wird. Das heißt: In der inneren Auseinandersetzung (»Verarbeitung«) mit der erfahrenen Verletzlichkeit, in der daraus resultierenden Fähigkeit, diese allmählich besser ertragen zu können, findet sich eine seelisch-geistige und existenzielle Grundlage für die gefasste Einstellung und Haltung gegenüber dem eigenen Tod.
Eine derartige Annahme lässt sich zumindest implizit in der von Viktor Frankl erarbeiteten Existenzpsychologie finden, in der ausdrücklich von der Wertform des homo patiens gesprochen wird (Frankl, 2016, 2018). Es handelt sich nach Viktor Frankl bei dieser Wertform um einen Einstellungswert, dessen Ausbildung auf Prozessen intensiver innerer Auseinandersetzung mit dem eigenen Leben gründet wie auch auf einer Anpassung der Vorstellungen, Erwartungen und Hoffnungen, die an das Leben gerichtet werden, an die gegebene Situation. In einem solchen Prozess der inneren Auseinandersetzung und schöpferischen Anpassung kann sich nach und nach die Einstellung herausschälen, dass ein »Trotzdem!« oder »Gerade jetzt!« notwendig und auch möglich ist. Dem Individuum wächst also die Fähigkeit zu, das eigene Leben trotz endgültiger Grenzen anzunehmen, zu bejahen und auszukosten.
In der Erfahrung eigener Verletzlichkeit kann das Individuum vielleicht sogar deutlich erkennen, welche Interessen, welche Erlebnisse und Erfahrungen, welche Menschen sein Leben bisher getragen haben und auch heute tragen. Früher waren ihm diese als Fundament seines Lebens nicht wirklich, nicht vollumfänglich bewusst. Durch die Erfahrung der Verletzlichkeit aber kann ein derartiger Bewusstwerdungsprozess angestoßen werden (Gadamer, 2000/2010). In einem derartigen Einstellungswandel spiegelt sich die Wertform des homo patiens wider. Für Viktor Frankl ist diese die »höchste« der von ihm unterschiedenen drei Wertformen (homo faber: der schaffende Mensch; homo amans: der liebende und erlebende Mensch; homo patiens: der leidende und sein Leiden annehmende Mensch), da sie in besonderer Weise auf psychologischer und existenzieller Arbeit und einer aus dieser Arbeit resultierenden Einstellungs- und Haltungsänderung gründet.
Was aber folgt aus diesen Aussagen? Ich stelle die Annahme auf, dass jene Menschen, die gelernt haben, ihre Verletzlichkeit anzunehmen und in oder trotz der Verletzlichkeitserfahrung ein sinnerfülltes, stimmiges Leben zu führen, auch eine gefasstere Einstellung und Haltung zum Tod zeigen; hier erkenne ich übrigens Gemeinsamkeiten mit der schon ausführlich beschriebenen Studie von Joep M. Munnichs.
Nur stellt sich die Frage: Wie kann es einem Menschen gelingen, seine Verletzlichkeit anzunehmen, in und trotz ausgeprägter Verletzlichkeit ein sinnerfülltes, stimmiges Leben zu führen? Mit dieser Frage habe ich mich intensiv in dem Buch »Lebensphase hohes Alter – Verletzlichkeit und Reife« beschäftigt (Kruse, 2017). Da die Beantwortung dieser Frage auch für ein tiefes Verständnis der Einstellung und Haltung zum eigenen Tod wichtig ist, sei ihr an dieser Stelle Platz eingeräumt.
Ich differenziere – vor dem theoretisch-konzeptionellen Hintergrund der Gerontologie wie auch auf der Grundlage eigener empirischer Studien zum hohen Alter (Kruse & Schmitt, 2015a, b) – zwischen vier seelisch-geistigen Entwicklungspotenzialen im hohen Alter, die in ihrer Gesamtheit ein Entwicklungsniveau ergeben, das mit dem Begriff »Reife« umschrieben werden kann. Der Begriff der Reife dient mir dabei allerdings eher als Metapher, die ausdrücken soll, dass das Individuum in einer geistig konzentrierten, emotional gefestigten, von einem Selbst- und Weltgestaltungswillen bestimmten Art und Weise mit neuen Eindrücken, Herausforderungen und Anforderungen umzugehen vermag. Welche Entwicklungspotenziale aber sind gemeint? Erstens: Die Introversion mit Introspektion, die ich im Sinne einer vertieften Auseinandersetzung des Menschen mit sich selbst verstehe. Dabei gehe ich davon aus, dass mit zunehmendem Alter die Tendenz zur seelisch-geistigen Vertiefung eine immer stärkere Ausprägung erfährt (Introversion) und die vertiefte Auseinandersetzung mit sich selbst zu Erkenntnissen und Einsichten führt, die für die eigene Lebensführung funktional und bedeutsam sind (Introspektion). Zweitens: Offenheit, und zwar im Sinne der Empfänglichkeit für neue Eindrücke, Erlebnisse und Erkenntnisse, die aus dem Blick auf sich selbst wie auch aus dem Blick auf die umgebende soziale, natürliche und räumliche Welt erwachsen. Drittens: Sorge, und zwar im Sinne der Bereitschaft, für andere Menschen zu sorgen, sich um die Welt zu sorgen. Viertens: Wissensweitergabe, und zwar im Sinne des Motivs, Teil einer Generationenfolge zu sein und durch die Weitergabe von Wissen an nachfolgende Generationen Kontinuität zu erzeugen und Verantwortung zu übernehmen.
Читать дальше