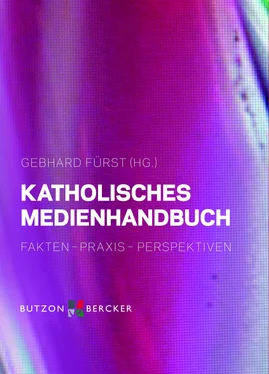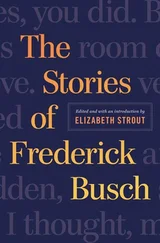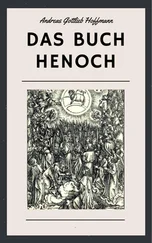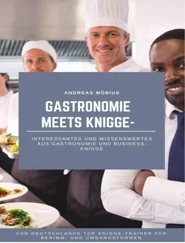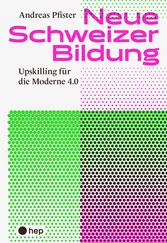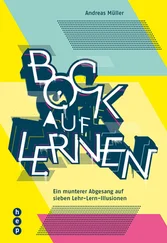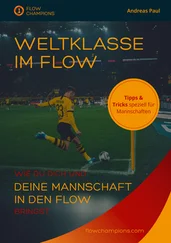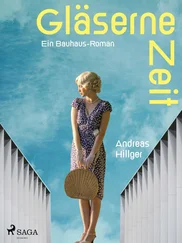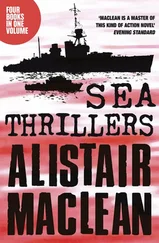Der kommunikative Kontrollverlust der Religion über die Religion dürfte in der durchmedialisierten Gegenwartsgesellschaft die zentrale Herausforderung für jede Religion darstellen.
Außerdem lassen die neuen Medien Internetrituale und sogar religiöse Kommunikationen zu, die offline keine Entsprechung haben. Der neue kommunikative Möglichkeitenraum des Computers ist so niederschwellig, dass „tendenziell jeder Teilnehmer an der Kommunikation sich an ein Netz der Datenverarbeitung wenden kann, aus dem Informationen gezogen werden können, die von keiner Situation ... mehr kontrolliert werden“ und „mit den herkömmlichen Formen der Beziehungskontrolle (via Grenzsetzung) und Quellenkritik (via Autorität) nicht mehr bewältigt werden können“ 57. Das Kon-trollproblem wird zur zentralen Herausforderung aller herkömmlichen Institutionen, nicht nur der Religionen, sondern auch von Wissenschaften, Medizin, Militär und Diplomatie. Denn der neue mediale Möglichkeitenraum ist weniger ein Raum „in dem Sinne, dass in ihm alles seinen angemessenen Platz hat, sondern eher in dem Sinne, dass man sich in ihm bewegen kann und verwenden und vertauschen kann, was man in ihm findet“ 58. In diesem neuen kommunikativen Möglichkeitenraum entsteht für diejenigen, die ihn nutzen, eine neue Vielfalt an Beziehungschancen, die schließlich die Einzigartigkeit der jeweiligen Person zu steigern vermag, d. h. er erweitert auf dem sozialen Koordinatensystem der Einzelpersonen ihre ohnehin schon multiplen Zugehörigkeiten und Identitäten.
Der für die Moderne typische Individualisierungsprozess erhält mittels der neuen medialen Kommunikationsmöglichkeiten – bis hin zu Second Life – gewaltige Schübe. Offline kann ich Katholik sein und online andere religiöse Zugehörigkeiten praktizieren, ohne an die kirchliche Publizistik angeschlossen zu sein.
Literatur
Ayaß, Ruth: Religion als Unterhaltung. Der Pfarrer als Fernsehheld.
In: Religion und Kultur. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie. Sonderheft 33, 1993, S. 350–367.
Baecker, Dirk: Studien zur nächsten Gesellschaft. Frankfurt 2007.
Hohm, Hans-Jürgen: Soziale Systeme, Kommunikation, Mensch.
Eine Einführung in soziologische Systemtheorie. Weinheim / München 22006.
26Malik, Jamal / Rüpke, Jörg / Wobbe, Theresa (Hgg.): Einleitung: Religion und Medien. In: Diess. (Hgg.): Religion und Medien. Vom Kultbild zum Internetritual, Münster 2007, S. 11.
27Luhmann, Niklas: Religion als Kommunikation. In: Tyrell, Hartmann / Krech, Volkhard / Knoblauch, Hubert (Hgg.): Religion als Kommunikation. Würzburg 1998, S. 135–145.
28Tyrell, Hartmann: Religiöse Kommunikation. Auge, Ohr und Medienvielfalt. In: Ders.: Soziale und gesellschaftliche Differenzierung. Aufsätze zur soziologischen Theorie. Wiesbaden 2008, S. 263.
29Vgl. Tyrell: (Anm. 3).
30Vgl. Knoblauch, Hubert: Populäre Religion. Markt, Medien und die Popularisierung der Religion. In: Honer, Anne u. a. (Hgg.): Diesseitsreligion. Zur Deutung der Bedeutung moderner Kultur. Konstanz 1999, S. 209.
31Vgl. Reichertz, Jo: RTL-Bibelclips. Christliche Verkündigung als Werbespot. In: Anne Honer u. a. (Hgg.): Diesseitsreligion. Zur Deutung der Bedeutung moderner Kultur. Konstanz 1999, S. 244.
32Hoffmann, Paul: Die „Transzendenz“ Gottes in der Verkündigung Jesu. In: Josef Bruhin u. a. (Hgg.): Misere und Rettung. Beiträge zu Theologie, Politik und Kultur. Luzern 2007, S. 125–134.
33Hoffmann, Paul / Heil, Christoph (Hgg.): Die Spruchquelle Q. Studienausgabe Griechisch und Deutsch. Darmstadt 2002, S. 24.
34März, Claus Peter: Der Brief als missionarisches und kirchenleitendes Medium bei Paulus. In: Malik, Jamal / Rüpke, Jörg / Wobbe, Theresa (Hgg.): Religion und Medien. Vom Kultbild zum Internetritual. Münster 2007, S. 115.
35März: (Anm. 9), S. 105.
36Wiefel, Wolfgang: Erwägungen zur soziologischen Hermeneutik urchristlicher Gottesdienstformen. In: Kairos 14/1972, S. 36–51.
37Tyrell, Hartmann: (Anm. 3), S. 299.
38Ebd., S. 301ff.
39Ebd., S. 308.
40Ebd., S. 310.
41Hohm, Hans-Jürgen: Soziale Systeme, Kommunikation, Mensch. Eine Einführung in soziologische Systemtheorie. Weinheim/München 22006, S. 74.
42Ebd., S. 74.
43Ebd.
44Ebd., S. 75.
45Ebd.
46Ebd., S. 78.
47Vgl. Keppler, Angela: Medienreligion ist keine Religion. Fünf Thesen zu den Grenzen einer erhellenden Analogie. In: Günter Thomas (Hg.): Religiöse Funktionen des Fernsehens? Wiesbaden 2000, S. 197.
48Nüchtern, Michael: Die (un)heimliche Sehnsucht nach Religiösem. Stuttgart 1998, S. 55.
49Nassehi, Armin: Erstaunliche religiöse Kompetenz. In: Bertelsmann Stiftung, Religionsmonitor 2008. Gütersloh 2007, S. 120.
50Reichertz, Jo: (Anm. 6), S. 245.
51Vgl. Rüpke, Jörg: Religion medial. In: Malik, Jamal / Rüpke, Jörg / Wobbe, Theresa (Hgg.): Religion und Medien. Vom Kultbild zum Internetritual. Münster 2007, S. 27.
52Vgl. Ayaß, Ruth: Religion als Unterhaltung. Der Pfarrer als Fernsehheld. In: Religion und Kultur (Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Sonderheft 33) 1993, S. 350–367.
53Vgl. Schelsky, Helmut: Gedanken zur Rolle der Publizistik in der modernen Gesellschaft. In: Ders.: Auf der Suche nach Wirklichkeit. München 1979, S. 306.
54Vgl. Kranemann, Benedikt: Gottesdienstübertragung: Kirchliche Liturgie in medialer Öffentlichkeit. In: Malik, Jamal / Rüpke, Jörg / Wobbe, Theresa (Hgg.): Religion und Medien. Vom Kultbild zum Internetritual. Münster 2007, S. 181–190.
55Nassehi, Armin: (Anm. 24), S. 120.
56Ebd., S. 125.
57Baecker, Dirk: Studien zur nächsten Gesellschaft. Frankfurt 2007, S. 84f.
58Ebd., S. 92.
3. Öffentlichkeit und Kirche
Matthias Wörther, Leiter der Fachstelle „medien und kommunikation“
im Erzbistum München und Freising
„Darum müssen Katholiken sich völlig dessen bewusst sein, dass sie wirklich die Freiheit der Meinungsäußerung besitzen“ – dieser Satz aus der 1971 erschienenen Pastoralkonstitution „Communio et progressio“ (Artikel 116) bezieht sich auf die Notwendigkeit einer öffentlichen Meinung innerhalb und außerhalb der Kirche. Mit der Freiheit der Meinungsäußerung und mit den beiden Öffentlichkeiten, der inneren wie der äußeren, in denen sie gegeben sein soll, hat die Kirche jedoch zweifellos weiterhin Probleme.
Ihre institutionellen Schwierigkeiten mit der Öffentlichkeit gehen auf die hierarchische Verfassung und das Selbstverständnis einer Einrichtung zurück, die sich auf göttliche Offenbarung beruft. Sie will mit von daher begründeter Autorität sprechen und die im Auftrag Gottes zu verkündende Wahrheit weder einer öffentlichen Diskussion noch demokratischen Meinungsbildungsprozessen überantworten und darf es auch nicht. Ihre grundlegende Orientierung auf das „Wort“ und die damit oft verbundene (und mit dem alttestamentlichen Bilderverbot untermauerte) latente Bildfeindlichkeit erschwert zusätzlich das angemessene Agieren in der Mediengesellschaft.
Die Probleme mit der äußeren Öffentlichkeit haben historische, institutionelle und aktuelle Ursachen. Seit der Entstehung der bürgerlich-säkularen Öffentlichkeit im 18. Jahrhundert sieht sich die Kirche mit einer kritischen Instanz konfrontiert, die sich ihrem Einfluss entzieht. Bis heute schwankt sie deshalb zwischen offensiver Beteiligung am Meinungsstreit und einem vorwürflichen Ressentiment, sie werde im medialen Raum gezielt angefeindet, diffamiert und unsachlich dargestellt.
Ihre institutionellen Schwierigkeiten mit der Öffentlichkeit gehen auf die hierarchische Verfassung und das Selbstverständnis einer Einrichtung zurück, die sich auf göttliche Offenbarung beruft. Sie will mit von daher begründeter Autorität sprechen und die im Auftrag Gottes zu verkündende Wahrheit weder einer öffentlichen Diskussion noch demokratischen Meinungsbildungsprozessen überantworten und darf es auch nicht. Ihre grundlegende Orientierung auf das „Wort“ und die damit oft verbundene (und mit dem alttestamentlichen Bilderverbot untermauerte) latente Bildfeindlichkeit erschwert zusätzlich das angemessene Agieren in der Mediengesellschaft.
Читать дальше