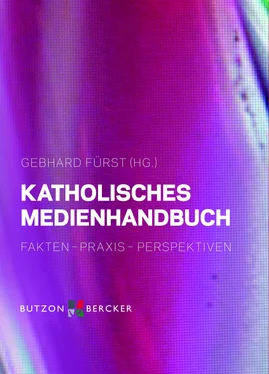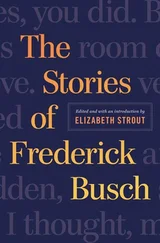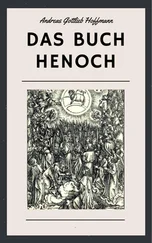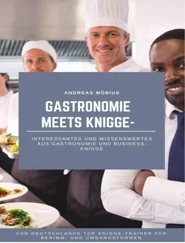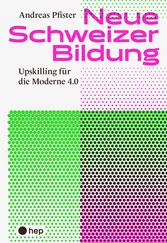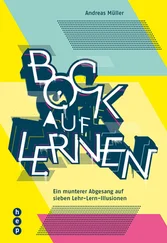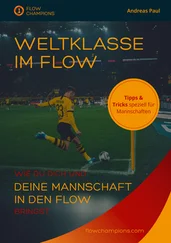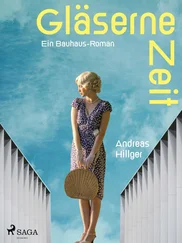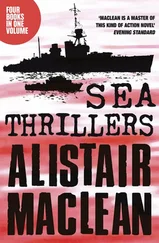Allerdings räumt Gehrke auch ein, dass die Idee einer „vierten Kulturtechnik“ beim Evolutionsparadigma keine Rolle spielt 18– womit dieses Paradigma eher neoliberal wirkt und keinesfalls der Aufdeckung und Behebung sozialer Exklusion dient.
Wenn es aber vor allem ältere Menschen sind, Frauen, Nicht-Berufstätige und Menschen mit formal geringeren Bildungsabschlüssen und Menschen aus bestimmten Regionen, die sich nicht am Internet – und damit erst recht nicht am Web 2.0 – beteiligen 19, dann handelt es sich offensichtlich um eine entlang der genannten Merkmale beschreibbare soziale Spaltung, die der digitalen Spaltung vorausliegt und von dieser noch verstärkt wird.
Zentrale Voraussetzung für die Erlangung von Kommunikationsfähigkeit in einer überwiegend mediatisierten Gesellschaft ist für alle Bevölkerungsgruppen die Vermittlung von Medienkompetenz. Es herrscht ein breiter Konsens, dass dies eine zentrale Herausforderung für alle gesellschaftlichen Gruppen ist, die mit dem Thema Bildung befasst sind – mithin auch für Kirche.
4. Nicht nur Kinder und Jugendliche – traditionell die Fokusgruppe von Bildungsbemühungen und damit verbundenen Innovationen – oder Erwachsene, die in Aus- und Fortbildung mit neuen Kommunikationstechniken und -medien konfrontiert sind, sondern auch alte Menschen erleben durch digitale Medien mehr Spiel- und Gestaltungsräume für Kommunikation und damit Partizipation. Dies belegen die seit Jahren stabil hohen Zuwachsquoten im Bereich der sogenannten „Silver Surfer“, also Angehörigen der Altersgruppe der über 60-Jährigen 20.
5. Zentrale Voraussetzung für die Erlangung von Kommunikationsfähigkeit in einer überwiegend mediatisierten Gesellschaft ist für alle Bevölkerungsgruppen die Vermittlung von Medienkompetenz. Es herrscht ein breiter Konsens, dass dies eine zentrale Herausforderung für alle gesellschaftlichen Gruppen ist, die mit dem Thema Bildung befasst sind – mithin auch für Kirche.
Dies ist auch erkannt und in dem medienethischen Impulspapier „Virtualität und Inszenierung. Unterwegs in der digitalen Mediengesellschaft“ 21der Publizistischen Kommission der Deutschen Bischofskonferenz entsprechend formuliert worden: „Für eine gelingende Teilhabe und verantwortete Handlungsfähigkeit im medialen Raum, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt, muss vielmehr an dessen Bedürfnissen, Fähigkeiten und Lebenswelten Maß genommen werden.
Kommunikative Kompetenz ist einerseits Voraussetzung für Handeln in der Mediengesellschaft. Andererseits muss die Kompetenzvermittlung Ziel der Gesellschaft sein. Auf der Ebene der Darstellung (Performanz) geht es letztlich um die kompetente Beteiligung an sozialer Kommunikation, gerade mit und durch Medien. Das alltägliche Medienhandeln der Menschen stellt aus dieser Perspektive ein ebenso wichtiges Lernfeld für den Umgang mit Medien dar wie die gezielte und geplante Auseinandersetzung damit. Gewöhnlich wird Medienkompetenz (der bisweilen sehr unterschiedlich verstandene Begriff der Medienkompetenz umfasst ein ganzes Bündel von Kompetenzen …) als entscheidende Voraussetzung für die verstehende und aktive Teilhabe an der öffentlichen Kommunikation benannt.“ 22
Nimmt man den zitierten Ansatz an der Lebenswelt der Menschen sowie an deren subjektiven Bedürfnissen ernst, so wird z. B. angesichts der unterschiedlichen Milieus und der zwischen diesen bestehenden Abgrenzungen unmittelbar deutlich, dass dies keine triviale Aufgabe ist und dass es zwangsläufig sehr unterschiedliche Akzentsetzungen bei einer Definition von Medienkompetenz und deren pädagogischer Operationalisierung geben muss. 23Eine zeitgemäße Medien- und Kommunikationspädagogik wird daher die gesamte Bandbreite ästhetischer und technischer, analoger und digitaler Kommunikationsmedien in den Blick nehmen müssen und zu einer umfassenden Medienkompetenz-Vermittlung beitragen, die milieusensibel vorgeht und auf die Ermöglichung von Inklusion und Partizipation an kommunikativen Prozessen zielt.
Es ist letztlich das Grunddilemma des „in der Welt, aber nicht von der Welt“-Seins (Johannes 17,9–17): Die kirchlichen Grundvollzüge kommunizieren das Heil, das Gott uns verheißen hat und das in Jesus Christus schon unter uns Wirklichkeit wird. Aber eben diese Verkündigung geschieht in Kontexten und Strukturen, die klar kommerzieller Natur sind und als Systeme völlig andere Leitcodices haben.
6. Dabei stellt sich für Kirche ein weiteres Problem, das als Dilemma zwischen dem systemeigenen „ethischen Code“ und der im System der Kommunikationsmedien vorherrschenden Codes der Ökonomie bzw. Konsumorientierung beschrieben werden kann.
Es ist letztlich das Grunddilemma des „in der Welt, aber nicht von der Welt“-Seins (Johannes 17,9–17): Die kirchlichen Grundvollzüge kommunizieren das Heil, das Gott uns verheißen hat und das in Jesus Christus schon unter uns Wirklichkeit wird. Aber eben diese Verkündigung geschieht in Kontexten und Strukturen, die klar kommerzieller Natur sind und als Systeme völlig andere Leitcodices haben.
Dieses Dilemma wird sich dauerhaft nicht lösen lassen, da eine (bestenfalls hypothetisch mögliche) Abkehr von modernen Kommunikationsmedien gleichbedeutend mit einem Verschwinden aus der gesellschaftlichen Realität wäre 24. Das umgekehrte Extrem einer rein kirchlichen Kommunikationsstruktur – also einer Aufstellung mit Kommunikationsmedien rein in kirchlicher Trägerschaft – ist angesichts des Bedeutungsverlustes von Kirche in modernen Gesellschaften ebenfalls zum Scheitern verurteilt. Die Probleme, die das kirchliche Presse- und Verlagswesen in den letzten Jahren nahezu flächendeckend aufweist, sind ein deutlicher Indikator dafür. Für den Bereich der digitalen Medien verbieten sich solche Insellösungen schon von vornherein.
Hinsichtlich der eigenen publizistischen Tätigkeit wird Kirche daher im 21. Jahrhundert mehr denn je nach Zielgruppen und Milieus differenzierte Strategien erproben müssen, um dem ureigensten Auftrag des kommunikativen Handelns weiterhin gerecht werden zu können.
Auf das gesamte gesellschaftliche Handlungsfeld Kommunikation und Medien hin wird der schwierige Mittelweg darin bestehen, immer wieder kritische Zeitzeugenschaft auszuüben. Die jeweiligen Zeichen der Zeit müssen erkannt und aus der Eigengesetzlichkeit der Kommunikationsmedien heraus theologisch und ethisch gedeutet werden, um diese Deutungen in Diskurse mit Soziologie, Kommunikationswissenschaft und Pädagogik einzubringen. Die Ergebnisse solcher kritischen Diskurse sind dann wiederum jeweils auch auf das eigene kommunikative Handeln von Kirche zu befragen, um auch im 21. Jahrhundert mittels digitaler Kommunikationsmedien immer mehr das Bild der lebendigen communio zu verwirklichen.
Damit kann und soll der Wert der Begegnung in der direkten personalen Kommunikation nicht geschmälert werden. Sie wird in der Kirche und für die Kirche auch im 21. Jahrhundert eine hohe Bedeutung haben. Aber wenn Kirche an der Lebenswelt der Menschen orientiert kommunizieren will, wird diese direkte Kommunikation vielfältig durch digitale Medien ergänzt werden – zur Anbahnung, Durchführung und Aufrechterhaltung von Kommunikation. Wenn dabei nicht a priori Menschen aufgrund individueller und sozialer Merkmale ausgeschlossen werden sollen, muss die Frage der Zugangs- und Beteiligungsmöglichkeiten an veränderten Kommunikationsformen, die unter dem Stichwort „digital divide“ diskutiert wird 25, jeweils nochmals neu gestellt und beantwortet werden.
Literatur / Links
Baacke, Dieter: Kommunikation und Kompetenz. München 1973.
Luhmann, Niklas: Die Realität der Massenmedien. Opladen 2004.
Möller, Simon (2012): Vergesst das Recht auf Vergessenwerden.
Online unter: www.sinnstiftermag.de/ausgabe_11/titelstory.htm
www.dbk.de/fileadmin/redaktion/microsites/Mediensonntag/2009-botschaft_zum_43_welttag_der_soz_kommunikationsmittel.pdf; Original unter: www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/communications/documents/hf_ben-xvi_mes_20090124_43rd-world-communications-day_ge.html
Читать дальше