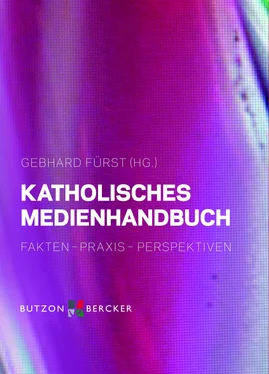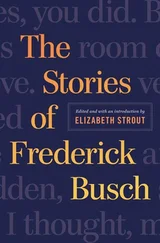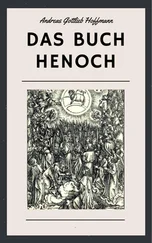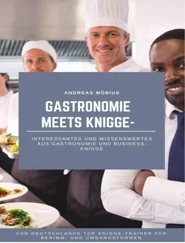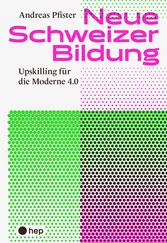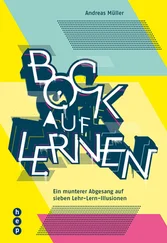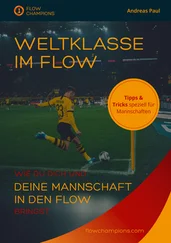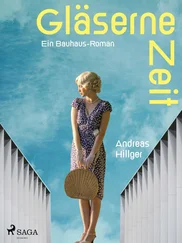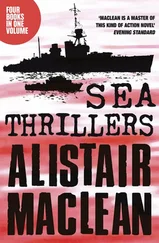In den hierzu anstehenden Versuchen wird die Rede von Gott durch das Zeugnis des Lebens in seinen ganzen Ambivalenzen ausgesprochen werden müssen. Es wird dann von Verheißung und Erfüllung, von Schuld und Vergebung die Rede sein müssen – Grundthemen, die den Menschen und sein Menschsein betreffen und demnach radikal durchs Leben führen. Die Grundfigur einer dieser Perspektive verpflichtenden Rede wird sich an der Frage orientieren, die Jesus dem blinden Bartimäus stellt: „Was soll ich für dich tun?“ (Markus 10,51). Sie hätte sich ihrem Selbstverständnis nach immer auch in ihrer sozialen Dimension zu bewähren: als das Sprechen von den Armen, den unheilbar Kranken, den Marginalisierten und den an ihren Hoffnungen Gescheiterten.
Somit nimmt die Rede von Gott für sich in Anspruch, eine Erneuerung der Menschheit und der damit einhergehenden „inneren Umwandlung der Menschen“ zu einer universalen Solidarität voranzutreiben, indem sie konkrete Hilfestellung anbietet, das „persönliche und kollektive Bewußtsein der Menschen, die Tätigkeit, in der sie sich engagieren, ihr konkretes Leben und jeweiliges Milieu umzuwandeln“ (Evangelii nuntiandi 18). Bezugsgröße dabei ist die – scheinbar aus dem theologischen Repertoire zunehmend herausfallende – Reich-Gottes-Vorstellung. Von hier aus bestimmt sich diese Rede als Prozess einer Vorwegnahme von Kirche, der durch die Durchdringung der Welt mit dem Evangelium reklamiert wird.
Die erhoffte Glaubwürdigkeit und Legitimität innerhalb der Mediengesellschaft wird sich jedoch nur in dem Maße einstellen, wie es dieser Rede gelingt, in ihrem Sprechen von Gott die eschatologische Zukunft vom Reich Gottes als Zukunft und Bestimmung der Menschen hier und heute glaubwürdig zu repräsentieren.
Dabei wird diese Rede in ständiger Bewegung der tastenden Annäherung sein, möchte sie nicht banal, trivial und damit als unmöglich erscheinen. Trifft sie doch letztlich auf ein disperses Publikum, das nie bejaht, ohne zu verneinen, und das nie verneint, ohne zu bejahen.
Literatur
Hober, David: Die Radiopredigt. Ein Beitrag zur Rundfunkhomiletik, Stuttgart 1996.
McLuhan, Marshall: Die magischen Kanäle. Frankfurt 1970.
85Höhn, Hans Joachim: Remedia? Phänomen und Kritik moderner Medienreligion. In: Garhammer, Erich/ Hober, David (Hgg.): Vom Non-Prophet-Unternehmen zu einer visionären Kirche. Verkündigung in der Mediengesellschaft. Würzburg 2002, S.64.
86Gabriel, Karl: Konzepte von Öffentlichkeit und ihre theologischen Konsequenzen. In: Arens, Edmund / Hoping, Helmut (Hgg.): Wieviel Theologie verträgt die Öffentlichkeit? Freiburg 2000, S. 23.
87Vgl. hierzu Knapp, Markus: Glauben und Wissen bei Jürgen Habermas. Religion in „postsäkularer Gesellschaft“. In: Stimmen der Zeit (4 / 2008), S. 270 –280.
88Vgl. McLuhan, Marshall: Die magischen Kanäle. Frankfurt 1970, S. 17–31.
89Vgl. Müller, Klaus: Mediale Verkündigung – möglich, wirklich, virtuell. In: Garhammer, Erich / Hober, David (Hgg.): Vom Non-Prophet-Unternehmen zu einer visionären Kirche. Verkündigung in der Mediengesellschaft. Würzburg 2002, S. 44f.
90Ebd., S.45.
91Ebd., S.47.
92Ebd.
93Vgl. hierzu: Hober, David: Die Radiopredigt. Ein Beitrag zur Rundfunkhomiletik, Stuttgart 1996.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.