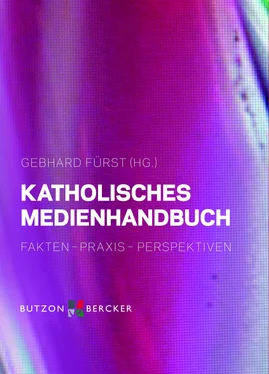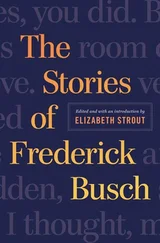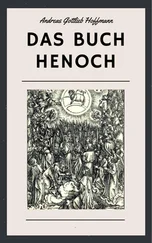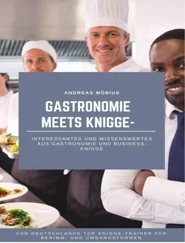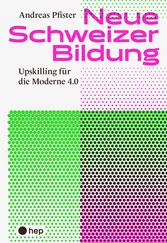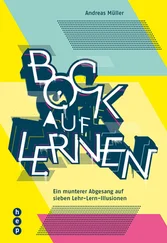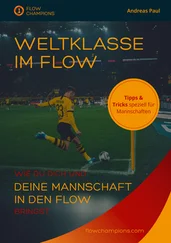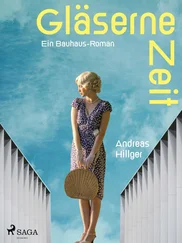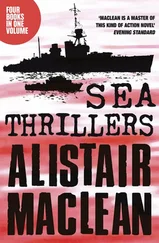Der Schöpfungsgedanke – so poetisch er auf den ersten Seiten der Bibel und in einigen Psalmen begegnen mag 62– ist ja systematisch gesehen ein relativ spätes Krisenprodukt, nämlich die Reaktion auf die Katastrophe des babylonischen Exils. Israel hatte Land und Zukunft verspielt und kann an seinem Gottvertrauen in der Fremde nur noch dadurch festhalten, dass es diesen Gott souveräner als alles andere denkt, als einen, der auch noch die mächtigen Gegner in seinen Händen hält und zu seinem Werkzeug macht. Das ist dann gewährleistet, wenn er über schlichtweg alles gebietet, vom Sandkorn bis zu den Gestirnen hinauf.
Der Schöpfungsgedanke entwächst einer „offensive[n] Über-bietungstheologie“ 63– und das ist insofern von höchster Brisanz, als schon innerbiblisch und dann erst recht in der theologischen Tradition dem Menschen eine Mitbeteiligung an Gottes Schöpfungshandeln zugeschrieben wird. Besonders markant geschieht dies etwa durch Nikolaus von Kues (1401–1464), wenn er den im Mittelalter Gott allein vorbehaltenen Titel „creator“ in der Zusammenstellung von „creator artium“ (Schöpfer der Künste) auch dem Menschen zuschreibt oder die Seele „notionalium creatrix“ (Schöpferin der Gedankendinge) nennt und schließlich vom Menschen als einem „secundus Deus“ sprechen kann, um seine schöpferische Berufung zum Ausdruck zu bringen. 64Und Pico della Mirandola (1463–1494) – eine Generation später – sieht die Würde des Menschen gerade darin begründet, dass Gott ihn nicht wie alles andere fertig schafft, sondern unterbestimmt ins Dasein setzt, damit er selbst sich in Freiheit zu seiner Vollgestalt – sei es nach unten, sei es nach oben – fortbestimme. 65
Dieser Titel – mittellateinischer Provenienz – ist seit Anbeginn selbst theologisch und liturgisch hoch aufgeladen: Es gibt Zeugnisse, nach denen in der Epoche der Gegenreformation im Streit um die Verehrung von Gnadenbildern die Präsenz Christi im eucharistischen Brot als „realiter“, die Gegenwart etwa der Gottesmutter in einem Gnadenbild als „in virtute“ bezeichnet wurde. Heute bezeichnet er dabei so etwas wie eine „quasi göttliche Macht, die Welt zu konstruieren“, die sich aus der dezidiert angestrebten Entdifferenzierung von Schein und Sein, Wirklichkeit und Fiktion speist.
Jedenfalls ist der Gedanke, dass an der erfahrenen Welt noch etwas zu machen, ja zu verbessern sei, theologisch nichts Fremdes. Dafür steht innerbiblisch bereits ja drastisch die Sintflutgeschichte. Und im 2., 3. nachchristlichen Jahrhundert meldet der Gedanke sich radikal und gebieterisch, die frühe kirchliche Überlieferung bedrängend, in den Bewegungen der Gnosis, für deren Mehrheit das Schöpfungswerk solcher Pfusch ist, dass man es einem anderen Gott als dem des Evangeliums anlasten müsse, und Letzterem komme die Aufgabe zu, da grundlegend nachzubessern. 66Eben dies aber ist ein Motiv, das sozusagen eins zu eins in die Cyberphilosophy eingeht. 67Einschlägige Konzeptionen übersetzen diese komplexe Schöpfungsmotivik zumeist sehr direkt in Optionen, die sie durch die Dimension der Virtualität eröffnet sehen.
Dieser Titel – mittellateinischer Provenienz 68– ist seit Anbeginn selbst theologisch und liturgisch hoch aufgeladen: Es gibt Zeugnisse, nach denen in der Epoche der Gegenreformation im Streit um die Verehrung von Gnadenbildern die Präsenz Christi im eucharistischen Brot als „realiter“, die Gegenwart etwa der Gottesmutter in einem Gnadenbild als „in virtute“ bezeichnet wurde. 69Heute bezeichnet er dabei so etwas wie eine „quasi göttliche Macht, die Welt zu konstruieren“ 70, die sich aus der dezidiert angestrebten Entdifferenzierung von Schein und Sein, Wirklichkeit und Fiktion speist. 71Diese Denkfigur, in durch nichts begrenzter Freiheit zu wissen, zu tun und zu sein, was immer sich der Geist vorstellen kann, hat dabei nicht nur ein Vorausbild in dem mittelalterlichen Theologumenon, dass Gott dadurch etwas erschaffe, dass er es erkenne. Weit dahinter zurück beziehen sich einschlägige Cyber-Autoren und -Kritiker höchst komplex auf diejenige biblische Erzähltradition, mit der die sogenannte Urgeschichte im Buch Genesis endet und die bereits innerbiblisch und dann in der theologischen Tradition exzessiv mit dem medialen Spitzenereignis des Neuen Testaments verknüpft ist. Es geht um den Weg von Babel nach Pfingsten.
Die Erzählung des Turmbaus von Babel bildet das so furiose wie desaströse Finale der ersten zwölf Kapitel der Bibel, die allem anderen, was noch kommt, vorgeschaltet sind: Anhebend mit der Erzählung vom Sündenfall in Genesis 3 kommt eine regelrechte Lawine des Unheils und des Bösen in Gang, von Kains Brudermord und den Gewaltexzessen in den nachfolgenden Generationen, die auch das Ritardando der Sintflut nicht aus der Welt zu schaffen vermag, bis hin zu jenem Entschluss der Menschheit, sich durch die Errichtung eines himmelragenden Bauwerks einen Namen – und also sich selbst zu etwas – zu machen. In der biblischen Tradition veranlasst die menschliche Selbstermächtigung zu gottgleichem Ineinsfall von Ersinnen und Ausführen den Schöpfer, die Sprache der Menschen zu verwirren (vgl. Genesis 11,7–9). Das cybertheoretische Selbstverständnis geht im Windschatten einer viel längeren okzidentalen Traumtradition vollkommener Kommunikation in die genau entgegengesetzte Richtung: Der babylonischen „Infokalypse“ 72im Sinn einer Explosion von Sprachen und Informationssystemen in eine reziproke Unbegreifbarkeit soll – wenigstens der Intention nach – mit dem Gegenprojekt widerstanden werden, durch die Verknüpfung aller mit allen und die Verbreitung eines für alle verständlichen Codes, der mehr mit Icons als mit Wörtern arbeitet, alle Kommunikationsbarrieren aufzuheben und so linguistisch gesehen in einen präbabylonischen, also adamitischen Status zurückzufinden.
Nicht wenigen Cybertheoretikern ist dabei klar, dass sie auch mit einer solchen Revision Babels nochmals ein jüdisch-christliches Grundmotiv aufnehmen. Schon Theologen in der Frühzeit der Kirche hatten vom Buch Genesis einen kühnen Bogen in die neutestamentliche Apostelgeschichte geschlagen und das dort erzählte Pfingstereignis als Anti-Typos – d. h. als Aufhebung und Heilung – des Kommunikationsdesasters von Babel gelesen. Genau diese Hoffnung, dass die ganze Menschheit einmal durch die elektronischen Medien verbunden werde und damit soziale Brüche und Spezialwissen (das immer auch Herrschaftswissen ist) verschwänden und letztendlich eine Himmlische Stadt, ein neues Jerusalem heraufziehe, hat schon der gern als Medienpapst titulierte Marshall McLuhan formuliert. 73
„Der Glaube an ein solches Pfingstfest der Vereinigung der Menschheit durch das Wegfallen aller Trennungen, in der Romantik noch von einer neuen Religion oder Mythologie, danach als Folge der gesellschaftlichen Revolution und der Auflösung des Eigentums an Produktionsmitteln erwartet, stellt sich für die Cyberkultur, kämpft man nur gegen etwaige staatliche oder kommerzielle Beeinflussungen, durch die Technik des anarchistischen, dezentralen Netzes von selbst her.“ 74
Allerdings ist mit dieser politischen Dimension die telematisch fundierte Technotheologie noch nicht ausgeschöpft. Sie hat nämlich so etwas wie eine kosmotheologisch-naturphilosophische Kehrseite höchster Brisanz. Die wird am direktesten darin greifbar, dass die Symbolik des Neuen Jerusalems – das ist ja eine Orts-Kategorie – zugleich als erstrangige Bedeutungsquelle für das wohl zentralste, in jedem Fall populärste Bild der Telematik fungiert: den Cyberspace. Ohne die explosive Mythologie 75dieses Konzepts an dieser Stelle auch nur im Elementaren ausloten zu können, soll nachfolgend lediglich der wohl frappierendste Zug von Technospiritualität am Cyberspace-Konzept beleuchtet werden, der die gesuchte naturphilosophische Dimension der Telematik grundlegt.
Читать дальше