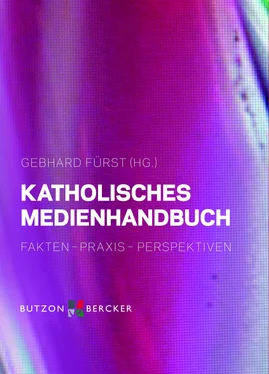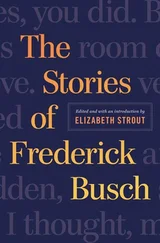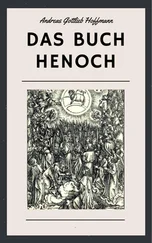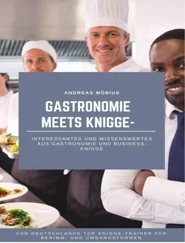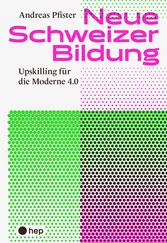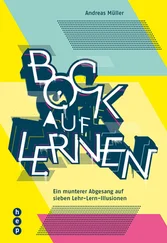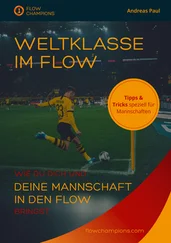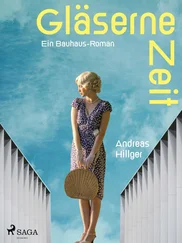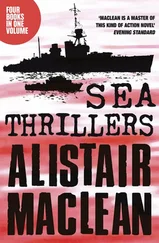2Zakon, Robert H.: Hobbes Internet Timeline, 10.2.2012.
3Vgl. Van Eimeren, Birgit / Frees, Beate: Drei von vier Deutschen im Netz – ein Ende des digitalen Grabens in Sicht? Ergebnisse der ARD/ZDF-Onlinestudie 2011. In: Media Perspektiven (7–8/2011), S. 334–349.
4Vgl. Ridder, Christa-Maria / Engel, Bernhard: Massenkommunikation 2010. Mediennutzung im Intermediavergleich. In: Media Perspektiven (11/2010), S. 523–536.
5Schmidt, Jan-Hinrik: Zum Strukturwandel von Kommunikation im Web 2.0. In: Sinnstiftermag (11/2011).
6Ebd.
7Ebd.
8Auf die umstrittene Forderung nach einem „Recht auf Vergessen“, das Anfang 2012 von der EU-Grundrechtekommissarin Viviane Reding gefordert wurde (vgl. ec.europa.eu/justice/data-protection/document/review2012/com_2012_11_de.pdf), kann hier ebenfalls nur verwiesen werden. Vgl. die differenzierende Kritik dazu von Simon Möller (2012): Vergesst das Recht auf Vergessenwerden. URL: www.telemedicus.info/article/2138-Vergesst-das-Recht-auf-Vergessenwerden.html.
9Vgl. Baacke, Dieter: Kommunikation und Kompetenz. München 1973
10Werbick, Jürgen: Art. „Kommunikation. II. Fundamentaltheologisch“. In: LThK³, S. 214f.
11Zerfass, Rolf: Art. „Kommunikation. IV. Praktisch-theologisch“. In: LThK³, S. 216f.
12Benedikt XVI.: Neue Technologien – neue Verbindungen. Für eine Kultur des Respekts, des Dialogs, der Freundschaft. Botschaft des Papstes zum 43. Welttag der Sozialen Kommunikationsmittel am 13.09.2009.
13Vgl. van Eimeren / Frees: (Anm. 2).
14Initiative D21: (N)Onliner Atlas 2011. Eine Topographie des digitalen Grabens durch Deutschland.
15Benedikt XVI.: (Anm. 11).
16Gehrke, Gernot: Digitale Teilung – Paradigmen und Herausforderungen. In: Gapski, Harald (Hg.): Jenseits der digitalen Spaltung. Gründe und Motive zur Nichtnutzung von Computer und Internet. München 2009, S. 74–80.
17Vgl. Gerhards, Maria / Mende, Annette: Offliner. Ab 60-jährige Frauen bilden die Kerngruppe. In: Media Perspektiven (7/2009), S. 368f. Der von Gehrke (Anm. 15), S. 78, in diesem Zusammenhang zitierte Vergleich mit dem „Mercedes-Problem“ – ich hätte gerne einen, kann mir aber keinen leisten – ist insofern irreführend, als dass es nicht um ein Luxusproblem, sondern um grundlegende Partizipationsmöglichkeiten geht. Um im Bild zu bleiben: Sich keinen Mercedes leisten zu können, ist zweifelsfrei kein Grund für entsprechende Förderprogramme. Aber sich in einer immer stärker auf individuelle Mobilität ausgerichteten Gesellschaft überhaupt kein Auto leisten zu können, ist u. U. ein massives soziales Problem, insofern davon neben Freizeitmöglichkeiten auch Zugänge zum Bildungs- und Arbeitsmarkt abhängen können. Gleiches gilt mittlerweile wohl auch für einen hinreichend leistungsfähigen Internetzugang.
18Vgl. Gehrke: (Anm. 15), S. 80.
19Initiative D21: (Anm. 13); vgl. Gerhards / Mende: (Anm. 16), S. 366.
20Vgl. van Eimeren / Frees: (Anm. 2), S. 335.
21Die Deutschen Bischöfe. Publizistische Kommission; 35: Virtualität und Inszenierung. Unterwegs in der digitalen Mediengesellschaft. Ein medienethisches Impulspapier, Bonn 2011.
22Ebd., S.59f.
23Vgl. dazu die breit aufgestellten Forderungen als Ergebnisse der Arbeitsgruppen im Rahmen des Medienpädagogischen Kongresses 2011 „Keine Bildung ohne Medien“, online unter: www.keine-bildung-ohne-medien.de/kongress-dokumentation/medienpaedagogischer-kongress-2011_ergebnisse-der-arbeitsgruppen.pdf.
24Vgl. Luhmann, Niklas: Die Realität der Massenmedien. Opladen 2004.
25Vgl. u. a. Büsch, Andreas: Medienerziehung 2.0. Neue Antworten auf neue Herausforderungen?
In: AmosInternational (3/2010), S. 24–27.
2. Religion, Kommunikation und Medien
Michael N. Ebertz, Professor an der Katholischen Hochschule Freiburg und Privatdozent an der Universität Konstanz
Kommunikation und Medialität gehören zur Religion, das ist „ihr Normalfall“ 26. Allerdings geht es bei der Thematisierung von medialer „Kommunikation“ im Zusammenhang mit Religion nicht um Banales, denn zum einen steht fest: „Nur als Kommunikation hat Religion ... eine gesellschaftliche Existenz. Was in den Köpfen der zahllosen Einzelmenschen stattfindet, könnte niemals zur Religion zusammenfinden – es sei denn durch Kommunikation.“ 27Dies gilt für die aktuelle Präsenz von Religion ebenso wie im Blick auf ihren jeweiligen Ursprung, ihre Tradierung und den in ihr gepflegten Dialog zwischen dem Göttlichen und Menschlichen, in monotheistischen Religionen also Gebet, Verehrung und Offenbarung als Selbstmitteilung Gottes. Darin gibt Gott aus der Sicht der Gläubigen den Menschen etwas zu verstehen, wie umgekehrt ihm – etwa im Lob-, Dank- oder Klagegebet – etwas zu verstehen gegeben wird. Und auch die missionarische Sendung, die zum Selbstverständnis vieler Religionen gehört, ist ohne Kommunikation nicht realisierbar.
Zum anderen hat religiöse Kommunikation ein „besonderes Verhältnis zur Wahrnehmung“ 28, geht es doch um Mitteilungen, Verstehen und Glauben von Unglaublichem („Gott ist Mensch geworden“) und von Sachverhalten, welche die Wahrnehmung übersteigen – „kein Auge hat es gesehen, kein Ohr gehört“. Gott ist empirisch nicht verfügbar und bedarf des – kommunikativen – „Amen“ – nicht nur in der Kirche.
Noch ein weiterer Aspekt zeigt die hohe Bedeutung des Zusammenhangs von Kommunikation und Religion. Wie ein Blick auf die Geschichte des Christentums zeigt, ist trotz oder sogar wegen dieses speziellen Verhältnisses der religiösen Kommunikation zur Wahrnehmung die Wahl des Kommunikationsmediums nicht gleichgültig, sondern hochgradig normativ besetzt und somit ein Konfliktthema.
—Welche Kommunikationsmittel (Tanz, Bild, Ritus, Schrift, Predigt) sind für die Gottesverehrung zugelassen und welche nicht?
—Mit welchen Kommunikationsmitteln ist die Treue zum Ursprung (Ritus oder Schrift oder Lebensnachahmung) zu sichern?
—Mit welchen Kommunikationsmitteln ist die religiöse Verbundenheit untereinander, also zwischen den „Gläubigen“, zu gewährleisten?
—Mit welchen Kommunikationsmitteln sind die religiösen Heilswahrheiten auszulegen, die Heilsmittel zu spenden und zu verkündigen?
In diesem Zusammenhang muss die Reformation in ihrer Eigenschaft als Kampf um das rechte Medium der Glaubenskommunikation 29als Medienrevolution gesehen werden, die schließlich – über die Druckerpresse – auch zu einer wachsenden Marktorientierung und Demokratisierung bzw. Popularisierung der Religion beigetragen hat 30. Damit wird auch Gott bzw. werden bestimmte Gottesbilder wählbar und abwählbar 31. Kaum weniger bedeutend ist deshalb die Frage, wer über die jeweiligen Kommunikationsmittel verfügen darf („Schriftgelehrte“) und wie die Bedingungen der religiösen Kommunikation beschaffen sind.
Kommunikationsbedingungen und -medien in der Geschichte des Christentums
Kann einer Religion jede Kommunikationsbedingung recht sein? Die Kommunikationsbedingungen und Kommunikationsmittel waren zu frühchristlichen Zeiten völlig andere als im Christentum der voll durchmedialisierten Gegenwartsgesellschaft. Seine Frühgeschichte war primär durch orale Kommunikation unter Anwesenden bestimmt. Predigend, bezeugend, bekennend und diskutierend kommunizierte Jesus, „der Aussteiger, der seinen Beruf aufgab und sich von der Verwandtschaft trennte“, in direkter Interaktion auch seine prophetisch-charismatische Kritik am Tempel und seinem Kultbetrieb, die „ihm am Ende das Leben gekostet hat“ 32.
Danach wurde der „Wortverkündiger“ 33selbst – vermittelt auch über eine mündlich und schriftlich tradierte Sammlung seiner Sprüche, die Logienquelle – zum „gepredigten Jesus“, also zum Kommunikationsobjekt in der frühchristlichen Bewegung. Nicht zuletzt zur kommunikativen Bestätigung der von ihr verkündigten „Unerhörtheiten“ (der Botschaft vom Mensch gewordenen, gekreuzigten und auferstandenen Gott), sondern auch zur Vernetzung der neu gegründeten, räumlich voneinander unabhängigen christlichen Gemeinden, bediente sie sich – unter Rückgriff auf die jüdische Praxis der sogenannten Synagogenbriefe, welche das jüdische Zentrum in Jerusalem mit den Diasporagemeinden kommunikativ überspannten – der Form des Briefes, der „als ein nachgehendes, bewegliches, die persönliche Anrede suchendes und so auch verbindliches Medium“ erscheint 34. Zusammen mit den Evangelien wurden 22 Briefe (einschließlich der Johannesapokalypse) nicht nur „zum Grundstock für die Schriftensammlung des Neuen Testaments“, sondern auch „prägend für die theologische Kommunikation“ 35des Christentums als „Buchreligion“. Briefe und Evangelien wurden aber auch Bestandteile ritueller Kommunikation 36, die allen Gläubigen ein Schema auferlegte, mit dem Ergebnis, dass Elemente des Ritus wie des Bildes die religiöse Kommunikation vervielfältigten und somit die mündliche und schriftliche Kommunikation ergänzten, diese schließlich aber auch überlagern und verdrängen konnten. Die Reformation schließlich kann als eine „Phase der Neuordnung und Hierarchisierung der religiösen Medienkonstellation“ 37betrachtet werden, die das Mediendreieck aus „Sprache“, „Bild“ und „Ritus“ zusammen mit dem Buchdruck zugunsten der Sprache, also der Bibel, des Katechismus und der diesen vorangestellten Predigt, umschichtete.
Читать дальше