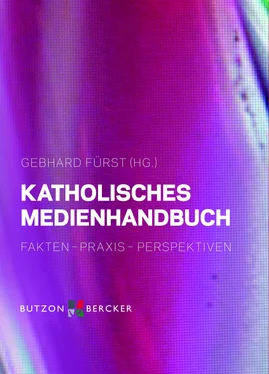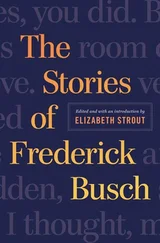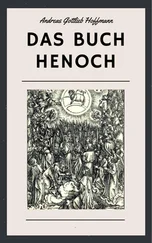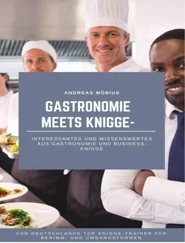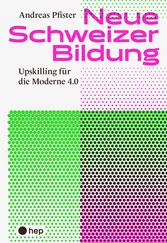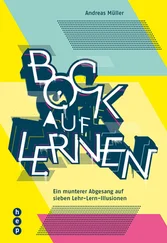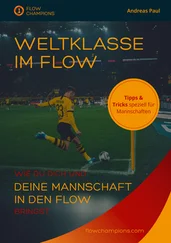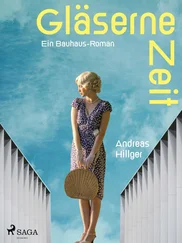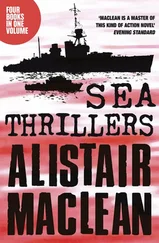Herausforderungen für Kirche als Kommunikationspartner
Die gerade aufgezeigten Trends lassen sich auch als Herausforderungen lesen – und zwar nicht nur für mediengestützte, sondern auch für die direkte Kommunikation, insofern Erstere immer prä
Diese Forderung nach kommunikativer Kompetenz lässt sich auch an die Kirche selbst adressieren: Unter welchen Bedingungen kann Kirche angesichts der oben skizzierten Entwicklungen kommunikationsfähig bleiben bzw. werden?
gend für Kommunikationsgewohnheiten ist, die auf Letztere „durchschlagen“. Dies zeigt sich in Wortneuschöpfungen wie googeln, skypen etc., die gleichzeitig die monopolistische Macht von Anbietern kennzeichnen. Dies zeigt sich aber auch ganz pragmatisch in der allgegenwärtigen Rede von der Notwendigkeit von Medienkompetenz, die eine Teilmenge der kommunikativen Kompetenz ist 9– jener Fähigkeit, die wir für eine Beteiligung am sozialen Leben brauchen.
Diese Forderung nach kommunikativer Kompetenz lässt sich auch an die Kirche selbst adressieren: Unter welchen Bedingungen kann Kirche angesichts der oben skizzierten Entwicklungen kommunikationsfähig bleiben bzw. werden?
Diese Frage ist alles andere als akzidentell, da die Kirche sich zuallererst einem Kommunikationsakt verdankt – letztlich der göttlichen Selbst-Mitteilung, die Ausfluss der innertrinitarischen communio und communicatio ist: „Gott erschließt sich kommunikativ, d. h. er teilt sich dem Menschen in einer Beziehung mit, die auf der Wechselseitigkeit von Wort und Antwort gründet, Partnerschaft ermöglicht und eine neue kommunikative Kultur begründet.“ 10Insofern die Kirche ihrerseits communio ist, „ergibt sich für die praktische Theologie die Aufgabe, einerseits die Kommunikationsdefizite aufzudecken, die das Leben der Kirche behindern, und andererseits die kommunikative Kompetenz aller Beteiligten zu steigern“ 11.
Insofern ließe sich folgern, dass Kirche als Institution durch den Übergang vom Gutenberg- zum Internetzeitalter und damit von der prinzipiell einseitigen zur prinzipiell dialogischen Kommunikation eine historische Chance hat, hinsichtlich ihres kommunikativen Vollzugs wirklich zu sich zu kommen und einen herrschaftsfreien Dialog zu führen. Damit könnte sie tatsächlich Wegbereiter „für eine Kultur des Respekts, des Dialogs und der Freundschaft“ 12werden.
Allerdings stehen einer linearen Umsetzung dieser Forderung diverse Dilemmata entgegen, deren Bewältigung seit einiger Zeit für entsprechende Diskussionen sorgt und die aller Voraussicht nach auch für die nächsten Jahre prägend bleiben werden:
1. Eine nach wie vor – angesichts der Sozialgeschichte der Medien richtiger: immer wieder – verbreitete kulturpessimistische Haltung sieht in digitaler Kommunikation in bester bewahrpädagogischer Tradition vor allem Bedrohung, Gefährdungspotenzial und einen „Verfall der Sitten“. Die möglicherweise dahinter stehende Angst vor Modernisierung ist insofern nachvollziehbar, als dass die zunehmende Komplexität auch von Kommunikationsmöglichkeiten und -kanälen von vielen Menschen als Bedrohung und Verlust von Beheimatung erlebt wird.
Dies ist als Ausdruck einer existierenden Wissenskluft zunächst einmal zu akzeptieren. Andernfalls wäre der Weg von einer Defizitorientierung zu einer Stigmatisierung derer vorgezeichnet, die eben nicht „aufgeschlossen“ oder „kompetent“ genug sind, alle modernen Kommunikationsmöglichkeiten zu nutzen oder deren Nutzung hinsichtlich möglicher Bildungs-, Informations- oder Unterhaltungsergebnisse defizitär ist.
2. Ein gleicher bzw. gleichberechtigter Zugang aller zu allen Medien wäre daher eine naheliegende Forderung – die Realität sieht aber nachweislich anders aus. Exemplarisch wurde dies in den letzten Jahren immer wieder am Thema „Internetzugang“ diskutiert: Zwar sind mittlerweile insgesamt rund 70 % aller Deutschen ab 14 Jahren „online“, aber das bedeutet zwangsläufig auch, dass knapp ein Drittel der Bevölkerung zu den sogenannten „Offlinern“ gehört. Und die Entwicklung der letzten Jahre deutet darauf hin, dass diese Situation sich auf hohem Niveau stabilisiert 13.
Insofern ließe sich folgern, dass Kirche als Institution durch den Übergang vom Gutenberg- zum Internetzeitalter und damit von der prinzipiell einseitigen zur prinzipiell dialogischen Kommunikation eine historische Chance hat, hinsichtlich ihres kommunikativen Vollzugs wirklich zu sich zu kommen und einen herrschaftsfreien Dialog zu führen. Damit könnte sie tatsächlich Wegbereiter „für eine Kultur des Respekts, des Dialogs und der Freundschaft“ werden.
Dies widerspricht natürlich dem bildungs- wie wirtschaftspolitisch motivierten Ideal einer komplett an die „Datenautobahn“ angeschlossenen Gesellschaft und deutet eher auf eine tiefgreifende Spaltung der Gesellschaft hin, die entsprechend als Digitale Spaltung („digital divide“) oder auch „digitaler Graben“ 14seit Jahren die Debatten beherrscht. Dieser Graben trennt diejenigen, die einen (Breitband-)Internetanschluss haben oder dessen Anschaffung in naher Zukunft planen, von denen, die aus unterschiedlichen Gründen „Offliner“ sind und auch nicht vorhaben, dies zu ändern.
Insofern ist eine erste Forderung, die Zugangsbarrieren abzubauen und möglichst allen Menschen Zugang zu neuen und neuesten digitalen Medien und deren Verbreitungsformen zu ermöglichen: „Man muss sich jedoch darum bemühen, sicherzustellen, dass die digitale Welt, in der diese Netze eingerichtet werden können, eine wirklich für alle zugängliche Welt ist. Es wäre ein schwerer Schaden für die Zukunft der Menschheit, wenn die neuen Instrumente der Kommunikation, die es möglich machen, Wissen und Informationen schneller und wirksamer zu teilen, nicht für jene zugänglich gemacht würden, die schon ökonomisch und sozial am Rande stehen, oder nur dazu beitrügen, die Kluft zu vergrößern, die die Armen von den neuen Netzen trennt, die sich im Dienst der Information und der menschlichen Sozialisierung gerade entwickeln.“ 15
3. Die Verhinderung oder Behebung von Exklusion ist aber sicherlich nicht auf das bloß quantitative Problem des Vorhandenseins bzw. der Nutzung von Kommunikationsmöglichkeiten beschränkt. Die praktische, da empirisch leicht handhabbare, im Übrigen aber schlichte Dichotomie „Onliner/Offliner“ (oder „user/loser“) verstellt vielmehr den Blick auf die Ursachen differenzierter gesellschaftlicher Lagen.
Gehrke weist zu Recht darauf hin, dass in den Debatten um die (Nicht-)Nutzung des Internets drei Paradigmen zu unterscheiden sind, deren Gewichtung erheblichen Einfluss auf die möglichen politischen und sozial-strukturellen Folgerungen hat. 16Die naheliegende Forderung des Abbaus von Zugangsbarrieren folgt dem Partizipationsparadigma: Wenn nur erst alle Zugang zum Internet haben, werden sich soziale Ungleichheiten nivellieren. Daher gibt es (bildungs-)politisch wie ökonomisch ein hohes Interesse daran, allen Bürgern eines Landes Zugang zur und damit Partizipation an der Informationsgesellschaft zu ermöglichen.
Ganz ähnlich argumentieren Vertreter des Innovationsparadigmas: Der fehlende Zugang vieler Bürger zum Internet behindert Innovationen, wirtschaftliches Wachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen. Konsequenterweise müssen dagegen staatliche Förderprogramme entwickelt werden, um die Akzeptanz zu erhöhen und wirtschaftlich relevante Kompetenzen der Nutzung zu fördern.
Von diesen beiden unterscheidet sich das Evolutionsparadigma insofern deutlich, als dass daraus eben keine zwingenden Handlungen gefolgert werden, sondern vielmehr im Vertrauen auf den Markt das Bestehen von Unterschieden in der Medien- und Techniknutzung als zwangsläufige und nicht notwendigerweise kritische Tatsache hinzunehmen ist. Denn wer keinen Internetzugang hat, braucht offensichtlich auch keinen und kann seine Informations- und Unterhaltungsbedürfnisse mit klassischen Medien stillen. 17
Читать дальше