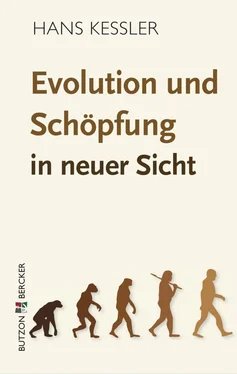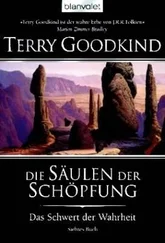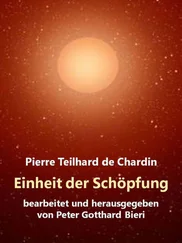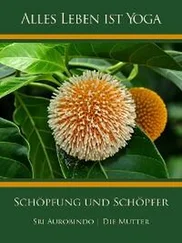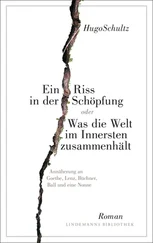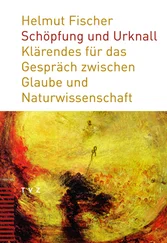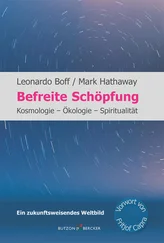Anders als Schönborn (in seinem Zeitungsartikel) hat übrigens dessen Lehrer Joseph Ratzinger schon 1969 das ureigene Recht der Naturwissenschaft und ihres methodischen Naturalismus anerkannt. Er hat geschrieben, „dass die Fragestellung des Evolutionsgedankens enger ist als diejenige des Schöpfungsglaubens. Keinesfalls kann also die Evolutionslehre den Schöpfungsglauben in sich einbauen. In diesem Sinn kann sie mit Recht die Idee der Schöpfung als für sich unbrauchbar bezeichnen: innerhalb des positiven Materials, auf dessen Bearbeitung sie von ihrer Methode her festgelegt ist, kann er (gemeint ist: der Schöpfungsgedanke) nicht vorkommen. Gleichzeitig muss sie die Frage offen lassen, ob nicht die weitere Problemstellung des Glaubens an sich berechtigt und möglich sei. Sie kann diese von einem bestimmten Wissenschaftsbegriff her allenfalls als außerwissenschaftlich ansehen, darf aber kein grundsätzliches Frageverbot erlassen, dass etwa der Mensch sich nicht der Frage des Seins als solchem zuwenden dürfe. Im Gegenteil: Solche Letztfragen werden für den Menschen, der selbst im Angesicht des Letzten existiert und nicht auf das wissenschaftlich Belegbare reduziert werden kann, immer unerlässlich sein.“ Und Ratzinger hat dann hinzugefügt, dass „der Schöpfungsgedanke als das Weitere seinerseits in seinem Raum den Evolutionsgedanken annehmen“ kann (Ratzinger 1969, 235 f).
2. Zur Antwort von Evolutionsbiologen und zur Offensive atheistischer Fanatiker
Der erwähnte Territorial-Anspruch der Kreationisten auf eine alternative und die allein richtige naturwissenschaftliche Naturerklärung empört und provoziert Naturwissenschaftler mit Recht. Zumal unter Biologen hat sich erheblicher, zum Teil erregter Widerstand formiert.
a) Sachliche Klarstellungen durch Evolutionsbiologen
Sachliche Klarstellungen zur Unwissenschaftlichkeit des Kreationismus stammen von bekannten Altmeistern der Evolutionstheorie: von Ernst Mayr († 2008), der übrigens sein Leben lang mit einem strahlenden Lächeln und in völliger Zufriedenheit seinen Zuhörern verkündete, dass sie nichts als ein Zufall seien; von Stephen Jay Gould († 2002), der, obwohl selbst Atheist, das darwinistische Evolutionsmodell so verstand, dass es sowohl mit Atheismus als auch mit religiösen Überzeugungen vereinbar ist (Gould 1992; Gould 2002). Und der dritte große Altmeister, mit Ernst Mayr zusammen Begründer der Synthese von Evolutionstheorie und Genetik, Theodosius Dobzhansky, hat schon 1973 in seinem bemerkenswerten Beitrag „Nothing in Biology Makes Sense Except in the Light of Evolution“ geschrieben: „Es ist falsch, wenn man Schöpfung und Evolution als sich gegenseitig ausschließende Alternativen versteht.“ Dobzhansky hat den Kreationisten ihre Selbstbezeichnung streitig gemacht und erklärt: „Ich bin Kreationist und Evolutionist. Die Evolution ist die Methode Gottes, oder der Natur, zur Schöpfung. Kreation ist kein Ereignis, das sich 4004 v. Chr. abgespielt hat. Es ist ein Prozess, der vor gut 10 Milliarden Jahren begann und immer noch fortdauert.“ (Dobzhansky 1973, 127)
In Deutschland tut sich in der Aufklärungsarbeit besonders die 2002 gegründete „Arbeitsgemeinschaft Evolutionsbiologie im Verband Biologie, Biowissenschaften & Biomedizin“ hervor. Ihrer Homepage zufolge will sie in Veröffentlichungen und Informationsmaterial „klar gegen evolutionskritische Lehren Position beziehen“ und Argumentationshilfen anbieten, „weshalb Schöpfungslehren keine wissenschaftlichen Alternativen zur Evolutionstheorie sein können“. Dagegen ist aus der Sicht eines vernünftigen christlichen Schöpfungsglaubens nichts einzuwenden.
b) Die Offensive szientistisch-naturalistischer Fundamentalisten
Vereinzelte lautstarke Biologen, die in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden, wie Richard Dawkins oder Ulrich Kutschera, gehen indes so weit, dass sie einem (letztlich wissenschaftsfeindlichen) religiösen Fundamentalismus einen (religionsfeindlichen) szientistischnaturalistischen Fundamentalismus entgegensetzen, der selbst Züge eines dogmatisch fixierten und unreflektierten Glaubens hat. Sie treten aggressiv auf mit dem Anspruch, man müsse Atheist sein, wenn man die Evolution und die Biologie ernst nehme (wobei nachzufragen ist, wie sie sich den Gott denken, den sie ablehnen; in der Karikatur, die sie zeichnen, würde kein einigermaßen gebildeter Christ Gott und den Schöpfungsglauben erkennen).
1) Der als Biologe und Genetiker anerkannte Richard Dawkins hatte sich schon in seinem Buch Das egoistische Gen bei seiner soziobiologischen Erklärung von Moral in Widersprüche verwickelt, indem er den Menschen als genetisch vollständig determiniert ausgab, ihn dann aber aufforderte, er solle die erkannten Pläne seiner egoistischen Gene „durchkreuzen“ oder „transzendieren“ (Dawkins 1978, 3), was ja doch ein gewisses Maß an Entscheidungsfreiheit und Wertmaßstäbe voraussetzt; das Gute (wenn sich etwa ein Mensch für fremde Menschen oder für andere Lebewesen einsetzt und dabei eigenen Schaden oder gar sein Leben riskiert, obwohl er oder seine „egoistischen Gene“ davon nichts haben und er auch kein Masochist ist) lässt sich rein soziobiologisch oder sonstwie naturalistisch nicht erklären (Knapp 1989; Heinrich 2001; Heinrich 2007). Sein weiteres bekanntes Buch Der blinde Uhrmacher (= die Evolution) (1987), in dem er mit Recht den Uhrmacher- und Lückenbüßergott demontierte, hatte Dawkins dann mit der reichlich naiven Bemerkung begonnen: „Dieses Buch ist in der Überzeugung geschrieben, dass unsere eigene Existenz früher einmal das größte aller Rätsel war, heute aber kein Geheimnis mehr darstellt, da das Rätsel gelöst ist.“ Dawkins erliegt hier schlicht dem genetic error , d. h. dem Irrtum, dass etwas in seinem Wesen (oder Geheimnis oder „Rätsel“, wie Dawkins sagt) erklärt und verstanden ist, wenn seine Genese, sein Entstehungszusammenhang erkannt wäre. Aber weiß man denn wirklich, was etwas ist, wenn man weiß, wie es zustande gekommen ist? Ist es nicht eher so, dass, je mehr und je gründlicher man von möglichst vielen Seiten über Leben, Mensch, Wirklichkeit nachdenkt, sie umso rätselhafter werden?
Dawkins’ jüngstes Buch Der Gotteswahn (2007) dokumentiert nun vollends, dass sein Autor „eine Verwandlung durchgemacht“ hat von einem leidenschaftlich um Objektivität bemühten Wissenschaftler zu einem „antireligiösen Propagandisten, der die Fakten außer Acht lässt“: So schreibt sein Oxforder Kollege, der Molekularbiologe und Theologe, Alister McGrath (der selbst überzeugter Atheist war, ehe er Christ und Theologe wurde) in seinem Buch Der Atheismuswahn (2007; 32008, 62), das eine kompetente, ruhig und sachlich argumentierende Antwort auf Dawkins bietet.
Der Gotteswahn ist eine eifernde Generalattacke gegen alle Religion, speziell gegen Bibel und christlichen Glauben, die, wie McGrath nachweist, geschickt mit Tatsachenverdrehungen und z. T. aberwitzigen Falschdarstellungen arbeitet, was bei einem Zielpublikum, das wenig über Religion weiß, durchaus funktioniert. Dawkins geht es nur darum, Konvertiten für den Atheismus zu gewinnen. Für dieses Ziel ist er bereit, die Standards wissenschaftlicher Sorgfalt über Bord zu werfen. 4Statt Quellen oder kompetente Darstellungen zu befragen, setzt er alles daran, die Religion im schlechtest-möglichen Licht erscheinen zu lassen: nämlich als kindisch, dumm, gewalttätig, kriminell (als ob es, wenn Religion verschwinde, keine Gewalttätigkeit mehr gäbe, oder als ob es sie im Atheismus unter Stalin, Hitler, Pol Pot nie gegeben habe). Er versteigt sich gar dazu, in drastischen Worten die staatliche Autorität aufzurufen, religiöse Erziehung ebenso als Straftat zu behandeln wie körperliche Kindesmisshandlung (in einer Dawkins-Gesellschaft fänden sich viele religiöse Menschen im Gefängnis wieder); religionsfeindliche Erziehung hingegen soll offenbar kein Kindesmissbrauch sein. Dawkins vertritt einen totalitären Atheismus, der in der Welt nur das duldet, was er erlaubt hat. Wahre Naturwissenschaftler müssten grundsätzlich Atheisten sein; wenn sie hingegen religiöse Überzeugungen bekennen (oder solche – wie der Atheist Gould – für mit Naturwissenschaft gleichermaßen vereinbar erklären), könnten sie das nicht ernst meinen. Wenn andererseits der Papst oder irgendein Christ die Evolution anerkenne, sei er „ein Heuchler, der es mit der Wissenschaft nicht ehrlich meine“ (so Dawkins, zit. nach McGrath 40 und 62).
Читать дальше