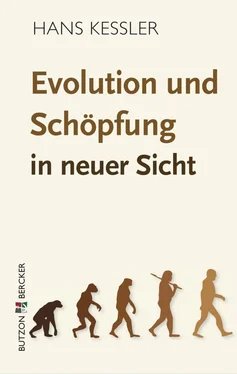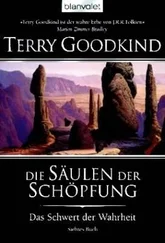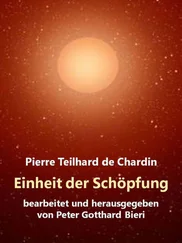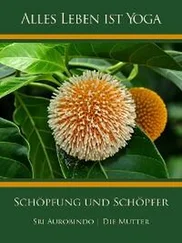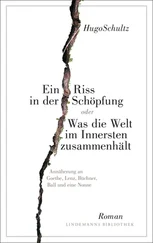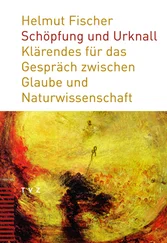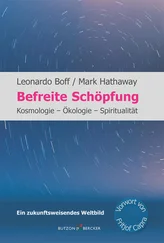Diese juristischen Niederlagen führten zu einem erneuten Strategiewechsel seitens der Kreationisten. Seit etwa 1992 vertreten sie die Lehre vom Intelligent Design (abgekürzt: ID): Man könne in der Natur mit empirisch-naturwissenschaftlichen Mitteln Signale von Design (Absicht, Plan) feststellen, welche dazu zwingen , einen Designer (Planer) anzunehmen. Wohlgemerkt: Der springende Punkt dieser Lehre ist, die Naturwissenschaft selbst müsse einen intelligenten Designer annehmen. Die Lebewesen seien bis in ihre molekularen Bestandteile hinein irreduzibel komplex und könnten nicht per Zufall entstanden sein; die Entstehung unseres Kosmos und der Vielfalt der Arten könne nicht durch einen ungerichteten Evolutionsprozess, sondern nur durch eine intelligente Ursache erklärt werden.
Der amerikanische Biochemiker und ID-Vertreter Michael Behe bringt etwa das Beispiel einer Mausefalle, bei der keiner der fünf Teile (Holzbrett, Feder, Haltebügel, Schlagbügel, Köderhalter) fehlen dürfe, damit sie ihren Zweck erfüllt, eine stufenweise Entwicklung zur funktionsfähigen Falle sei damit ausgeschlossen. Entsprechend erfülle auch die wie ein Propeller rotierende Bakteriengeißel, mit der das Bakterium sich fortbewegen kann und deren Motor – für ein so primitives Lebewesen – ganz erstaunlich komplex (und raffiniert konstruiert) ist, ihren Zweck nur in der kompletten Zusammenstellung all ihrer Teile, sie könne darum nicht stufenweise entstanden, sondern müsse das Ergebnis einer intelligenten Planung sein (Behe 1996). 3
„Where there is design, there must be a designer“: So wird mit dem alten Design-Argument etwa des englischen Physikotheologen William Paley (1745 – 1805) gesagt. Paley brachte in seinem Buch Natural Theology (1802), zu Darwins Studienzeit Pflichtlektüre, das berühmte Beispiel: Wenn man am Strand eine Uhr liegen sehe, müsse man zwangsläufig auf die Existenz eines Uhrmachers schließen (eine Uhr sei zu komplex, um durch Zufall entstanden zu sein); entsprechend ließen die äußerst komplex koordinierten Strukturen von Lebewesen auf die Existenz eines planvoll vorgehenden Schöpfer-Gottes schließen.
So weit gehen die heutigen Vertreter der Intelligent-Design-Theorie freilich nicht. Sie schließen nur auf einen intelligenten Designer (Planer, Entwerfer), „Gott“ wird nicht erwähnt. Auch der Bezug zur Bibel wird vordergründig aufgegeben; bibelbezogene Gedankengänge treten in den Hintergrund, ohne aber die Funktion als Leitideen zu verlieren.
Die ID-Theoretiker betonen, dass sie die Evolutionstheorie aus naturwissenschaftlichen Gründen kritisieren. Es gebe Phänomene in der Natur, die sich nicht mit Verweis auf zufällige, ungerichtete Mutationen und natürliche Selektion erklären lassen. Charles Darwin hatte ja selbst im sechsten Kapitel („Schwierigkeiten der Theorie“) seines Werkes On the Origin of Species formuliert: „Wenn gezeigt werden könnte, dass irgendein komplexes (zusammengesetztes) Organ existiert, das auf keine Weise durch zahlreiche, aufeinander folgende geringfügige Modifizierungen entstanden sein kann, dann würde meine Theorie ganz und gar zusammenbrechen. Ich vermag jedoch keinen solchen Fall aufzufinden.“ (Darwin 1859/2008, 224)
Die ID-Theoretiker wollen den empirischen Gegenbeweis antreten. So versuchen sie Schwachstellen des Darwinismus aufzuspüren und kritisieren gängige evolutionsbiologische Erklärungen komplexer organismischer Phänomene. Dabei gehen sie mit folgender Strategie vor: 1. Nachweis hoch komplexer Zweckmäßigkeit in Zellen, Organen oder Organismen (sign detecting); 2. Ausschluss aller in Frage kommenden bekannten Ursachen wie Zufall, stufenweise Entstehung usw. (argumentum ad ignorantiam); 3. Weil zweckmäßiges Design immer einen Designer/Hersteller voraussetzt, muss es einen solchen auch in der Natur geben (Analogieschluss vom Artefakt auf die Natur).
Aber ist dieser Analogieschluss zwingend? Er nimmt ja den fundamentalen Unterschied zwischen Technik und Natur nicht ernst. Kunstdinge nämlich können sich nicht selbst zweckmäßig gestalten, sie erfordern immer einen Hersteller, Naturdinge aber haben die Fähigkeit, sich selbst zweckmäßig zu gestalten. Wie das zu denken ist, wäre philosophisch weiter zu klären (s. u. V. 2. c).
c) Kreationismus im deutschen Sprachraum
Im Vergleich zu den USA hat der christliche Fundamentalismus in Deutschland nur wenige Anhänger, was sich nicht zuletzt der beinahe flächendeckenden Präsenz eines problemorientierten und reflexionsfreundlichen Religionsunterrichts verdankt, der den Schülern zu einem selbstständigen Umgang mit der eigenen religiösen Tradition sowie zur Kenntnis anderer Religionen und Weltanschauungen verhilft.
1) Kreationistisches Gedankengut gewinnt in evangelikal-biblizistischen Kreisen Einfluss, seit 1979 die Studiengemeinschaft Wort und Wissen e. V. gegründet wurde, ein durch Spenden finanziertes „Glaubenswerk“, dessen Mitglieder meist Junge-Erde-Kreationisten sind und das zahlreiche Materialien für Schüler herausgibt. Zu diesen gehört auch das als Schulbuch für die gymnasiale Oberstufe gedachte evolutionskritische Buch von Reinhard Junker (Geschäftsführer dieser Studiengemeinschaft) und Siegfried Scherer (Ernährungswissenschaftler an der TU München) „Evolution. Ein kritisches Lehrbuch“ (Gießen 1998, 62006), das ID-Argumente bietet, das jedoch in keinem Bundesland für die Verwendung an Schulen zugelassen ist.
Interessanterweise hat Scherer sich jüngst im Internet zurückhaltender geäußert: Er halte die ID-Theorie nicht für eine wissenschaftliche Theorie, sondern für eine Motivation zu weiterer naturwissenschaftlicher Forschung, da Kernprobleme der Evolutionstheorie bisher nicht gelöst seien. Da scheint sich etwas zu bewegen.
2) Im katholischen Raum konnten kreationistische Gedanken bislang kaum Fuß fassen. Doch haben Äußerungen des Wiener Kardinals Christoph Schönborn in einem Zeitungsartikel „Finding Design in Nature“ in der New York Times vom 7. Juli 2005 (sowie in anschließenden Interviews) großes Aufsehen erregt und zugleich erheblich irritiert, weil er sich dabei auf die Seite der ID-Vertreter begab und dabei auch noch so tat, als spreche er für „die katholische Kirche“. Auch wenn Schönborn in weiten Kreisen der katholischen Kirche Protest und Ablehnung erfuhr, war die Wirkung dieses Artikels für das Ansehen der katholischen Kirche in den Augen vieler Naturwissenschaftler verheerend. Anstoß erregen und Widerspruch erfahren muss zumal die folgende Behauptung Schönborns:
„Die Evolution im Sinn einer gemeinsamen Abstammung (aller Lebewesen) kann wahr sein, aber die Evolution im neodarwinistischen Sinn – ein zielloser, ungeplanter Vorgang zufälliger Veränderung und natürlicher Selektion – ist es nicht. Jedes Denksystem, das die überwältigende Evidenz für einen Plan in der Biologie leugnet oder wegzuerklären versucht, ist Ideologie, nicht Wissenschaft.“
Hier muss man zurückfragen: Wie kann die Kirche bzw. irgendein hoher Kirchenbeamter darüber befinden, ob eine naturwissenschaftliche Theorie „wahr“ (besser: richtig) oder falsch ist? Die Frage der Richtigkeit und Geltung der Evolutionstheorie kann doch nur im rationalen Diskurs mit Argumenten der Vernunft entschieden werden, nicht aber autoritativ durch einen kirchlichen Würdenträger. Und ob es „ in der Biologie eine überwältigende Evidenz für einen Plan“ geben kann, ist in höchstem Maße fraglich.
Mittlerweile hat Kardinal Schönborn seine Vorstellungen über „Ziel oder Zufall?“ ausführlicher dargelegt (Schönborn 2007; Schönborn 2008). Dabei zeigt er sich nicht nur über den Stand der evolutionsbiologischen Erkenntnisse schlecht informiert, sondern erliegt auch Kurzschlüssen wie dem, die Evolutionstheorie sei eine besonders angreifbare und zweifelhafte Theorie. Darauf werden wir (in I. 3 und in V. 2. c) zurückkommen. Eine wichtige Frage wird sein, ob ungerichteter Zufall und Zielgerichtetheit sich ausschließende Alternativen sein müssen („Ziel oder Zufall“) oder ob sie auch ineinander liegen und zusammenspielen können (Zielgerichtetheit in Zufallsereignissen).
Читать дальше