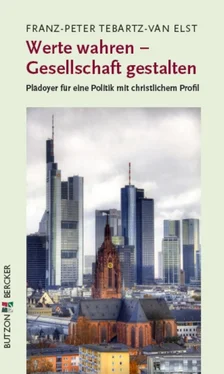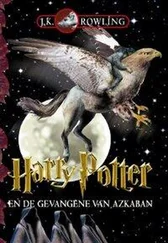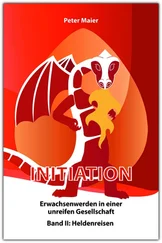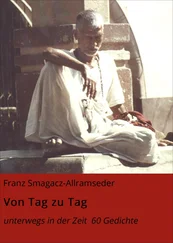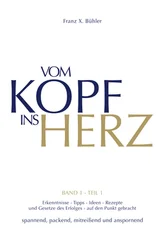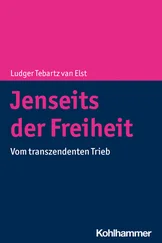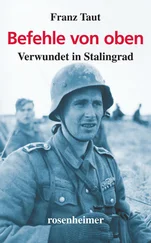4. Schöpfung und Verantwortung
Der Mensch steht in vielfältigen Bezügen. Er ist zuerst einmal Geschöpf, er verdankt sich nicht seiner eigenen Anstrengung oder seinem Wollen. Er ist ein Teil der Schöpfung. Seinem ,Vorzug' und seiner besonderen ,Funktion' innerhalb des Schöpfungsaktes Gottes auf der einen Seite entspricht auf der anderen Seite auch eine besondere Verantwortung für das Werk Gottes. Mensch und Schöpfung, so hält es uns das christliche Menschenbild vor Augen, stehen in einer unmittelbaren Beziehung zueinander. Die Schöpfung bildet den ,Möglichkeitsrahmen' für die Entfaltung dessen, was in jedem Menschen individuell, als Gabe des Schöpfers, angelegt ist. Die daraus resultierende Haltung bringt Papst Benedikt XVI. In seiner Enzyklika „Caritas in veritate“ treffend zum Ausdruck:
„Der Umgang mit [der Schöpfung] stellt für uns eine Verantwortung gegenüber den Armen, den künftigen Generationen und der ganzen Menschheit dar. Wenn die Natur und allen voran der Mensch als Frucht des Zufalls oder des Evolutionsdeterminismus angesehen werden, wird das Verantwortungsbewusstsein in den Gewissen schwächer. Der Gläubige erkennt hingegen in der Natur das wunderbare Werk des Schöpferischen Eingreifens Gottes, das der Mensch verantwortlich gebrauchen darf, um in Achtung vor der inneren Ausgewogenheit der Schöpfung selbst seine berechtigten materiellen und geistigen Bedürfnisse zu befriedigen. Wenn diese Auffassung schwindet, wird am Ende der Mensch die Natur entweder als ein unantastbares Tabu betrachten oder, im Gegenteil, sie ausbeuten. Beide Haltungen entsprechen nicht der christlichen Anschauung der Natur, die Frucht der Schöpfung Gottes ist.“ 9
In diesem Sinn wird es einem, vom christlichen Menschenbild getragenen Gemeinwesen, immer darum gehen müssen, sich an einen nachhaltigen Umgang mit den Ressourcen der Schöpfung zu orientieren.Raubbau und Ausbeutung,die in unseren Tagen oftmals zu Lasten der (wirtschaftlich) schwächeren Länder gehen, Klimakatastrophe und der Hunger in der Welt brauchen eine Haltung und Handlungsoption, die sich dem christlichen Menschenbild verpflichtet wissen. Hier liegt das Korrektiv einer Politik, die eine vom Glauben geprägte Umkehrbereitschaft voraussetzt. (Vgl. dazu Kapitel 6/II.)
III.Worte wählen
In der Bundesrepublik Deutschland gebührt der Grundhaltung des christlichen Menschenbildes, besonders der einmaligen Würde jeder Person und deren uneingeschränktem Recht auf Unversehrtheit, auch aus historischer Perspektive ganz besondere Achtung. Nach dem wohl dunkelsten Kapitel unserer Geschichte, nach Krieg und Zerstörung, bezogen sich die Väter und Mütter des Grundgesetzes ganz bewusst auf das Fundament des christlichen Menschenbildes. Unter den ,Trümmern des Krieges', so könnte man sagen, bargen sie das Fundament des christlichen Glaubens, den sie als leitenden Gottesbezug ausdrücklich in die Präambel aufgenommen haben. Die Geschichte hatte gezeigt, dass der Staat allein keinen ausreichenden Bezugsrahmen für das Zusammenleben und Zusammenwollen von Menschen bereitzustellen vermag. Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott bekennt das Deutsche Volk deshalb in Artikel 1 GG: „Die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu achten und zu schützen ist die Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“
Im Unterschied zu Verfassungen anderer Länder, wie z.B. Frankreich oder den USA, die aus ihrer jeweiligen Geschichte heraus den Freiheitsgedanken besonders hervorheben, betont das Grundgesetz zuerst die Unantastbarkeit der Würde jedes Menschen. Diese Würde entspringt zutiefst dem christlichen Bild vom Menschen.Zu diesem eher allgemeinen und,wenn man so will, zurückhaltend formulierten Gottesbezug hält Bundesverfassungsrichter Udo Di Fabio fest: „Das kann der Gott der Gl äubigen sein, und ich glaube sogar, das kann der Gott der Atheisten sein. Denn auch für den Atheisten wird damit nichts anderes gesagt, als dass es eine andere Dimension der Einsicht geben kann, die nicht im praktischen oder theoretischen Diskurs betretbar ist. Es geht also um die Möglichkeit der Transzendenz, die man auch einräumen kann, wenn man nicht an Gott glaubt.“ 10
In seinem viel beachteten Essay „Ein Bewusstsein von dem, was fehlt“ beschäftigt sich Jürgen Habermas mit eben diesem Zusammenhang. Er sieht die (praktische) Vernunft als das Vermögen, welches menschliches Leben auf seinen letzten Horizont hin orientieren will. Dieses Bewusstsein, ja die Fähigkeit des Ausgreifens in das Unbedingte, fehle dem Menschen in der nach Habermas ,postsäkularen Gesellschaft'. Es mangele an Solidarität und an der Bereitschaft, solidarisch zu sein. Es fehle an Riten, vor allem an den Grenzen und Übergängen des Lebens. „Gleichwohl“ , so schreibt Habermas, „verfehlt die praktische Vernunft ihre Bestimmung, wenn sie nicht mehr die Kraft hat, in profanen Gemütern ein Bewusstsein für die weltweit verletzte Solidarität, ein Bewusstsein von dem, was fehlt, von dem, was zum Himmel schreit, zu wecken und wachzuhalten.“ 11Es fehle das feste Wissen, dass das politische Gemeinwesen von belastbaren Überzeugungen getragen ist, es fehle ausdrücklich auch an „religiös begründeten Stellungnahmen in der politischen Öffentlichkeit.“ (Vgl. dazu Kapite l4/I. – III.)
Deutlich spricht aus dieser Einschätzung das Bewusstsein, dass es den Menschen in unserer Gesellschaft zunehmend schwerfällt zu erkennen, dass es nicht nur um Diesseitigkeiten geht. Unser Handeln und Sollen ist bezogen auf etwas – das Hier und Jetzt Überschreitende. Es fehlt an Transzendenz.
1. Erinnerung als Mahnung 12
Ein Bild macht mich nachdenklich. Es hängt in einem Tagungshaus und ist wie die Reliquie eines Ereignisses, das nie vergessen werden darf, damit es sich nie wiederholt. Das Bild zeigt einen kleinen Teil aus einer größeren Thorarolle, die beim schrecklichen Terror der Reichspogromnacht 1938 zerstört wurde. Nach der Verwüstung der Synagoge in einer deutschen Stadt hat damals ein 17-jähriger Jugendlicher im Respekt vor der Buchrolle, die den Juden heilig ist, diese beschädigten Ausschnitte von der Straße aufgenommen und aufbewahrt. Als Christ verspürte er Ehrfurcht und Anteilnahme.
Diese Thorareste enthalten Worte des Alten Testamentes aus den ersten fünf Büchern der Bibel. Beim Gottesdienst in der jüdischen Synagoge wird die Thorarolle aus dem Schrein genommen und geöffnet, um daraus Gottes Wort zu verkünden. Die Ausschnitte, die wie Buchseiten hinter dem Glasrahmen des Bildes zu sehen sind, zeigen deutliche Spuren von Zerstörung. Der Text ist nur schwer zu entziffern.Und doch spricht aus dieser Schrift laute Mahnung. Bevor man überhaupt ein Wort identifiziert hat, begreift man:Wo Menschen so brutale Gewalt angetan wird, wie es vor über 70 Jahren in der Reichspogromnacht geschehen ist, wird sie auch Gott angetan. Wo Gottes Wort mit Füßen getreten wird, wie die braunen Barbaren es vor 70 Jahren getan haben, hat der Mensch entsetzlich zu leiden. Der Blick auf diese Reliquie der Thora macht bewusst, was am Ende dieser Schriftrolle aus dem Mund des Mose im Buch Deuteronomium des Alten Testamentes zu lesen ist: „Heute beschwöre ich euch: Verpflichtet eure Kinder, dass auch sie auf alle Bestimmungen dieser Weisung achten und sie halten. Das ist kein leeres Wort, das ohne Bedeutung für euch w äre, sondern es ist euer Leben“ (Dtn 32,46–47).
Wo Menschen den Respekt vor Gott verlieren, geht auch die Achtung voreinander verloren. Für immer müssen die schrecklichen Ereignisse der Reichspogromnacht zur Mahnung dafür werden, dass wir nicht wegschauen dürfen. Was damals geschehen ist, darf nie vergessen werden. Wir müssen es auch als Christen immer wieder ansprechen, denn mit einer Stummheit vor der Geschichte wächst eine Gleichgültigkeit im Alltag, mit der eine Gottvergessenheit einhergeht, aus der am Ende brutale Menschenverachtung wird. Der Theologe Johann Baptist Metz hat gerade im Blick auf die Gräueltaten, die die Nationalsozialisten dem jüdischen Volk angetan haben, von der Notwendigkeit einer „gef ä hrlichen Erinnerung“ 13gesprochen.
Читать дальше