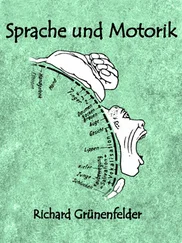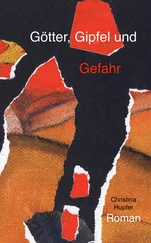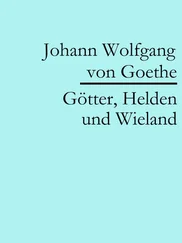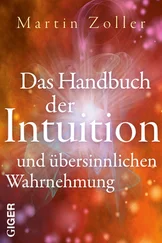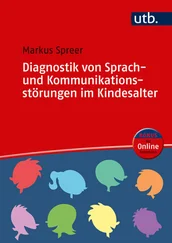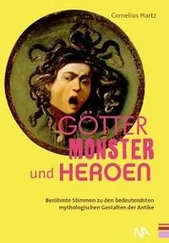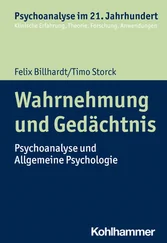Vaupel, P. & Schaible, H.-G. (2015). Anatomie, Physiologie, Pathophysiologie des Menschen. Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft.
3 Die Entwicklung der Körpermotorik
3.1 Motorische Entwicklung im 1. Lebensjahr
Die motorische Entwicklung von Kindern weist eine hohe Variabilität auf, nicht nur inter-, sondern auch intraindividuell. In erster Linie hängt dies wohl von unterschiedlichen, genetisch bedingten Veranlagungen und unterschiedlicher Reifung der Kinder ab. Bei vielen Kindern verläuft die motorische Entwicklung diskontinuierlich: Sie ist oft von scheinbaren Pausen, von Schüben oder Sprüngen gekennzeichnet. Die Reifung der Nervenbahnen verläuft von zentral nach peripher. Das erklärt, warum rumpf- und kopfnahe Muskelgruppen frühzeitiger zu komplexen Bewegungsmustern in der Lage sind als periphere. Dieses Reifungsphänomen wird uns später bei der Entwicklung der Handmotorik noch einmal begegnen. Zudem spielen Umgebungsbedingungen, fördernde wie hemmende, eine große Rolle. So ist das »Auslassen« oder »Verspätet-Kommen« von motorischen Entwicklungsschritten möglicherweise eine Entwicklungsbesonderheit oder ein Anzeichen für eine Entwicklungsstörung. Eine Klärung kann durch eine detaillierte Verlaufsbeobachtung und eine fachärztliche Untersuchung herbeigeführt werden. Aus diesen Gründen sind die nachfolgenden Altersangaben nicht als eine starre Grenze zu betrachten. Vielmehr sollen die Zeitangaben eine Orientierung geben.
Die Entwicklung der Motorik läuft also keineswegs für alle Kinder nach einem einzigen »Fahrplan« ab. Etwa 10–15 % aller Kinder lassen gewisse Stadien der Entwicklung aus, holen sie später nach, oder diese Stadien erfolgen nicht in gleicher Reihenfolge. Es gibt durchaus Kinder, die zum Stehen und Gehen kommen, ohne vorher gerobbt oder gekrabbelt zu haben. Einige ziehen es vor, auf dem Hosenboden vorwärts zu rutschen (shuffling), andere bewegen sich durch Rollen oder Kreisrutschen vorwärts. Möglicherweise zeigen sich hier verschiedene Ausprägungen einer genetischen Veranlagung. Diese Kinder sollten kinderärztlich gut untersucht werden, aber keineswegs brauchen sie immer eine physiotherapeutische Behandlung oder stellen eine Risikogruppe für spätere Störungen der Lernfähigkeit dar.
Hinzu kommt, dass manche Kinder ängstlich oder vorsichtig sind, wenn sie das Hinstellen oder Laufen lernen. Sie setzen sich lieber langsam auf den Po, als einen Sturz zu riskieren. Andere sind besonders mutig und stürzen sich geradewegs in gefährliche Situationen. Schließlich gibt es auch jene Kinder, die sich lieber für Spiele oder Bilderbücher interessieren, als ihre motorischen Fähigkeiten zu üben. Unterschiede also, die es auch bei Erwachsenen gibt und die nicht unbedingt Anlass zu Sorge sein müssen. Die individuellen Unterschiede in der motorischen Entwicklung werden durch die interindividuelle Variabilität deutlich: So erlernen Kinder das Hinsetzen mit 9–14 Monaten, das Entlanggehen an Möbeln mit 8–14 Monaten und das freie Gehen mit 10–18 Monaten.
Den folgenden Altersangaben liegt das Konzept der Grenzsteine und Meilensteine (Michaelis und Niemann, 2010; Nennstiel-Ratzel, Lüders, Arenz, Wildner & Michaelis, 2013) zugrunde. Beim Konzept der »Grenzsteine« wird davon ausgegangen, dass die Entwicklung aller Kinder regelhaft und determiniert verläuft und Zeitpunkte definiert werden können, an denen 90–95 % aller Kinder einen bestimmten Entwicklungsschritt sicher erreicht haben. Bei Nicht-Erreichen eines »Grenzstein«-Entwicklungsschrittes besteht der Verdacht auf eine Entwicklungsstörung, und weitergehende Untersuchungen müssen veranlasst werden. Das Konzept der »Meilensteine« definiert hingegen eine normale Entwicklung. Es hat den Vorteil, dass sich darin die Variabilität der Entwicklung abbildet. Meilensteine sind aber nicht geeignet, um Bewegungsstörungen zu definieren. Die folgenden Zeitangaben für eine »normale« motorische Entwicklung sind also als »Meilensteine« zu verstehen.
Vor der Geburt: Mit Ultraschalluntersuchungen des menschlichen Fötus kann man Kindsbewegungen ab der 8. Schwangerschaftswoche (SSW) erkennen. Die Bewegungsmuster werden in den folgenden Wochen immer differenzierter. Ab der 10. SSW kann man darstellen, wie das Kind einen Arm oder ein Bein bewegt oder den Kopf dreht. Hand zum Gesicht bringen, Atembewegungen, sich strecken, Mund öffnen, Kopf vorbeugen und Gähnen kann ab der 11. SSW gesehen werden.
Von dort aus ist es bereits ein langer Weg bis zum Neugeborenen, das neben symmetrischen Bewegungen bereits differenzierte Bewegungsmuster einzelner Extremitäten zeigt. Das Neugeborene strampelt oft symmetrisch, teils aber auch wechselseitig (alternierend). Die Haltung wird von Neugeborenen-Reflexen mitbestimmt. Abbildung 3.1 zeigt die typische Fechterhaltung des asymmetrisch-tonischen Nackenreflex (ATNR): In Rückenlage werden die gesichtsseitigen Extremitäten bei passiver Drehung des Kopfes gestreckt. Dieser Reflex klingt spontan bis zum 6. Lebensmonat ab.

Abb. 3.1: Haltung des Neugeborenen in Rückenlage
Im dritten Monat wird der Kopf im gehaltenen Sitzen schon eine halbe Minute lang aufrecht gehalten. In der Bauchlage stützt sich der Säugling auf beiden Unterarmen ab, hebt den Kopf über 45° und hält ihn eine Minute lang hoch (Unterarmstütz;  Abb. 3.2). Die meisten Neugeborenen-Reflexe sind zu dieser Zeit schon abgeklungen.
Abb. 3.2). Die meisten Neugeborenen-Reflexe sind zu dieser Zeit schon abgeklungen.
Im vierten Monat wird in Bauchlage der sichere Stütz auf den Handwurzeln erreicht (Handwurzelstütz;  Abb. 3.3). Beim Hochziehen aus der Rückenlage wird der Kopf etwas angehoben, und die Beine werden gebeugt.
Abb. 3.3). Beim Hochziehen aus der Rückenlage wird der Kopf etwas angehoben, und die Beine werden gebeugt.

Abb. 3.2: Haltung des Säuglings in Bauchlage: Unterarmstütz

Abb. 3.3: Haltung des Säuglings in Bauchlage: Handwurzelstütz
Im sechsten Monat streckt das Kind die Beine, wenn es zum Stand hochgehoben wird, und übernimmt für wenige Sekunden das Körpergewicht. In Sitzhaltung ist die Kopfkontrolle schon so stabil, dass der Kopf auch bei einer Neigung des Rumpfes gehalten werden kann. In Bauchlage kann der Rumpf auch auf gestreckten Armen und offenen Händen abgestützt werden.
Am Ende des siebten Monats können fast alle Kinder von der Bauchlage in eine Seitenlage wechseln und über einige Sekunden einen Arm frei von der Unterlage halten (  Abb. 3.4). So wird das Greifen auch aus der Bauchlage heraus möglich. Diese Rotation, eine korkenzieherartige Drehung des Rumpfes, wird erst im Schultergürtel möglich, dann im Rumpf und zuletzt im Beckengürtel. Sie ist die Vorbedingung für das Drehen aus Bauchlage in Rückenlage und zurück. In Rückenlage erreicht das Kind mühelos seine Füße und spielt mit ihnen. Wenn man es am Rumpf hochhält, federt und tanzt es auf der Unterlage. Manche Kinder beginnen mit einer Art seitlichem Rollen sich fortzubewegen, andere rutschen in Bauchlage mit Kriechbewegungen nach rückwärts.
Abb. 3.4). So wird das Greifen auch aus der Bauchlage heraus möglich. Diese Rotation, eine korkenzieherartige Drehung des Rumpfes, wird erst im Schultergürtel möglich, dann im Rumpf und zuletzt im Beckengürtel. Sie ist die Vorbedingung für das Drehen aus Bauchlage in Rückenlage und zurück. In Rückenlage erreicht das Kind mühelos seine Füße und spielt mit ihnen. Wenn man es am Rumpf hochhält, federt und tanzt es auf der Unterlage. Manche Kinder beginnen mit einer Art seitlichem Rollen sich fortzubewegen, andere rutschen in Bauchlage mit Kriechbewegungen nach rückwärts.
Читать дальше
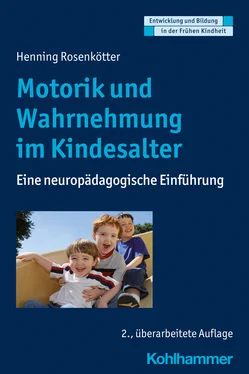

 Abb. 3.2). Die meisten Neugeborenen-Reflexe sind zu dieser Zeit schon abgeklungen.
Abb. 3.2). Die meisten Neugeborenen-Reflexe sind zu dieser Zeit schon abgeklungen.