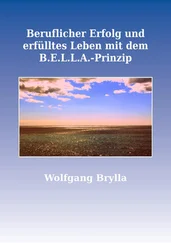Jerry und ich teilten uns ein Zimmer mit zwei Einzelbetten und einem Schreibtisch dazwischen. An den meisten Abenden saß er bis spät in die Nacht da und lernte, während ich im Bett lag und versuchte, das Magazin Mad zu lesen, das ich mir nur ab und zu leisten konnte. Seine Leselampe schien mir genau in die Augen. Gerade eben hatten wir noch miteinander gespielt, doch von einer Sekunde auf die andere, so schien es, war er älter und kultivierter und hatte Freunde, die nicht im Entferntesten daran interessiert waren, seinen kleinen Bruder im Schlepptau zu haben. Die fünf Jahre Altersunterschied schienen nun wie ein Abgrund zwischen uns, und die einzige Zeit, die wir ab da miteinander verbrachten, war in den Ferien oder bei irgendeinem sportlichen Wettkampf, den ich sowieso immer verlor. Er besiegte mich sogar beim Monopoly und beim Schach, da er mir nur gerade so viel beigebracht hatte, dass er mich noch schlagen konnte. Mann, es kotzte mich immer voll an, dass er all diese Hotels und Häuser besaß. Stets erlaubte er es mir, mich an einer einzigen rosa Immobilie festzuklammern, bis er mich vollends vernichtete.
Ich bin sicher, dass ich meinen Vater regelmäßig zur Verzweiflung trieb. Ich könnte immer noch zusammenzucken, wenn ich an seinen Ledergürtel auf meinem Hintern und meinen Beinen zurückdenke. Es war viel schlimmer als die Holzlatte, mit der man uns in der Schule züchtigte, und es blieben rote Striemen zurück. Meine gesamte Kindheit hindurch musste ich seine Schläge erdulden. Ich nahm es einfach hin.
Wenn ich hingegen an meine Mutter denke, muss ich einfach immer lächeln. Sie war es gewesen, die darauf bestanden hatte, dass wir Sandy zu uns holten. Mein Vater wollte keine Haustiere, aber Mama sagte ihm mit fester Stimme: „Jeder Junge braucht einen Hund.“ Sandy war mein bester Freund und viel wichtiger für mich als unsere Katze Blackie, die beinahe wöchentlich zu werfen schien, meistens unten in meinem Schrank. Sie folgte mir treu jeden Tag bis zur Schule und wartete geduldig vor dem Klassenzimmer, bis die Glocke läutete. Der Schulleiter rief meine Eltern mehrere Male an, damit sie den Hund nach Hause schafften. Doch wenn sie dann kamen, um ihn zu holen, rannte er von selbst zurück. Schließlich gaben sie es auf.
Eines Tages, als er etwa vier Jahre alt war, nahm ich ihn mit zum Tante-Emma-Laden, wo ich Pepsi und ein paar Erdnüsse kaufen wollte. Während ich abgelenkt war und mit dem Besitzer über die neuesten Baseballergebnisse plauderte, verschwand Sandy hinter der Theke und verschlang ein wenig Rattengift. Zu meinem großen Schrecken setzten beinahe sofort die Krämpfe ein. Ich ließ meine sämtlichen Einkäufe auf den Fußboden fallen, schnappte ihn und rannte schnurstracks über die Straße zum Tierarzt.
„Bitte helfen Sie meinem Hund“, sagte ich, während ich ihn streichelte und meine Tränen auf sein Fell fielen. „Er hat Gift gefressen, und es geht ihm sehr schlecht. Lassen Sie ihn nicht sterben.“ Sandy verdrehte fürchterlich die Augen, zuckte am ganzen Körper und hatte Schaum vor dem Mund. Der Tierarzt nahm ihn mir aus den Armen, eilte mit ihm ins Hinterzimmer und schloss die Tür hinter sich. Ich saß über eine Stunde lang im Wartezimmer und schluchzte herzzerreißend, bis der Tierarzt schließlich mit ernster Miene wieder herauskam.
„Tut mir leid, mein Sohn, wir konnten nichts mehr tun“, sagte er zu mir, als ich voller Erwartung vor ihm stand.
Ich hatte nie gedacht, dass irgendetwas so wehtun könnte, und ich heulte während der gesamten Heimfahrt auf dem Fahrrad. Die neugierigen Blicke der Passanten waren mir egal. Zum Glück hatte Mama bei der Arbeit einen Anruf erhalten und wartete bereits, um mich zu trösten. Es dauerte Wochen, bis ich wieder in den Laden gehen konnte.
• • •
Jeden Sonntag, ganz egal, wie müde sie nach sechs vollen Arbeitstagen auch war, kochte Mama gebratenes Hühnchen mit Kartoffelbrei und Maisbrot. Ich kann immer noch kein Maisbrot riechen, ohne dabei an sie zu denken. Zu besonderen Anlässen lud Papa uns in Morrison’s Cafeteria zum Sonntagsangebot ein – neunundneunzig Cent für jeden von uns, und man konnte essen, so viel man wollte. Wir stellten uns mit Tabletts an, auf denen wir Salisbury-Steaks, Hühnchen und Kartoffeln aufgetürmt hatten. Wir stopften so viel in unsere hungrigen Mäuler, wie wir nur konnten, bis unsere Bäuche zum Platzen voll waren. Wenn sie uns gelassen hätten, hätten wir auch eine Schubkarre genommen.
Wie wenig Geld wir auch hatten, Mama achtete immer darauf, dass wir keinen Hunger litten und stets sauber waren. „Wasch dein Gesicht, deine Hände und Füße, und putz dir die Zähne“, sagte sie jeden Abend wie ein Mantra. „Und vergiss nicht, deine Gebete zu sprechen.“ Sie war eine überzeugte Baptistin aus dem Süden und glaubte fest an Gott. Vor jeder Mahlzeit mussten wir ein Tischgebet sprechen, obwohl Papa oft ungeduldig war und sich endlich dem wichtigen Teil, dem Essen, zuwenden wollte.
Sobald wir laufen gelernt hatten, schleppte Mama Jerry und mich sonntags zur Bibelstunde. Papa kam nie mit. „Ich habe alles gehört, was die zu sagen haben“, bemerkte er dann trocken und fuhr mit der Zubereitung seiner wochenendlichen Lieblingsleckerei – gebratene Austern – fort, während man mit uns zur North Central Baptist Church marschierte.
Jerry und ich wurden zu Bibelstudiengruppen angemeldet und auf die baptistische Taufe vorbereitet, die in einem durchsichtigen Wasserbecken aus Glas stattfand, das wie ein riesiges Aquarium aussah und in das der Priester mit seinem „Opfer“ hineinstieg. Eines Tages tauchte der Priester so eine große, fette Dame aus der Gemeinde unter. Er legte sein Taschentuch über ihren Mund und sprach Gebete, während er sie unter Wasser hielt. Na ja, diese alte Dame begann zu treten und um sich zu schlagen und versuchte, aus dem Wasser zu kommen, aber er wollte sie nicht hochlassen. Ich sah mit Entsetzen zu, bis sie schließlich durchs Wasser nach oben schoss und nach Luft schnappte.
„Habt ihr das gesehen?“, schrie ich außer mir. „Der Priester hat sie beinahe ertränkt.“ Nach dem Gottesdienst ging ich schnurstracks rüber zur Methodistenkirche auf der anderen Straßenseite und schrieb mich an Ort und Stelle dort ein. „Methodisten“, so teilte ich meiner Mutter mit fester Stimme mit, „bespritzen einen nur.“
Das Beste an der Kirche war für mich die Musik – nicht in unserer, aber in den Kirchen der Schwarzen. An den meisten Sonntagen, wenn unser Gottesdienst längst vorüber war, ging ich die zweieinhalb Kilometer zu Fuß zu einer Kirche der Pfingstgemeinde, setzte mich draußen auf den Rasen und wiegte mich sanft im Takt zu den kraftvollen Klängen und beeindruckenden Stimmen, die aus den offenen Fenstern herausdrangen. Mann, diese Leute wussten, wie man ein Lied richtig sang.
Meine Eltern hatten nur wenige Freunde. Keiner von beiden war besonders kontaktfreudig, und beide waren sich ihrer durch den frühen Schulabbruch bedingten Unzulänglichkeiten schmerzlich bewusst. Alles, was ich meinen Vater jemals lesen sah, war die Zeitung – oder das „Papier zum Fischeinwickeln“, wie er sie nannte. Jeden Abend musste ich ihm die Zeitung in den Hof bringen. Selbst wenn sie gesellig gewesen wären, was sie aber nicht waren, hätten Mama und Papa trotzdem kein Geld und keine Räumlichkeiten gehabt, um Gäste zu empfangen. Die Küche war nur etwa zwei Meter vierzig mal zwei Meter vierzig groß, mit einer Spüle und einem Herd, der von einer Gasflasche gespeist wurde. Man konnte gerade zwei Personen darin unterbringen – wenn sie einander geschickt auswichen. Unser winziges Wohnzimmer gestattete ebenfalls keine Partys.
Meine Mutter beklagte sich selten über ihre materielle Situation, doch eines Sommers beschloss sie, dass sie unbedingt ein Esszimmer haben musste. Ihre jüngere Schwester hatte eine gute Partie gemacht, und sie und ihr Ehemann Ursell waren die reichsten Leute, die wir kannten. Er hatte am Krieg teilgenommen, war danach beim Militär geblieben und diente nun am Luftwaffenstützpunkt Wright-Patterson in Dayton im Bundesstaat Ohio. Jedes Mal, wenn sie mit ihren Kindern Jean und Frank zu Besuch kamen, trafen sie im neuesten Modell von Cadillac oder Oldsmobile ein. Sie lebten in einem Haus mit einem hübsch gestalteten Garten und einer Garage, und Frank hatte einen Motorroller, auf dem er mich fahren ließ. Am beeindruckendsten – zumindest was meine Mutter betraf – war jedoch, dass sie ein separates Zimmer zum Dinieren hatten.
Читать дальше