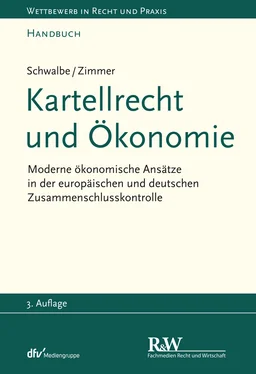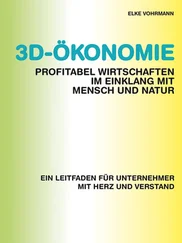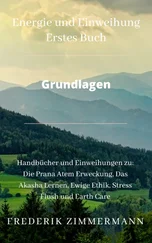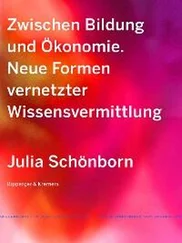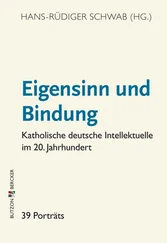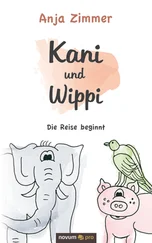1 ...6 7 8 10 11 12 ...47 Monopol und Produktionseffizienz.Im Rahmen des Modells des langfristigen Gleichgewichts konnte deutlich gemacht werden, dass Unternehmen durch aktuellen oder potentiellen Wettbewerb dazu veranlasst werden, die effizienteste Technologie einzusetzen und in Verfolgung ihres Ziels der Gewinnmaximierung keine Ressourcen zu verschwenden, d.h. sowohl die einzelwirtschaftliche als auch die gesamtwirtschaftliche Produktionseffizienz war gewährleistet. Wenn jedoch ein Unternehmen keinem Wettbewerbsdruck ausgesetzt ist, wie das beim reinen Monopol der Fall ist, dann besteht die Gefahr, dass dieses Unternehmen nicht effizient produziert. Die durch das „ruhige Leben“ eines Monopols hervorgerufenen X-Ineffizienzen wie z.B. die Wahl einer inferioren Produktionstechnologie, resultieren vor allem daraus, dass bei der in vielen Unternehmen üblichen Trennung von Eigentum und Kontrolle das Management eines Unternehmens neben den Unternehmenszielen auch eigene Interessen verfolgt und daher keine ausreichenden Anreize hat, die kostenminimale Technologie einzusetzen.42 Dies kann z.B. dann der Fall sein, wenn das Management gegenüber den Eigentümern über einen Informationsvorsprung verfügt, den es zur Verfolgung eigener Ziele ausnutzen kann. Hinzu kommt, dass das Management sich aufgrund der Verfolgung eigener Interessen nicht gewinnmaximierend verhält. Der mit einem Monopol verbundene Wohlfahrtsverlust kann also durch X-Ineffizienzen noch vergrößert werden.43 Allerdings ist der Zusammenhang zwischen der internen Organisation eines Unternehmens und seinem Verhalten am Markt, der für das Problem der Produktionsineffizienz von zentraler Bedeutung ist, in der industrieökonomischen Literatur bisher noch wenig untersucht worden.44
Eine weitere Ineffizienz, die im Rahmen dieses Abschnitts angeführt werden kann, sind die Aufwendungen, die ein Monopolist tätigt, um seine Position zu sichern. Auf dieses Problem des so genannten rentseeking wurde von Tullock und Posner aufmerksam gemacht.45 Wenn diese Aufwendungen keinen sozialen Nutzen stiften und ein Monopolist maximal bereit wäre, seinen gesamten Monopolgewinn hierfür zu verwenden, dann müsste dieser Monopolgewinn als Maß für die Verschwendung produktiver Ressourcen herangezogen werden. Allerdings sind die genannten Voraussetzungen in vielen Fällen nicht erfüllt, sodass gegenüber der Annahme von durch rent-seeking verursachte Ineffizienzen im Allgemeinen eher Skepsis angezeigt erscheint.46
Auf einen positiven Zusammenhang zwischen einem Monopol und möglicher Produktionseffizienz haben Alchian und Demsetz hingewiesen. Demnach könnte ein Unternehmen gerade deswegen eine Monopolstellung erreicht haben, weil es effizienter ist als seine Wettbewerber.47 Wenn das der Fall wäre, dann gäbe es einen Trade-off zwischen allokativer Ineffizienz und Effizienz in der Produktion. So ist der Fall denkbar, dass die durch ein Monopol verursachte allokative Ineffizienz geringer ist als die zusätzliche produktive Effizienz. Auf diesen Zusammenhang wird im Rahmen der Berücksichtigung von Effizienzgewinnen in der Fusionskontrolle auf den Seiten 620–623 näher eingegangen.
Monopol und dynamische Effizienz.Die Vermutung eines positiven Zusammenhangs zwischen Monopolen bzw. Großunternehmen und dynamischer Effizienz bzw. Innovationen und technischem Fortschritt geht auf Schumpeter zurück.48 Das zentrale Argument für diese These besteht darin, dass nur Monopole über hinreichend hohe Gewinne verfügen, um die häufig kostspieligen und riskanten Investitionen in Forschung und Entwicklung (F&E) zu tätigen, um neue Produkte zu entwickeln und zur Marktreife zu bringen oder um durch innovative Technologien eine kostengünstigere Produktion zu ermöglichen. Ohne die entsprechenden Gewinne wären derartige Investitionen nicht möglich. Allerdings kann man diesem Argument entgegenhalten, dass ein Monopol auch einen geringeren Anreiz hat, derartige Investitionen zu tätigen als z.B. ein Unternehmen bei vollkommenem Wettbewerb. Während ein Unternehmen bei vollkommenem Wettbewerb durch eine Prozess- oder Produktinnovation seinen Gewinn im Vergleich zur Ausgangssituation ohne Gewinn drastisch erhöhen kann, erzielt das Monopol selbst ohne eine Investition bereits einen Monopolgewinn. Durch eine erfolgreiche Investition in F&E könnte es sich nur einen zusätzlichen Gewinn, d.h. die Differenz zwischen dem bisherigen Monopolgewinn und dem bei der neuen Technologie möglichen aneignen.49 Der Unterschied besteht also vor allem in der Ausgangsposition: Ein Unternehmen hat bei vollkommenem Wettbewerb durch eine erfolgreiche Innovation sehr viel zu gewinnen, ein Monopol hingegen nur einen Zuschlag auf seinen bisherigen Monopolgewinn. Diese Überlegung macht deutlich, dass Monopole häufig einen geringeren Anreiz für Investitionen in F&E haben als Unternehmen bei vollkommenem Wettbewerb.50 Allerdings gilt diese Aussage nicht mehr unbedingt, wenn sich das Monopol durch einen Markteintritt eines Konkurrenten in seiner Position bedroht sieht. In diesem Fall könnte es versuchen, durch eine Innovation den Marktzutritt für den potentiellen Wettbewerber unattraktiv zu machen.51
Ein weiterer Aspekt der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten eines Monopols bzw. eines Großunternehmens ist die Erfolgswahrscheinlichkeit der Forschung. Die Theorie zeigt, dass die Höhe der Ausgaben für Forschung und Entwicklung von der Erfolgswahrscheinlichkeit bzw. der Riskanz eines Forschungsprojektes abhängt: Ist diese Wahrscheinlichkeit hoch und die Riskanz der Investition gering, dann sind diese Ausgaben einer normalen Investition vergleichbar und ein größeres Unternehmen wird mehr von diesen Investitionen durchführen. Ist hingegen die Erfolgswahrscheinlichkeit gering und die Riskanz hoch, dann wird ein großes Unternehmen eher seine Marktmacht einsetzen anstatt durch riskante Investitionen in unsichere Forschungsvorhaben Kapital aufs Spiel zu setzen.52 Ähnlich wie die theoretischen Resultate über den Zusammenhang zwischen Unternehmensgröße bzw. Marktstruktur und Innovationen deuten auch die empirischen Ergebnisse darauf hin, dass es keine eindeutige Beziehung zwischen diesen Größen gibt.53 „First, economic theory has developed some important insights regarding the incentives for firms to construct R&D (Research and Development, Anm. d. Verf.) and how those incentives are related to industrial structure. However, such theory does not give a clear prediction regarding the main validity of the main Schumpeterian hypothesis. Second, while empirical results are somewhat mixed the data we have offer neither clear nor strong support for Schumpeter’s contentions.“54
Erweiterungen des Monopolmodells.Die grundlegende Theorie des Monopols, wie sie in vorigen Abschnitt vorgestellt wurde, ist in mehrerer Hinsicht erweitert und ergänzt worden. Einige der wichtigsten Modifikationen werden im Folgenden kurz skizziert. Es handelt sich dabei um Monopole auf dauerhafte Güter und Mehrproduktmonopole.
Monopole auf dauerhafte Güter.Wenn ein Monopol ein Gut herstellt, das im Konsum nicht untergeht, sondern seine Leistung über einen längeren Zeitraum abgibt, wie z.B. ein Kraftfahrzeug oder ein Kühlschrank, dann könnte ein solches Monopol andere Marktergebnisse hervorbringen als eines, das ein nicht-dauerhaftes Gut produziert. Die Überlegung dabei ist folgende: Wenn sich die Nachfrager nach dem Gut des Monopolisten in ihrer Zahlungsbereitschaft für dieses dauerhafte Gut unterscheiden, dann könnte der Monopolist zuerst einen sehr hohen Preis verlangen, um an die Konsumenten mit einer hohen Zahlungsbereitschaft zu verkaufen. In der nächsten Periode würde er den Preis senken, um nun auch die Konsumenten mit niedrigerer Zahlungsbereitschaft zu bedienen, in der dritten Periode würde er den Preis weiter senken und so nach und nach an alle Konsumenten verkaufen können. Der Monopolist würde versuchen, eine intertemporale Preisdifferenzierung vorzunehmen. Allerdings könnten die Konsumenten mit hoher Zahlungsbereitschaft ein solches Vorgehen des Monopolisten vorhersehen und daher mit dem Kauf des Produktes warten, bis der Preis gefallen ist. Im Extremfall, d.h. wenn das Gut, wie z.B. Land, eine unendliche Lebensdauer hat und die einzelnen Perioden nur eine sehr kurze Dauer haben, würde der Preis des Gutes auf die Höhe der Grenzkosten sinken. Der Grund für dieses Ergebnis liegt darin, dass die Konsumenten wissen, dass der Preis sehr schnell fallen wird; und daher werden sie mit dem Kauf des Gutes so lange warten, bis der Preis die Grenzkosten erreicht hat. Der Monopolist macht sich gleichsam selbst Konkurrenz durch sein Angebot in den folgenden Perioden. Er sieht sich also einer vollständig elastischen Nachfragefunktion gegenüber und würde sich so verhalten wie ein Unternehmen bei vollkommenem Wettbewerb, d.h. es würde eine effiziente Allokation realisiert werden. Diese Überlegung geht auf Coase zurück und ist in der Literatur als Coase conjecture bekannt.55 Monopole auf dauerhafte Güter, so die Coase conjecture, sind also deutlich weniger wohlfahrtsschädlich als solche auf Güter, die nicht dauerhaft sind.
Читать дальше