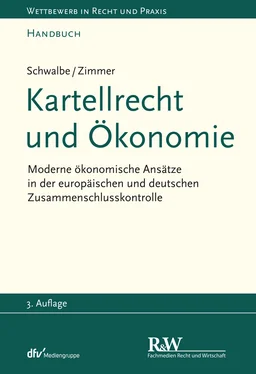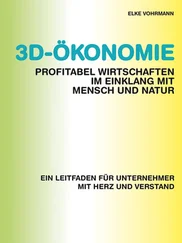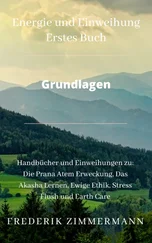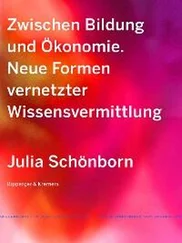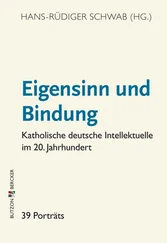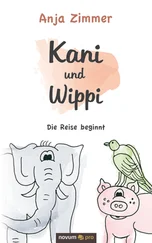1 ...8 9 10 12 13 14 ...47
IV. Monopolistische Konkurrenz
Das Modell der monopolistischen Konkurrenz wurde von Chamberlin 1933 entwickelt und kombiniert Ansätze des Modells des langfristigen Gleichgewichts bei vollkommenem Wettbewerb mit denen des Monopols.64 Dabei stellen die Unternehmen horizontal differenzierte Güter her,65 wobei jedes Unternehmen genau eine Variante des Gutes produziert und sich einer fallenden Nachfragefunktion für sein Produkt gegenübersieht. Im Allgemeinen wird in diesem Modell der monopolistischen Konkurrenz von einem repräsentativen Konsumenten ausgegangen, der Präferenzen über die von den Unternehmen angebotenen Güter hat und einen höheren Nutzen erzielt, wenn eine größere Zahl verschiedener Produkte angeboten wird.66 Es wird angenommen, dass die Unternehmen sich als Gewinnmaximierer verhalten. Allerdings sieht sich auch ein solches Unternehmen einem Wettbewerb ausgesetzt, denn wie im Modell des langfristigen Gleichgewichtes werden weitere Unternehmen in den Markt eintreten, wenn dort positive Gewinne erwirtschaftet werden. Die neu in den Markt eintretenden Unternehmen werden weitere Varianten des Gutes anbieten, die vom repräsentativen Konsumenten nachgefragt werden. Dies hat zur Folge, dass die Nachfrage nach den Produkten der etablierten Unternehmen zurückgeht. Dieser Prozess wird sich solange fortsetzen, bis sich so viele Unternehmen im Markt befinden, dass kein Unternehmen mehr einen positiven Gewinn erwirtschaftet. Ein Gleichgewicht bei monopolistischer Konkurrenz ist genau dann erreicht, wenn der Preis des Produktes den Stückkosten entspricht. Die Anzahl der Produktvarianten im Markt (und damit die Zahl der Unternehmen im Markt) wird innerhalb des Modells, d.h. endogen bestimmt.
Da unterstellt wird, dass die Unternehmen auch fixe Kosten tragen müssen, sind Stück- und Grenzkosten verschieden, sodass im Gleichgewicht der Preis über den Grenzkosten liegt. d.h. monopolistischer Wettbewerb führt zu einer ineffizienten Allokation. Darüber hinaus kann gezeigt werden, dass jedes Unternehmen nicht im Minimum seiner Stückkosten produziert, d.h. die Unternehmensgröße ist nicht optimal. Da die Unternehmen differenzierte Güter produzieren, ist zu untersuchen, ob durch monopolistischen Wettbewerb eine größere oder geringere Anzahl von Produktvarianten hergestellt wird, als aus gesellschaftlicher Sicht sinnvoll wäre. Dies kann nicht eindeutig beantwortet werden, sondern hängt einerseits von der Höhe der Fixkosten ab: Sind diese sehr hoch, dann würden auch Produkte, für die eine hohe Zahlungsbereitschaft vorhanden ist, nicht produziert werden, selbst wenn der Preis über den Grenzkosten liegt, da das Unternehmen aufgrund der hohen Fixkosten einen Verlust machen würde. Andererseits entzieht ein neu in den Markt eintretendes Unternehmen durch seinen Substitutionswettbewerb den bereits im Markt befindlichen Unternehmen einen Teil der Nachfrage. Dieser Effekt wird jedoch von den eintretenden Unternehmen nicht berücksichtigt, sodass eine Tendenz besteht, zu viele Varianten des Produktes anzubieten. Je nachdem, welcher dieser Effekte überwiegt, kann es zu wenig oder zu viele Produktvarianten geben.67 Hinsichtlich der dynamischen Effizienz gilt ein ähnliches Resultat wie bei vollkommenem Wettbewerb: Zwar gibt es große Anreize zu Innovationen, aber aufgrund mangelnder Gewinne stehen dafür keine ausreichenden Mittel zur Verfügung.
Während die bisher betrachteten Marktstrukturen dadurch gekennzeichnet waren, dass es entweder sehr viele kleine oder ein sehr großes Unternehmen gibt, zeichnen sich die meisten aus wettbewerbsrechtlicher Sicht interessanten Märkte dadurch aus, dass die dort angebotenen Produkte nur von einer kleinen Anzahl von Unternehmen hergestellt werden, d.h. es handelt sich um oligopolistisch strukturierte Märkte.68 Von einem möglichen Randwettbewerb abgesehen, hat dabei jedes einzelne Unternehmen eine signifikante Größe bezüglich des Marktes. Wenn nun ein solches Unternehmen den Preis seines Produktes senkt oder die angebotene Menge erhöht, dann hat dies spürbare Auswirkungen auf die anderen Unternehmen im Markt. So werden z.B. bei einer Preissenkung Kunden von den anderen Unternehmen zu dem mit dem geringeren Preisen abwandern. Dies führt zu einer Umsatzeinbuße und möglicherweise zu einer Verringerung des Gewinns dieser Unternehmen. Es ist zu vermuten, dass sie einer Preissenkung nicht tatenlos zusehen, sondern z.B. ebenfalls mit einer Preissenkung reagieren. Der Gewinn eines Unternehmens hängt daher nicht nur von seiner individuellen Entscheidung ab, sondern zugleich von der Preis- bzw. Mengenpolitik der anderen Unternehmen. Es liegt also eine Situation strategischer Interdependenz vor. Eine rationale Entscheidung kann das Unternehmen also nur dann treffen, wenn es die strategische Interdependenz mit den anderen Unternehmen beim eigenen Kalkül explizit berücksichtigt. Dies gilt natürlich für jedes Unternehmen in diesem Markt, d.h. jedes Unternehmen ist sich bewusst, dass eine derartige Interdependenz besteht und wird diese bei seinen Entscheidungen über Preise, Mengen, Qualität etc. berücksichtigen. Es stellt sich daher die Frage, welche Preis- bzw. Mengenpolitik eines Unternehmens in einer derartigen Situation strategischer Interdependenz gewinnmaximierend ist. Da das Entscheidungsproblem äußerst komplex ist, konnte oligopolistischer Wettbewerb einer befriedigenden Analyse erst zugänglich gemacht werden, nachdem das entsprechende Instrumentarium zur Untersuchung rationalen Verhaltens in strategischen Entscheidungssituationen zur Verfügung stand. Hierbei handelt es sich um die Spieltheorie, die von dem Mathematiker John von Neumann und dem Ökonomen Oskar Morgenstern entwickelt und in ihrem Buch „The Theory of Games and Economic Behaviour“ im Jahre 1944 vorgelegt wurde.69 Diese Theorie wurde von John Nash , John Harsanyi sowie Reinhardt Selten erheblich weiterentwickelt.70 Im folgenden Exkurs werden die für die Analyse oligopolistischer Märkte zentralen Konzepte der Spieltheorie kurz dargestellt.
1. Grundlagen der Spieltheorie
Die Spieltheorie hat sich seit Beginn der 1970er Jahre zum wichtigsten analytischen Instrument der Industrieökonomik entwickelt.71 Vor allem aufgrund dieser Methode hat dieses Gebiet der Wirtschaftstheorie vor allem in den letzten 30–35 Jahren eine stürmische Weiterentwicklung erfahren und es ist eine Fülle neuer Konzepte und Modelle entwickelt worden, die zu einem tieferen Verständnis der Vorgänge auf Märkten mit unvollkommenem Wettbewerb geführt haben. Es werden im Folgenden die Grundbegriffe der Spieltheorie eingeführt und zur Illustration auf eine einfache stilisierte Oligopolsituation übertragen.
Allgemein wird in der Spieltheorie jede strategische Entscheidungssituation als ein Spiel bezeichnet. Dieser Terminus hat sich aus historischen Gründen etabliert, denn die ersten Untersuchungen, die im Rahmen strategischer Entscheidungsprobleme durchgeführt wurden, betrafen Gesellschaftsspiele wie Schach, Poker etc. In der Spieltheorie wird zwischen nichtkooperativen und kooperativen Spielen unterschieden. Bei kooperativen Spielen wird davon ausgegangen, dass die an einer Situation strategischer Interdependenz beteiligten Akteure, z.B. die Unternehmen in einem Oligopol, in der Lage sind, Absprachen oder Vereinbarungen derart zu treffen, dass die Einhaltung dieser Vereinbarungen durch einen (wie auch immer gearteten) exogen gegebenen Erzwingungsmechanismus (z.B. hohe Vertragsstrafen, die vor Gericht einklagbar sind) immer durchgesetzt werden kann. Im Unterschied dazu wird bei nichtkooperativen Spielen unterstellt, dass die Akteure keine erzwingbaren Vereinbarungen treffen können.
Für die Oligopoltheorie sind in erster Linie nichtkooperative Spiele von Bedeutung, denn in vielen Situationen gibt es für die Oligopolisten keine Möglichkeit, bindende Verträge zu schließen. So steht z.B. eine Vereinbarung über den Preis oder eine Festlegung der Produktionsmengen im Widerspruch zum Wettbewerbsrecht und kann daher vor Gericht nicht durchgesetzt werden. Wenn nun zwischen den Oligopolisten eine gesetzwidrige Vereinbarung getroffen wird, muss jeder der daran beteiligten Akteure einen Anreiz haben, diese Vereinbarung von sich aus einzuhalten und nicht davon abzuweichen. Eine Kartellabsprache über den Preis muss also die Eigenschaft haben, dass sich jedes Unternehmen im eigenen Interesse an diese Absprache hält. Wenn dies der Fall ist, dann hat eine Vereinbarung die Eigenschaft, sich „selbst zu erzwingen“ bzw. anreizkompatibel zu sein.
Читать дальше