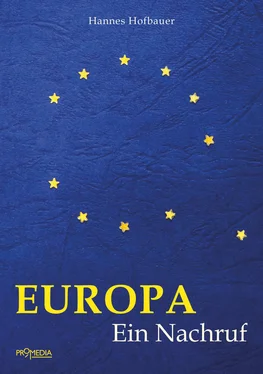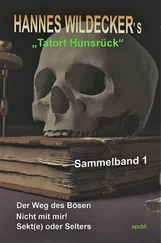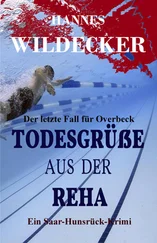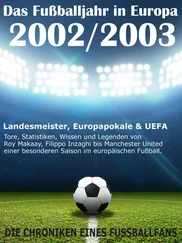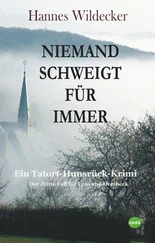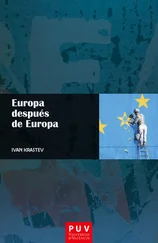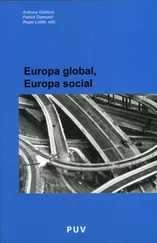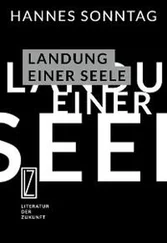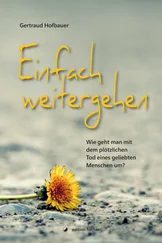Was Europapläne des 17. Jahrhunderts betrifft, so kann der Philosoph, Mathematiker und Historiker Gottfried Wilhelm Leibniz (1646−1716) in gewisser Weise als das deutsche Gegenstück zu Herzog von Sully gesehen werden. Auch Leibniz stand – als dafür Spätgeborener – noch unter dem Eindruck des weite Teile Europas verheerenden 30-jährigen Krieges. Seine Friedensidee ging von der Zähmung französischer Expansionsgelüste aus und wollte auch die Macht der Habsburger in die Schranken weisen. Europas innere Befriedung sollte durch ein starkes, kraftvolles, vereintes Deutschland erfolgen. Sein Plan trägt den sperrigen Titel »Bedenken, welchergestalt Securitas publica interna et externa und Status praesens im Reich jetzigen Umständen nach auf festen Fuß zu stellen«. Erschienen ist die Schrift 1670 im Auftrag des kurfürstlich-mainzischen Rates. Ihr Ziel war die Überwindung der deutschen Kleinstaaterei zwecks Etablierung eines deutschen Reichsbundes. Und wieder stoßen wir auf aggressive Expansionsstrategien, die Streit und Krieg zwischen den christlich-europäischen Fürsten verhindern sollen. Der vielleicht letzte Universalgelehrte Leibniz schlägt in dankenswerter Offenheit den einzelnen europäischen Herrscherhäusern vor, ihre Energien und Aggressionen nach außen zu wenden; und er wird sehr konkret dabei: der Habsburger Kaiser, Polen und Schweden möchten gegen die Türken kämpfen (was mehr als ein Jahrzehnt später dann tatsächlich passierte); England und Dänemark könnten Erweiterungen in Nordamerika in Angriff nehmen; Spanien dasselbe in Südamerika betreiben; für Holland wäre eine Expansion nach Indien hilfreich und Frankreich könne die Levante und Ägypten »zivilisieren«. »Hierbei würde unsterblicher Ruhm, ruhiges Gewissen, applausus universalis, gewisser Sieg, unaussprechlicher Nutzen sein«,37 lobpreist der Gelehrte seinen Plan.
Das Besondere am Leibniz’schen Europagedanken ist, dass er unbedingt auch das zaristische Russland mit einbinden will. Dieses soll gefälligst seine Kraft gegen die Tataren wenden und Streit und Hader innerhalb der christlichen Welt vermeiden. Hier schwingt eine seltene Akzeptanz der orthodoxen Christenwelt mit, der Leibniz im europäischen Expansionsreigen einen speziellen Platz zuweist. Die Idee der Einheit des Christentums nicht bloß als weströmische zeichnet den Gelehrten aus.
Am ausführlichsten beschrieben hat Leibniz den sogenannten »Ägyptischen Plan«. Damit will er Frankreichs Kriegslust gegen seine Nachbarn, beispielsweise einen bevorstehenden Überfall auf Holland, nach dem osmanisch beherrschten Nordafrika ablenken. Dafür reist der Leipziger Aufklärer extra nach Paris, um König Ludwig XIV. (1683−1715) von seinem Vorhaben gegen Holland abzubringen. Den fertigen Plan für den Feldzug gegen Ägypten hat er in der Tasche, und schreibt, dass es zwischen 30.000 und 50.000 Soldaten brauche, um das Land, das kaum Befestigungen und dafür leicht einnehmbare Häfen habe, zu überrennen. Auch an eine mögliche militärische Hürde dachte Leibniz, nämlich das osmanische Heer. Dies sei aber derzeit, so will er den französischen König beruhigen, mit Angriffsplänen gegen Polen beschäftigt. Frankreich hätte also freie Bahn in Ägypten und, so der schlaue Zusatzgedanke, würde dort auch indirekt holländische Expansionsgelüste in Ostasien behindern können. Denn von Ägypten sei der Weg für Frankreich nach Osten offen.38 Den »Ägyptischen Plan« hat Ludwig XIV. nie zu Gesicht bekommen. Anstatt Ludwig XIV. traf Leibniz mit dem russischen Zaren Peter I. (dem Großen) zusammen. In ihm sah er jenen Mann, der Russland zivilisieren und für die Teilnahme an einem aufgeklärten Europa vorbereiten könne.
Leibniz’ Image als Europa-Vordenker hat darob über die Jahrhunderte allerdings nicht gelitten. Auch deshalb, weil er seinen »Ägyptischen Plan« als den letzten Krieg bezeichnet, nach dem jeder Streit innerhalb Europas zu Ende wäre und ein Tausendjähriges Reich heraufzöge, in dem Maschinen menschliche Fähigkeiten verstärken, Krankheiten besiegt würden und eine christliche Sittenlehre universelle Gültigkeit hätte. Geopolitisch stellte sich Leibniz sein Europa folgendermaßen vor: »Das Reich ist das Hauptglied. Deutschland das Mittel von Europa (…), wie anfangs Griechenland, hernach Italien.«39
Napoleons Europa: Durch Expansion zur Einheit
Die Französische Revolution des Jahres 1789 wurde ihrem Namen gerecht: revolvere, umdrehen, das Untere nach oben spülen, die Verhältnisse auf den Kopf stellen, im sozialen Sinn genauso wie in Fragen der politischen Herrschaft. Sie war die Antithese zu allen vorher erdachten Europavisionen. Von einer herbeigewünschten »christlichen Einheit« konnte keine Rede mehr sein; das Prunkstück der französischen Gotteshäuser, die allerchristlichste Notre Dame de Paris, diente als Lagerhalle für Lebensmittel und Waffen; und selbst den auf Jesu Geburt datierten Kalender ersetzte man durch eine neue Zeitzählung. Der selbstherrliche Sonnenkönig Ludwig XVI. starb unter der Guillotine, die Volkssouveränität trat an seine Stelle. Der Begriff Europa kam in den revolutionären Texten nicht vor, stattdessen berauschte sich das Volk am nationalen Hochgefühl, die absolutistische, ausbeuterische Schreckensherrschaft der Monarchie abgeschüttelt zu haben. Dass man selbst bald daran ging, mit der Guillotine auch Fraktionskämpfe auszutragen, blieb der Nachwelt als Grausamkeit in Erinnerung.
Die revolutionäre Friedensidee unterschied sich entscheidend von der vorrevolutionären, die den inneren Frieden nur durch die Bezwingung eines äußeren Feindes denken konnte. »Ich glaube«, meinte der jakobinische Revolutionär Maximilien de Robespierre in einer seiner Ansprachen an die französische Nationalversammlung am 15. Mai 1790, »daß ihr lieber den Frieden wahrt, als euch in einen Krieg einzulassen, dessen Gründe ihr nicht kennt.«40 Er forderte das Volk auf, sich nicht für fürstliche Erweiterungspläne abschlachten zu lassen, mit welchen Argumenten auch immer sie vorbereitet, ausgerufen und geführt werden.
Demokratie und Menschenrechte – freilich nur gültig für Männer in Frankreich und nicht in den Kolonien – waren die Leitlinien der modernen Verfassung, wie sie 1791 in der Nationalversammlung festgelegt wurden und bis heute als »europäisch« definiert werden, ohne allerdings damals diesen Anspruch gehabt zu haben. Es sollte nicht lange dauern, bis beide nichts mehr wert waren. Postrevolutionäre Fraktionskämpfe nehmen schaurige Ausmaße an. Das sogenannte Direktorium, die letzte Regierungsform der Französischen Revolution, putscht am 27. Juli 1794 gegen die parlamentarische Versammlung, weist die Forderung nach sozialer Gleichheit zurück und beendet damit die radikale Phase der Revolution. Ein 24-jähriger Korse, der kurz zuvor in revolutionären Diensten die von England unterstützten Royalisten in Toulon geschlagen hatte, rückt im Oktober 1795 gegen Aufständische in den Pariser Vororten aus und lässt sie zusammenschießen. Napoléon Bonapartes Aufstieg beginnt.41
In den späten 1790er-Jahren trieb er oft schlecht ausgebildete Soldatenhaufen in Feldzüge gegen Italien und Ägypten; seine Motivationskraft bescherte ihm Ruhm und Ehre in Militärkreisen. Am 9. November 1799 erklärt sich Napoléon zum Ersten Konsul und die Revolution für beendet. Fünf Jahre später krönt er sich selbst in Paris zum Kaiser. In Austerlitz schlägt er 1805 die österreichischen Habsburger (bereits zum zweiten Mal), erleidet allerdings im selben Jahr eine Niederlage gegen die englische Flotte bei Trafalgar. Nun verhängt der Selbstherrscher die Kontinentalsperre gegen England, das erste große Handelsembargo der neuzeitlichen Geschichte. England soll mit wirtschaftlichem Boykott ruiniert werden. Als sich Zar Alexander I. diesem Embargo nicht anschließen will, marschiert Napoléon am 24. Juni 1812 mit einer halben Million Soldaten in Russland ein. Der Rest ist Niederlage: vor Moskau und nahe Waterloo.
Читать дальше