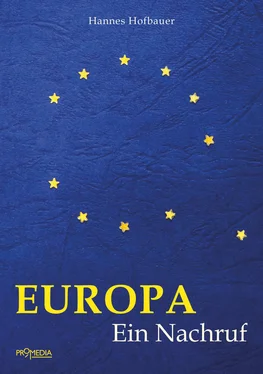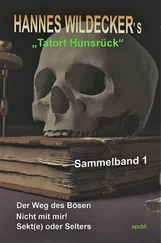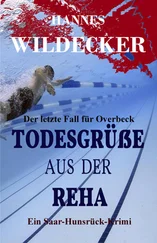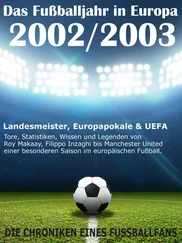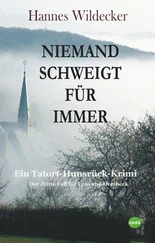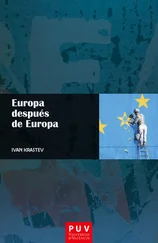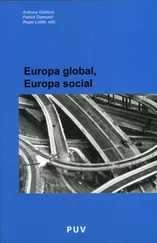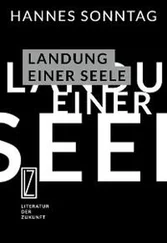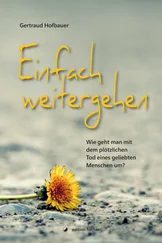Es ist ein Aufruf zum Krieg als einer explizit europäischen Angelegenheit, dem Kaiser und dem Papst geschuldet, in der Liebe zu Christus. Piccolomini nutzte die Gunst der Stunde, um sich in Szene zu setzen. Einen neuen Kreuzzug brachte er schlussendlich nicht zustande, für seine Wahl zum Papst im Jahre 1458 reichte sein Engagement gegen die Türken allemal. Als Pius II. trat er in die Fußstapfen von Apostel Petrus. Als Gelehrter hatte er sich schon zuvor einen Namen und um den Europabegriff verdient gemacht. »Europa« hieß das unter seiner Federführung entstandene ethnographisch-kosmographische Hauptwerk, das auf den Band »Asien« folgte. Es war die einzige Schrift des Mittelalters, die mit der Titelzeile »Europa« erschien und es dementsprechend kultur-religiös definierte.31
Der Historiker und Europaforscher Rolf Hellmut Foerster wertet die berühmte Türkenrede Piccolominis als defensiv. »Man muß«, schrieb Foerster 1963, »in diesem Aufruf zum Kreuzzug nicht den Plan einer Aggression, sondern eines Verteidigungsaktes sehen.«32 Dieses im christlichen Westen gängige Narrativ sieht in der Eroberung von Konstantinopel durch die muslimische Soldateska korrekterweise eine die Christenwelt bedrohende Aggression, die es abzuwehren gilt. Ein tiefergehender historischer Rückblick zeigt allerdings, dass die Geschichte der Kreuzzüge ab 1096 einen expansiven Charakter aufweist. Und seit der 4. Kreuzzug 1204 mit der Zerstörung des damals christlichen, allerdings oströmischen Konstantinopels endete, kann eigentlich von einer Verteidigung des Christentums als europäische Aufgabe im Osten nicht mehr gesprochen werden.
Sein antitürkisches Abenteuer endet für Papst Pius II. elendiglich. Mitte Juni 1464 schifft er sich in Ancona ein, um seinen zehn Jahre zuvor gepredigten Kreuzzug zu starten. Allein, außer einer Handvoll heruntergekommener Abenteurer will ihm niemand folgen. Am 15. August 1464 stirbt der verhinderte Kreuzfahrer Piccolomini/Papst Pius II. auf seinem Schiff auf dem Weg zwischen Venedig und Istrien. Zuvor hatte er noch eine zweite »europäische« Front aufgemacht, nämlich jene gegen die tschechischen Hussiten, also eine mitten in Europa als ungläubig definierte frühreformatorische Bewegung. Mit Georg von Podiebrad (1420−1471) erwuchs dem Papst ein mächtiger Gegenspieler, der es ebenfalls verstand, auf die europäische Karte zu setzen.
Podiebrad stammt aus mährischem Adel und wandte sich in jungen Jahren von der katholischen Kirche ab, um dem tschechischen Reformer Jan Hus zu folgen. Als sogenannter Ultraquist gehörte er dem gemäßigten hussitischen Flügel an, der gegen die sozial radikaleren Taboriten zu Felde zog und diese besiegte. Die ultraquistische Ständemehrheit wählte Georg von Podiebrad im Jahr 1458 zum König von Böhmen. Seine religiöse Gesinnung rief sogleich den Papst von Rom, Pius II, auf den Plan. Schon die husstische Symbolik des Kelches, aus dem alle Gläubigen und nicht nur der Priester das Blut Christi in Gestalt des Weines trinken sollten, zeugt von der kirchenreformerischen Idee, die für den römischen Katholizismus mit seiner hierarchischen Struktur inakzeptabel war (und bis heute ist). Folgerichtig drohte Rom mit einem Kirchenbann, dem der Böhmenkönig angeblich mit einer heimlichen Rückkehr in den Schoß der römischen Kirche zuvorkommen wollte.33 Der Order des Papstes, zwecks Abbitte nach Rom zu reisen, entsprach Podiebrad nicht.
Stattdessen entwickelte er seinerseits die Idee eines Kreuzzuges gegen die »furchtbaren Mohammedaner«, um sich als wahrer Christ zu inszenieren. Und diese Idee ergänzte er mit einem europäischen Föderationsplan, der heute als Vorläufer von immer wieder auftauchenden Einigungsprozessen gilt. In 21 Kapiteln entwarf Podiebrad die Idee für einen Bund gleichberechtigter Fürsten, in dem alle fünf Jahre der Vorsitz wechseln, ein gemeinsamer Gerichtshof innereuropäische Streitigkeiten beilegen und ein Finanzierungstopf für föderative Organe aufgelegt werden sollte. Geplant war – wie auch bei seinem Gegenspieler Papst Pius II. – eine christlich-»europäische« Armee. Sein Plan fand anfangs Zuspruch beim polnischen König Wladimir IV., Albrecht von Brandenburg und dem reichsten italienischen Stadtstaat Venedig. Letzterer sprang jedoch bald ab, als sich der finanzschwache Vatikan erholte und seinerseits zu einem Kreuzzug aufrief. Alaun-Funde auf dem Territorium des Gottesstaates waren dafür mitverantwortlich, weil die Gewinnung dieses Rohstoffes zur Färbung von Wolle plötzlich die Kassen Roms füllte.
Podiebrads Vorhaben scheiterte; und nach dem Tod von Papst Pius II. wurde er von dessen Nachfolger exkommuniziert. Für uns ist dabei von Interesse, wie durchsichtig die europäischen Einigungsideen des Mittelalters, in diesem Fall jene parallel von Pius II. und dem Böhmenkönig Podiebrad entwickelten, als Mittel zum Zweck für die Erweiterung des jeweils eigenen Machtbereiches eingesetzt wurden. Dieser Instrumentalisierung werden wir auch in der Neuzeit und bis herauf in unsere Tage begegnen.
Europas Herrscherhäuser im Kampf um die Vorherrschaft
Der von Maximilien de Béthune, genannt Herzog von Sully (1560−1641), um das Jahr 1632 verfasste und vielfach kopierte und veränderte »Große Plan« (»Grand Dessin«) ist so eine Machtvision. Sully war Marschall von Frankreich und enger Berater des französischen Königs Henri IV. Hinter seiner Idee eines europäischen Staatenbundes stand der Wunsch des Hofes im Palais du Louvre, eine Allianz gegen die immer mächtiger werdenden Habsburger, die in Spanien und Österreich herrschten, zu schmieden. Der deutsche Historiker Michael Gehler nennt den »Großen Plan« eine Mystifikation.34
Schon seine Entstehungsgeschichte zeigt, welchem Unbill sich nachgeborene europäische Spurensucher auszusetzen haben. Das »Grand Dessin« erschien 22 Jahre nach dem Tod von Henry IV. und gilt als dessen Vermächtnis an die Welt, an Europa. Für die Veröffentlichung der endgültigen Fassung verstrichen nochmals mehr als 100 Jahre, bis sie ein Abbé de L’Écluse 1745 drucken ließ. Ausgangspunkt für Sullys Vorstellung einer europäischen Zukunft war – wie konnte es anders sein – ein Kriegsprojekt, oder besser gesagt: sogar zwei von Franzosenkönig Henry IV. angedachte Waffengänge: einen gegen die habsburgischen Niederlande und einen gegen das Osmanische Reich. Letzterer wird von der Geschichtswissenschaft als unseriöses Gerücht bezeichnet, stand doch Paris Anfang des 17. Jahrhunderts in gutem Einvernehmen mit dem Sultan. Dies auch deshalb, weil die Hauptstoßrichtung der französischen »Europa«-Pläne gegen Wien und Madrid zielte.
Im »Grand Dessin« wird ein Bündnis aus 15 christlichen Staaten, sogenannten Dominiationen, herbeiphantasiert, in dem u. a. die Erbmonarchien Frankreich, England und Dänemark, der päpstliche Gottesstaat, die Königreiche von Ungarn und Polen sowie die vier Republiken Schweiz, Niederlande, Venedig und Neapel-Sizilien vereint hätten werden sollen. Aus den mitteleuropäischen Besitzungen der Habsburger würden sich die am Projekt Sully beteiligen Staaten territorial bedienen (z. B. hätte die Schweiz Tirol bekommen) bzw. wären drei neue Fürstentümer entstanden. Auch war ein »Europa-Rat« vorgesehen, in den die Teilnehmer je nach eigener Größe zwei bis vier Kommissare entsenden sollten. Sully schreibt in seinem großen Wurf von einer »sehr christlichen Republik«, wobei sein Republikbegriff nicht antimonarchistisch gedacht war.
Sullys mitten im 30-jährigen Krieg verfasster Plan zur Neugestaltung Europas schloss das türkische Osmanenreich definitiv aus und sah auch für das russische Zarenreich keinen Platz vor. Zu Russland ist bei ihm zu lesen: »Dieses ungeheure Land (…) wird z. T. noch von Götzendienern bewohnt, z. T. auch von schismatischen Griechen und Armeniern, deren Gottesdienst mit tausenderlei abergläubischen Gebräuchen vermischt ist, und mit dem unsrigen eben deshalb sehr wenig Ähnlichkeit hat.«35 Die Geschichte ging über diesen französischen Europa-Plan hinweg; am 24. Oktober 1648 wurde in Münster und Osnabrück der Westfälische Friede geschlossen, der das europäische Staatensystem ohne einen »Großen Plan« bis zur Französischen Revolution weitgehend prägte. Dem nach langen Kriegsjahrzehnten in Münster und Osnabrück vereinbarten Frieden lag ein Konsensprinzip zugrunde, das an die Stelle der Berufung auf eine christliche Gemeinsamkeit trat.36
Читать дальше