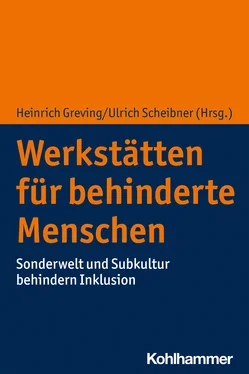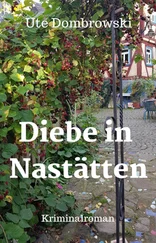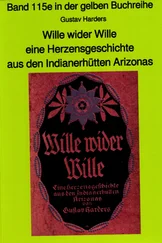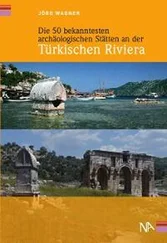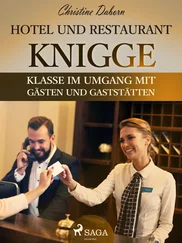Es gibt zahlreiche Vorschläge, wie diese Situation zu ändern ist. Sie haben an Aktualität nichts verloren. Einige davon sind besonders bedeutend, weil sie sich prinzipiell gegen eine »Gesellschaft der Behinderer« wenden, wie es 1997 im »Buch zur Aktion Grundgesetz« näher dargelegt wurde. 59 Zu den zeitgemäßen Forderungen gehören u. a. zwei, über die sich auch der frühere Präsident des Bundessozialgerichts, Peter Masuch (Jg. 1951, BSG-Präsident 2007–2016) in mehreren Beiträgen Gedanken gemacht hatte. Eine kleine Veränderung im Grundgesetz z. B. könnte große Wirkung erzielen:
Die Umstellung von Satz 2 im Artikel 3 Abs. 2 GG an den Schluss dieses Benachteiligungsverbotes:
»[…]
(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt.
(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner ethnischen Wurzeln, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Beeinträchtigung benachteiligt werden.
(4) Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung jeglicher Benachteiligungen aus den im Absatz 3 genannten Gründen hin.«
Die Ergänzung des Grundgesetzes: Aufnahme des gleichen Rechts auf Arbeit und Einkommen durch den Zugang zu einem offen gestalteten, inklusiven Arbeitsmarkt. Dazu bietet sich die Erweiterung von Artikel 12 GG um einen neuen Absatz 1 an:
(1) Alle Deutschen haben das gleiche Recht auf Arbeit in einem offenen und für alle zugänglichen inklusiven Arbeitsmarkt. Sie haben das Recht, den Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen. […]
Es ist angesichts der anhaltenden politischen Befürwortung von Sondereinrichtungen verständlich und sogar vorbildlich, wenn konsequent inklusionsverpflichtete Fachleute fordern, jede Form von Isolierung in Sondereinrichtungen als menschenrechtswidrig zu verurteilen. Das Deutsche Institut für Menschenrechte hält »das System der Behindertenwerkstätten aus menschenrechtlicher Perspektive für bedenklich«. 60 Solche Haltungen resultieren aus einem demokratischen Menschenbild, um das nicht erst seit dem Gesetz zum UNO-Übereinkommen gerungen wird. Der Kampf um Inklusion hatte bereits in den 1980er Jahren einen ersten Höhepunkt erlebt, als man noch von »Normalisierung« und »Integration« sprach. »Wer gebrechlich ist oder auffällig, wird in Sondereinrichtungen isoliert statt integriert«, schrieb 1982 das Wochenmagazin DER SPIEGEL. Und: Angehörige beeinträchtigter Menschen »wehren sich gegen die Aussonderung. Grund: Sie bringe ›erst die größte Behinderung‹ für die Kinder«. 61
Einrichtungen in Sonderwelten, deren Strukturen, Inhalte, Absichten und Zwecke dem grundgesetzlichen Benachteiligungsverbot und den Pflichten im Gesetz zum UNO-Übereinkommen widersprechen, können nicht inklusiv sein. Obwohl sich »Werkstätten« und ihre Organisationen gern das Inklusionsetikett anheften, halten sie den daran angelegten Maßstäben nicht stand. International sind sie isoliert. Der menschenrechtliche und sozialpolitische Paukenschlag von 2012 war nicht der erste, wohl aber bis dahin lauteste: »Es ist zwingend erforderlich, dass die Vertragsstaaten die Systeme geschützter Beschäftigung aufgeben und den gleichberechtigten Zugang von behinderten Menschen zum allgemeinen Arbeitsmarkt fördern«, verlangte das UN-Hochkommissariat in seiner Studie zur Arbeit und Beschäftigung von Menschen mit Beeinträchtigungen. 62
Drei Jahre später wiederholte der UNO-Ausschuss, der weltweit die Umsetzung der UN-Konvention für die Rechte behinderter Menschen prüft, diese Forderung. Er verlangte »die schrittweise Abschaffung der Behindertenwerkstätten durch sofort durchsetzbare Ausstiegsstrategien und Zeitpläne sowie durch Anreize für die Beschäftigung bei öffentlichen und privaten Arbeitgebern im allgemeinen Arbeitsmarkt.« Zugleich forderte er »die Sicherstellung, dass Menschen mit Beeinträchtigungen keine Minderung ihrer Sozial- und Altersversicherung erfahren, die gegenwärtig an die Behindertenwerkstätten gebunden ist«. 63
Die für die Bundesrepublik Deutschland zuständige Berichterstatterin, Diane Kingston, formulierte die notwendigen Bedingungen, um die deutschen »Werkstätten« abzuschaffen:
»Der Übergang braucht einen strategischen Plan, der viele Einzelschritte umfasst und eine langfristige Perspektive. Niemand darf finanziell schlechter gestellt werden und niemandem darf es emotional schlechter gehen. Niemand darf dabei verlieren. […] Was es also braucht, ist eine gedankliche Umstellung von der Aussonderung zur Inklusion. Das ist ein Langzeitprozess. Das passiert nicht in den nächsten fünf Jahren, sondern in Jahrzehnten.« 64
Seitdem sind die ersten fünf Jahre vergangen, von denen Diane Kingston gesprochen hatte. Die Bundesregierung hat diese wertvolle Zeit nicht nur inklusionspolitisch tatenlos verstreichen lassen. Sie hat sich auch mehrfach zur Sonderwelt der »Werkstätten« und zum Erhalt dieses Systems bekannt, das als Gespinst über der Bundesrepublik liegt und alle, die sich darin verfangen, festhält; fast alle von ihnen lebenslang.
Jetzt ist es an der Zeit, die Abgeordneten im Bundestag und in den Landtagen wie auch die Bundesregierung und die Länderregierungen nachdrücklicher als bisher aufzufordern, den Empfehlungen des Deutschen Instituts für Menschenrechte (DIMR) ohne weiteren Zeitverzug zu folgen: Es muss endlich »ein Konzept entwickelt werden, wie diese Sonderstruktur langfristig in einem inklusiv gestalteten Arbeitsmarkt aufgehen könne. Dabei müssten die Werkstattbeschäftigten von Anfang an einbezogen werden. Außerdem müsse darauf geachtet werden, dass dies nicht zulasten der Betroffenen und ihrer Sozial- und Alterssicherung gehe.« 65
2.12 »Vergnügen an Veränderung«
Der vollständige Satz ist kurz, einprägsam und motivierend. Er stammt nochmals von Georg Christoph Lichtenberg: »Vergnügen an Veränderung ist dem Menschen bleibend eigen.« Das ist wohl einer der couragiertesten Sätze, die Mut zu Reformen machen. Überdies stammt er von einem Menschen, der am eigenen Leib erfahren hat, was Beeinträchtigung und Behinderung bedeuten. Für alle Einrichtungen in den separierenden Sonderwelten kann das eine große Hoffnung sein: Wir stehen in unserem Jahrtausend vor einer großartigen Zeitenwende – dem Zeitalter der Inklusion. Der Wissenschaftler Hauke Behrendt beschreibt das »Ideal einer inklusiven Arbeitswelt« und stellt den tiefsinnigen Begriff »Teilhabegerechtigkeit« in den Vordergrund (Behrend 2018). 66
Teilhabe an unserer allgemein üblichen erwerbsichernden Arbeitswelt schafft nicht nur die materiellen Bedingungen zur Eigenständigkeit und Existenzsicherung. Sie ist unter unseren wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen auch die Voraussetzung zur Teilhabe an weiteren wichtigen Bereichen unseres gesellschaftlichen Lebens: »Weil Erwerbsarbeit ein notwendiges Mittel zur Verfolgung eigener Lebenspläne ist, gibt es hinreichenden Grund, Menschen mit Behinderung eine Teilhabe an der Arbeitswelt zu ermöglichen« (ebd. 290 ff.). An solchen Veränderungen mitzuarbeiten, sollte auch den Leitungen und Fachkräften in den »Werkstätten« einiges Vergnügen im Sinne Lichtenbergs bereiten.
Doch solche Reformen sind nach wie vor ein überaus schwieriges Unterfangen. Denn dieser gesellschaftlichen Entwicklung stehen enorm viele Hindernisse im Wege – in unserer Wirtschaft und Politik, in den Trägerorganisationen der »Werkstätten« und bei den »Werkstatt«-Leitungen. Inklusion beginnt nun mal im Kopf, d. h. in unseren Welt- und Menschenbildern. Dennoch sind wir seit dem 26. März 2009 ein entscheidendes Stück weiter auf dem Weg zur Inklusion vorangekommen: Das Gesetz zum UNO-Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (G-UNÜRMB) ist in Kraft. Es motiviert und stimuliert uns, seine Aufgabenstellungen, besonders die im Artikel 27, engagiert anzupacken: Heute noch behinderte Menschen haben grundsätzlich das gleiche Recht auf Arbeit in einem offenen und inklusiven Arbeitsmarkt. Zu diesem Recht müssen wir ihnen und den Beschäftigten in den Sondereinrichtungen verhelfen. Dafür ist es unerlässlich, die »Werkstätten für behinderte Menschen« umzugestalten. Als zeitlich befristete Übergangseinrichtungen – ganz im Sinne von Artikel 5 Abs. 4 G-UNÜRMB – müssen auch sie dazu beitragen, Teilhabegerechtigkeit und Gleichberechtigung im Erwerbsleben herbeizuführen: mit Vergnügen an Veränderung.
Читать дальше