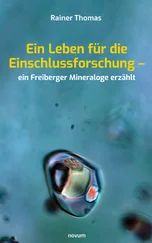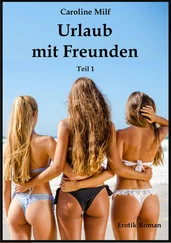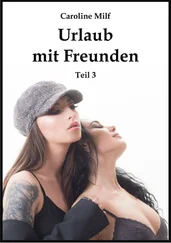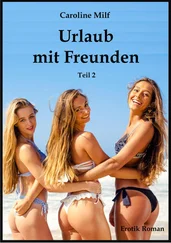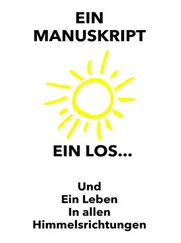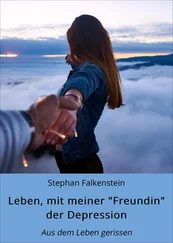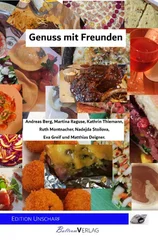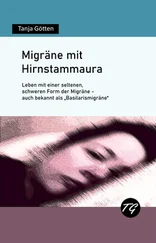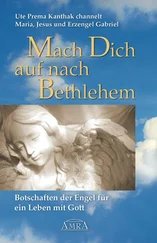»Ich sagte mir: entweder kannst du Brot liefern oder nicht. Kannst du kein Brot liefern, gutes, gesundes Brot, das das Herz und den Magen des Menschen erfreut, dann gib’s auf. […] Torten, Luxus werde ich nicht produzieren.«
Soma Morgenstern 81
2.2 »Das Geheimnis der Erlösung heißt Erinnerung« – Zum Werk Soma Morgensterns
»Das Vergessen verlängert das Exil – Das Geheimnis der Erlösung heißt Erinnerung«, dieser Spruch ist als Inschrift in die israelische Holocaust-Gedenkstätte ›Yad Vashem‹ in Jerusalem eingraviert. Hier steht er als Überschrift über dem Kapitel, das einen Überblick über Morgensterns schriftstellerisches Gesamtschaffen geben will. In vielerlei Hinsicht sind diese Worte von leitmotivischem Charakter für Morgensterns Leben wie auch für sein literarisches Schaffen. Sie umreißen mit wenigen Worten das Wesen von Morgensterns literarischem Werk.
Zweifellos kannte Morgenstern den Wortlaut dieser Inschrift und das nicht erst, seit ihn seine mahnende Plazierung nach der Eröffnung von ›Yad Vashem‹ im Februar 1947 international bekannt gemacht hat. Vielmehr dürfte diese Formel Morgenstern seit frühester Jugend geläufig gewesen sein und ihn sein Leben lang begleitet haben. Sie geht zurück auf Rabbi Israel ben Eliezer, genannt Baal Schem Tov, der als Gründer des Chassidismus gilt, jener religiösen Bewegung, in deren Sinn auch Morgenstern erzogen wurde. Die Religiosität, die so nachhaltig Morgensterns Elternhaus und damit auch seine Kindheit geprägt hat, ist auch in seinem weiteren Leben stets ein bestimmender Faktor geblieben, sieht man von der frühen Glaubenkrise in der Gymnasialzeit einmal ab. Fraglos hat sie auch sein Schreiben stark beeinflußt.
Exil und Erinnerungen spielen eine entscheidende Rolle in Morgensterns schriftstellerischem Werdegang. Erst im Exil begann er zu schreiben, schließlich war das Leben in Wien bereits ein erstes Exilerlebnis für den Jurastudenten mit journalistischen Ambitionen, nachdem er im Ersten Weltkrieg Ostgalizien, seine ursprüngliche und eigentliche Heimat, endgültig hatte verlassen müssen. Sein erster Roman entstand zu großen Teilen im Jahr 1934 im Pariser Exil. Die Exilsituation erscheint demnach ein durchaus prägender Faktor für Morgensterns schriftstellerische Tätigkeit gewesen zu sein. Nicht von ungefähr nimmt die Beschreibung seiner Heimat Ostgalizien mit ihren Menschen und Landschaften einen bedeutenden Platz in Morgensterns Romanen ein. Letztlich stellt sich Morgensterns gesamtes schriftstellerisches Werk dem Leser wie eine einzige Reise durch seine Erinnerungen dar. Selbst dort, wo er nicht unmittelbar sein eigenes Leben beschreibt, greift er maßgeblich auf sie zurück. In seinen Romanen verarbeitet er grundlegende Erlebnisse und Eindrücke aus seinem eigenen Leben, läßt die Welt seiner Kindheit in Ostgalizien wiedererstehen. Kapitel 3 der vorliegenden Untersuchung wird sich eingehend mit der Frage auseinandersetzen, in welchem Zusammenhang Exilerfahrung und das Bedürfnis nach deren schriftstellerischer Verarbeitung zueinander stehen.
Sieht man von den beiden frühen Versuchen als Theaterautor ab, begann Morgenstern seine schriftstellerische Tätigkeit als Romanautor. Das Romanschaffen bestimmt vor allem die ersten zwei Jahrzehnte seiner Autorenlaufbahn. Ende der vierziger Jahre vollendete er seinen vierten Roman Die Blutsäule . Erst zwanzig Jahre später, Ende der sechziger Jahre, schrieb er wieder einen Roman, der allerdings auch sein letzter bleiben sollte. Die Jahre dazwischen waren von der Arbeit an den ›autobiographischen Schriften‹ bestimmt, die den zweiten maßgeblichen Teil von Morgensterns Werk bilden.
Im Zentrum des Romanschaffens steht die Trilogie Funken im Abgrund . Morgenstern erzählt in den drei Bänden die Geschichte des jungen assimilierten Wiener Juden Alfred Mohylewski. Alfreds im Ersten Weltkrieg gefallener Vater hatte in jungen Jahren seine ostgalizische Heimat verlassen und war in Wien zum Christentum übergetreten, was zum Bruch mit seinem Bruder, dem ostgalizischen Gutsbesitzer Welwel Mohylewski, führte. Welwel holt seinen Neffen Alfred in die Heimat seines Vaters, nach Ostgalizien, zurück. Der ›Sohn des verlorenen Sohnes‹ findet dort zu seinen jüdischen Wurzeln und zum jüdischen Glauben zurück.
Der vierte Roman, Die Blutsäule , muß nach Morgensterns eigenen Angaben als Abschluß der Trilogie gesehen werden. Morgenstern legt hier ein tiefes Bekenntnis zu seinem jüdischen Glauben ab. Erst die Besinnung auf die Tora, das Kernstück des jüdischen Glaubens, konnte ihn aus der sprachlichen Erstarrung lösen, die ihn nach der Konfrontation mit den Dokumentationen über die an den Juden begangenen Verbrechen der Nationalsozialisten erfaßt hatte. Das scheinbar aussichtslose Dilemma, zum einen alles Deutsche so sehr zu hassen, daß er auch die deutsche Sprache nicht mehr lieben konnte, und zum anderen sich nicht in der Lage zu sehen, in einer anderen Sprache als der deutschen zu schreiben, löste Morgenstern, indem er auf den Sprachduktus der Tora, der fünf Bücher Mose, zurückgriff. Hier fand er zu einer neuen Sprache, einer deutschen Sprache, die bezeugte, daß er sich von der europäischen Kultur gelöst hatte. 82Das Buch sollte geschrieben sein, »as a man writes who has never read any other book but the Bible.« 83Morgenstern bedient sich einer deutschen Sprache, die er nach dem Vorbild der hebräischen Bibelsprache stilisierte. Diese ›heilige Sprache‹ zeichnet sich durch eine für einen in der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts in Prosa verfaßten Text ungewöhnliche Schlichtheit aus. Es ist ein gleichnishaftes, ein allegorisches Erzählen. Die Wortwahl mutet häufig altmodisch an – das Vokabular ist der hebräischen Bibel entnommen. So entgeht Morgenstern der Gefahr, bei dem so schwierigen, ja nahezu unartikulierbaren Thema des Holocaust eine Sprache zu benutzen, die im Alltag ganz profane Dinge bezeichnet und die Morgenstern, wie er in seinem Tagebuch schreibt, nicht mehr lieben konnte. 84Auch in der formalen Gestaltung diente die Tora Morgenstern als Vorbild. Die einzelnen Absätze des Textes sind durch Leerzeilen voneinander getrennt und werden so – ähnlich wie in der Bibel – optisch besonders betont.
Das fünfte und gleichzeitig letzte Werk Morgensterns, das in diesem Zusammenhang zu nennen ist, ist der Fragment gebliebene Roman Der Tod ist ein Flop , auf den im vorhergehenden Kapitel bereits kurz eingegangen wurde. Da Morgensterns Romanschaffen nicht Gegenstand dieser Untersuchung ist, sei an dieser Stelle lediglich noch auf einige wissenschaftliche Arbeiten verwiesen, die sich näher mit Morgensterns Romanen auseinandersetzen. Obwohl die Forschungsliteratur zu Soma Morgenstern und seinen Werken noch in ihren Anfängen steckt, gibt es vor allem über die Roman-Trilogie bereits einige lesenswerte Arbeiten. So geht Alfred Hoelzel in seinem Artikel über Morgenstern ausführlich auf die Roman-Trilogie und den Folgeroman Die Blutsäule ein. 85Hoelzel schildert nicht nur die genaueren Entstehungsumstände der einzelnen Bände, sondern liefert auch ein detailliertes Resümee der Romanhandlungen, so daß hier auf weiterführende Angaben zum Inhalt dieser Werke verzichtet werden kann.
Nach der Vollendung seines vierten Romans Die Blutsäule. Zeichen und Wunder am Sereth Mitte der fünfziger Jahre widmete sich Morgenstern fast ausschließlich der Aufzeichnung seiner Lebenserinnerungen. Hatte er seine schriftstellerische Laufbahn als Romancier begonnen, dessen Romane immer wieder um das eine Thema kreisen – die Auseinandersetzung mit dem jüdischen Glauben –, so beendete er sie als Memoirenschreiber, als Berichterstatter einer vergangenen Epoche.
Es steht außer Frage, daß auch Morgensterns Romanwerk stark autobiographische Züge aufweist. Allein schon die Tatsache, daß die Romane überwiegend in Morgensterns ostgalizischer Heimat spielen, zeigt, wie präsent und prägend die eigenen Erinnerungen auch in den Romanen sind. Die Lektüre der Kindheitserinnerungen In einer anderen Zeit , in denen Morgenstern seine Kinder- und Schuljahre in Ostgalizien schildert, erinnert in vielen Details an die Welt, die er in der Roman-Trilogie Funken im Abgrund erschaffen hat. Ja, es geht sogar soweit, daß Personen aus dem näheren Umfeld von Morgensterns Kinder- und Jugendzeit als Vorbilder für seine Romanfiguren Eingang in die Trilogie gefunden haben. So stand zum Beispiel Morgensterns Großonkel Jankel Turner Modell für die Gestalt des Jankel Christiampoler, der als Gutsverwalter von Welwel Mohylewski eine zentrale Rolle in den drei Romanen spielt. Morgenstern selbst weist in seinen Kindheitserinnerungen gleich zweimal auf diese Vorbildfunktion hin. So heißt es dort im Kapitel ›Trauriges Wiedersehn in der Alten Schul‹: »Dieser Großonkel ist mein Modell zu der Gestalt des Jankel Christiampoler, der durch die drei Romane meiner Trilogie leibhaftig fortlebt.« 86An einer anderen Stelle schreibt Morgenstern: »Denn dieser Jankel Turner ist das Vorbild zu meinem Jankel Christiampoler, der der Liebling aller meiner Leser geworden ist.« 87Es sei noch kurz darauf hingewiesen, daß das Schicksal des ›verlorenen Sohnes‹ entfernt an Morgensterns eigene Geschichte erinnert. Der abtrünnig gewordene Bruder von Welwel Mohylewski, Josef, hat wie Morgenstern seinen Willen gegen den Widerstand des strenggläubigen Vaters durchgesetzt und einen säkularen Bildungsweg eingeschlagen. Wie ihr Schöpfer gerät auch die Romanfigur in Konflikt mit ihrem Glauben und fällt von diesem ab.
Читать дальше