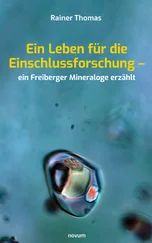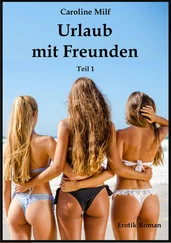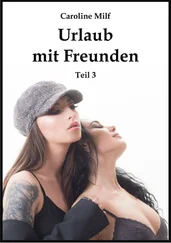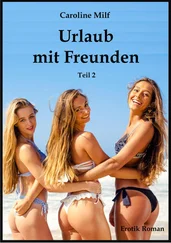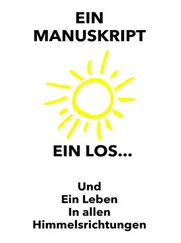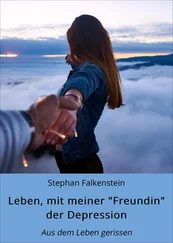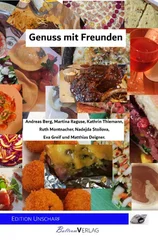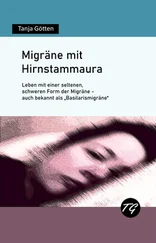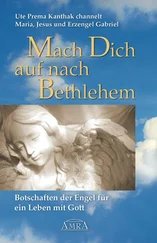Ende der vierziger Jahre begann Morgenstern mit der Arbeit an einem neuen Roman, in dem er die schrecklichen Nachrichten, die er über den Holocaust erfahren hatte, zu verarbeiten versuchte. Das Buch sollte ein ›Aufschrei‹ sein, mit dem Morgenstern den grauenhaften Bildern von Auschwitz Ausdruck verleihen wollte, die ihn vorübergehend hatten verstummen lassen. 69Er mußte die Arbeit jedoch wieder unterbrechen, da, wie er in den Kindheitserinnerungen schreibt, die Stimme brach und er erneut verstummte. 70Erst die im Jahr 1950 unternommene Reise nach Israel und vornehmlich der Besuch des Grabes von Rabbi Isaak Luria in Safed konnten die Schreibblockade endgültig lösen. 71
Nach seiner Rückkehr in New York beendete Morgenstern umgehend die Arbeit an dem vierten Roman, der im Jahr 1955 unter dem Titel The Third Pillar bei Farrar & Strauss erschien. In Deutschland wurde der Roman erstmals im Jahr 1964 unter dem Titel Die Blutsäule. Zeichen und Wunder am Sereth vom Hans Deutsch Verlag veröffentlicht. Morgenstern selbst bezeichnete dieses Werk auch als Epilog zu seiner Trilogie Funken im Abgrund . The Third Pillar sollte das letzte seiner Werke sein, dessen Veröffentlichung Morgenstern selbst noch erlebte.
Nach The Third Pillar – Die Blutsäule verfaßte er neben der Arbeit an seinen ›autobiographischen Schriften‹ nur noch ein einziges Werk, das sich nicht unmittelbar auf seine eigene Lebensgeschichte bezog. Wohl noch unter dem Eindruck einer Herzattacke, die er im Jahr 1969 erlitten hatte und nachfolgend schreibend zu verarbeiten suchte, schrieb er Ende der sechziger Jahre seinen letzten Roman, den er lapidar Der Tod ist ein Flop betitelte. Dieses Fragment gebliebene Werk steht, auch wenn dies zunächst überraschend anmutet, in der Tradition der sogenannten Inselutopie-Romane. Morgenstern erzählt hier die Geschichte des ungarischen Schriftstellers Aladar Csanda. Csanda ist im Begriff, ein neues Buch zu schreiben, das er sein ›Totenbuch‹ nennen will und in dem er seine Erfahrungen im Konzentrationslager von Auschwitz zu verarbeiten gedenkt. Es soll der Erinnerung an seine Freunde gewidmet sein, die Auschwitz nicht überlebt haben. Csanda wird durch einen mysteriösen Besucher an der Fertigstellung seines Buches gehindert. Der Besucher erweist sich als Bruder und Gesandter von Csandas Verleger Sidney Condon, der Csanda und dessen Freunde auf eine Reise zu der phantastischen Insel Edenia mitnimmt. Mit Edenia entwickelt Morgenstern eine utopische Gegenwelt zu dem »in mancher Hinsicht mörderischsten« Jahrhundert der Weltgeschichte. 72Die aufgeklärten Bewohner Edenias haben jeglichem Kult abgeschworen, der – in welcher Religion auch immer – um und mit dem Tod getrieben wird. Für sie gibt es den Tod nicht, sondern nur das Sterben, denn »den Tod haben die Religionen erfunden.« 73Zu einer Veröffentlichung des Werks ist es zu Morgensterns Lebzeiten nicht mehr gekommen. Der Tod ist ein Flop war lediglich in Form eines undatierten Typoskriptkonvoluts von acht zum Teil unvollendeten Kapiteln im Nachlaß erhalten. Das Romanfragment erschien erstmals im Jahr 1998, fast zwanzig Jahre nach seiner Entstehung, als neunter Band der Morgenstern-Werkausgabe im zu Klampen Verlag.
Anfang der siebziger Jahre waren zwei der autobiographischen Projekte so weit fortgeschritten, daß Morgenstern sie für eine Veröffentlichung vorbereiten konnte. Es handelt sich hierbei um jene Teile seiner Erinnerungen, die seinem Jugendfreund Joseph Roth und seinem, wie er ihn selbst bezeichnete, »nächsten Freund« 74, dem Komponisten Alban Berg, gewidmet sind. Beide Bände fanden sich in einer druckbereiten Fassung im Nachlaß. Bevor es zu einer Publikation kommen konnte, verstarb Morgenstern nur wenige Wochen vor seinem sechsundachtzigsten Geburtstag am 17. April 1976 in New York.
Sein Tod fand dies- und jenseits des Ozeans kaum Beachtung. In den Vereinigten Staaten brachte lediglich die New York Times einen Nachruf auf den verstorbenen Schriftsteller. 75In Europa veröffentlichte der Journalist und Musil-Herausgeber Adolf Frisé gut eine Woche nach Morgensterns Tod, am 26. April 1976, seinen Nekrolog auf Morgenstern in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung . 76Aus umbruchtechnischen Gründen erschien Frisés Artikel hier jedoch in stark gekürzter Form. Der ungekürzte Abdruck erfolgte einen Monat später unter dem Titel ›Besuch bei Soma Morgenstern. Erinnerungen an einen Europäer in New York‹ in der österreichischen Tageszeitung Die Presse und wird vom Verfasser selbst als die einzig maßgebliche Fassung bezeichnet. 77Frisés Nachruf ist weniger ein Nekrolog im Sinne einer posthumen Würdigung des Verstorbenen als vielmehr die Schilderung von Frisés Zusammentreffen mit Morgenstern im Oktober 1973. Im Zuge seiner Recherchen für die Herausgabe der Musil-Tagebücher war Frisé auf den Namen Morgensterns gestoßen. Musil erwähnt den Freund in einem Eintrag vom 16. März 1930. Das Gespräch mit Morgenstern weckte Frisés Interesse. »Die Fragen nach RM traten nicht zurück, im Gegenteil, aber der sie beantworten sollte, sie, in keiner Sekunde seine Reminiszenzen ordnend, mühsam animierend, ungemein plastisch, umweglos beantwortete, wurde unversehens auch selbst zum Objekt des Interviews, eine Figur, die Fragen aufwarf, das Interesse, die Neugier provozierte.« 78
Frisé dürfte es auch gewesen sein, auf dessen Anregung die ›Internationale Robert Musil Gesellschaft‹ einen Nachruf auf Morgenstern in ihrem halbjährlich erscheinenden Periodikum Musil-Forum veröffentlichte. 79Damit erschöpft sich die Liste der Würdigungen. Zumindest ist nichts über weitere Nekrologe bekannt. Morgensterns Tod verhallte so gut wie unbeachtet. Um so notwendiger ist die zumindest posthume, geistige Wiederbelebung dieses in Vergessenheit geratenen Schriftstellers und seines Werkes. Bislang war dies der Arbeit einiger weniger überlassen – allen voran Ingolf Schulte und dem zu Klampen Verlag.
Wer war Soma Morgenstern? – der obige kurze Abriß über Morgensterns Leben kann diese Frage nur zu einem Teil beantworten. Er kann Lebensdaten und -stationen benennen, doch die Frage nach dem Wesen und Charakter dieses Schriftstellers bleibt damit unbeantwortet. Ihre Beantwortung fällt heute schwer, da es nur wenige Menschen gibt, die Morgenstern noch persönlich gekannt haben. Deshalb soll zum Abschluß dieses einführenden Kapitels ein Mann zu Wort kommen, der Morgenstern äußerst nah gestanden hat und der ihn besser gekannt haben dürfte als die meisten: sein engster Freund Alban Berg.
In einem Brief an Morgensterns zukünftige Schwiegermutter, Annemarie von Klenau, schreibt er über den Freund: »[…] Ist damit schon gesagt, daß mich sein äußeres und inneres Wesen, seine menschlichen Züge, seine charakterlichen Eigenschaften so ungemein sympathisch berühren, wie es mir noch selten im Leben passiert ist, so möchte ich, wenn ich von ihm als Künstler spreche, sagen, daß er nicht nur einer von ganz exceptioneller Intelligenz ist, dank welcher er in allem Geistigen und Künstlerischen zuhaus ist, sondern daß er auch einer mit einem Wissen um die Dinge seines eigentlichen Berufs ist, wie dies sicherlich Wenige seinesgleichen aufzuweisen haben. […] Es wäre falsch, ihn, weil er Künstler ist und vielfach nach außen hin das Leben eines Bohémiens führt, für einen Phantasten zu halten, für einen der den praktischen, sagen wir sogar: den bürgerlichen Forderungen des Leben fremd gegenübersteht. Im Gegentheil: Dank seiner großen Menschenkenntnis, seiner Lebenserfahrung weiß er wohl, auf was es im Leben ankommt und – so macht es mir wenigstens den Eindruck – es wird ihm im gegebenen Fall an der, zur Gründung einer Existenz und überhaupt zum Leben, nötigen Energie, Zähigkeit, ja Härte sicher nicht fehlen, für welche Annahme auch seine, bei allem Mangel an Robustem überraschende körperliche Zähigkeit und Ausdauer (er ist Hochtourist) spricht.« 80
Читать дальше