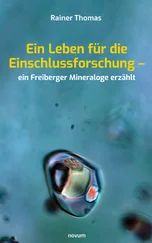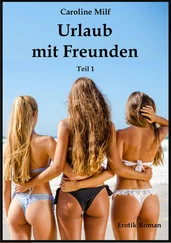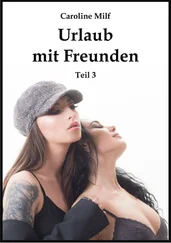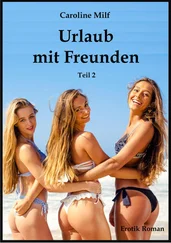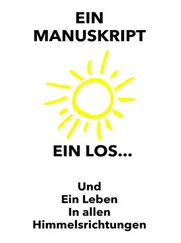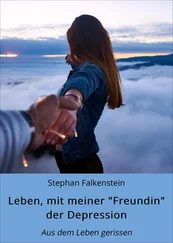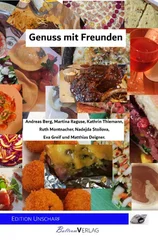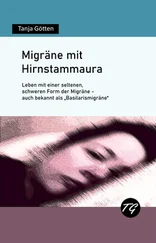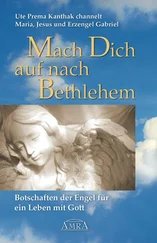In Wien pflegten die Morgensterns einen ausgedehnten Freundeskreis, der sich in erster Linie aus den namhaften Wiener Künstlerkreisen der zwanziger Jahre rekrutierte. Zu Morgensterns engsten Freunden dieser Jahre gehörten neben Alban Berg und Joseph Roth die Komponisten Karol Rathaus, Eduard Steuermann und Hanns Eisler, der Rezitator Ludwig Hardt sowie der Schriftsteller Robert Musil. Daneben war er mit dem Schönberg-Schüler Anton Webern, den Dirigenten Otto Klemperer und Jascha Horenstein, dem Wiener Architekten Josef Frank und dem aus Melník bei Prag stammenden Journalisten Karl Tschuppik bekannt. Zudem verkehrten die Morgensterns häufig bei Anna Mahler, der Tochter Gustav Mahlers, deren Wohnatelier ebenfalls ein Treffpunkt für zahlreiche Wiener Künstler war.
Auch wenn dies nur ein kurzer Einblick in den Freundes- und Bekanntenkreis ist, den Morgenstern während seiner Wiener Jahre pflegte, so ist er dennoch repräsentativ und ein Zeichen für Morgensterns reges Interesse am kulturellen Leben seiner Zeit. Er zeigt zudem, daß sich der Freundeskreis aus den unterschiedlichsten, zumeist künstlerischen Kreisen zusammensetzte. Auf der Liste der eben genannten Namen, die keineswegs Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, finden sich neben Journalisten und Schriftstellern auch Komponisten, Dirigenten und bildende Künstler. Dementsprechend breitgefächert war auch Morgensterns Einblick in die künstlerischen und intellektuellen Strömungen seiner Zeit.
Anfang der dreißiger Jahre ließ Morgensterns journalistisches Interesse zunehmend nach. In Joseph Roths Flucht und Ende beschreibt er den Sinneswandel jener Zeit folgendermaßen: »Drei Jahre später hatte ich so genug davon [von seiner Tätigkeit als Theaterkritiker in Wien], daß ich eines Tages beschlossen habe: Ich habe es satt, über etwas zu schreiben. Wenn ich nichts andres kann, wenn ich nicht etwas schreiben kann, werde ich mich auf meine Juristerei gutbürgerlich zurückziehen.« 46So weit kam es allerdings nicht
Seitdem Morgenstern dem Weltkongreß der Vereinigung orthodoxer Juden, ›Agudas Yisroël‹, im September 1929 als Beobachter im Auftrag der Frankfurter Zeitung beigewohnt hatte, trug er sich mit dem Gedanken, das Erlebnis dieses Kongresses in einem Roman zu verarbeiten. Im Jahr 1930 machte er sich an die Umsetzung dieses Vorhabens. Er begann mit der Arbeit an seinem ersten Roman, den er bereits jetzt als Auftakt einer Trilogie konzipierte. Nachdem Morgenstern durch den sogenannten Arierparagraphen des NS-Schriftleitergesetzes vom 4. Oktober 1933, der Juden von Presseberufen ausschloß, seinen Posten bei der Frankfurter Zeitung verloren hatte, beschloß er, sich gänzlich der Schriftstellerei zu widmen. Die Arbeit an seinem ersten Roman wurde jedoch durch die bürgerkriegsähnlichen Unruhen im Februar 1934 unterbrochen, bei denen sämtliche Organisationen der Sozialdemokratie und der freien Gewerkschaften in Österreich durch die autoritäre Regierung Dollfuß ausgeschaltet wurden. Morgenstern beschloß, seinem Freund Joseph Roth ins Exil nach Paris zu folgen: die zweite Exilerfahrung.
Die Angst vor einer Verhaftung war nicht unbegründet. In der Frankfurter Zeitung waren im Vorfeld der Unruhen einige Angriffe Morgensterns gegen die Vorbereitungen des Februarputsches veröffentlicht worden, die ihn ins Visier der Nationalsozialisten gerückt hatten. Vornehmlich sein Artikel ›Worte fallen in den Herbst der Wahlen‹, der am 25. Oktober 1930 in der Frankfurter Zeitung erschienen war, erregte ihre Aufmerksamkeit und trug ihm ›die Ehre‹ ein, »auf die Schwarze Liste der Nazis zu kommen«, wie er in den Erinnerungen an Joseph Roth schreibt. 47Morgenstern beschreibt in diesem Feuilleton unter dem Motto ›Nationalsozialisten werden betrachtet‹ zwei junge Nazis, die auf dem Wiener Ring zu Propagandazwecken flanieren: »Dem hübschen, noch jüngeren Jungen saß das Braunhemd wie eine Haut am Leibe. (Gibt es Braunhemden nach Maß?) Das große Hakenkreuz blühte ihm wie die Blume einer exotischen Krankheit am Arm. Als sei er für die Politik schwer geimpft worden, ein Pockenträger des Hitlerheils. […] Ein Dunst knabenhaft rührender Eitelkeit spiegelte er sich in seiner unformierten Gefälligkeit, ein kleiner Narziß von einem Nazi: ein lieblicher Nazi!« 49

Abb. 2: Soma Morgenstern, Zeichnung von Bil Spira 1939 48
Morgenstern erfuhr durch seinen Freund Karol Rathaus, daß sein Name auf die Schwarze Liste gesetzt worden war. Er nahm die Nachricht nicht allzu ernst. Daß er nur durch einen glücklichen Zufall den Fängen der Gestapo entgangen war, sollte er erst im Jahr 1940 in Marseille erfahren: »Eines Tages, im Jahre 1940, wurde ich zur Polizeipräfektur vorgeladen, und der Beamte tat so, als ob er sich um mein Schicksal kümmerte und mein Dossier studierte. Plötzlich und ohne mich anzublicken, so nebenbei, stellte er mir die Frage: ›Monsieur Morgenstern, vous conaissez par hasard une Madame Sonia Morgenstern?‹« 50Die Gestapo hatte Morgenstern fälschlicherweise als Frau Sonia Morgenstern in ihre Liste eingetragen. Ein Irrtum, der ihm das Leben gerettet hat.
Im Pariser Exil vollendete er noch im gleichen Jahr seinen ersten Roman Der Sohn des verlorenen Sohnes , der den Auftakt zu der Trilogie Funken im Abgrund bildete. Die Vollendung dieser Trilogie wurde jedoch durch die auf Europa einstürzenden politischen Ereignisse immer weiter hinausgezögert, so daß Morgenstern den dritten und letzten Teil erst Anfang der vierziger Jahre in Hollywood fertigstellen konnte. Im Mai 1934 hatte sich die politische Lage in Österreich unter dem neuen Regime soweit stabilisiert, daß Morgenstern an eine Rückkehr nach Wien denken konnte. Ihm schien keine direkte Gefahr mehr zu drohen. Zudem konnte er auf einflußreiche Freunde vertrauen, die ihn zunächst vor dem Zugriff der Heimwehrführer schützen konnten. Morgenstern zog es zurück an seinen Schreibtisch, der, wie er in Joseph Roths Flucht und Ende schreibt, »in meinem bisherigen Leben der einzige Schreibtisch [war], vor dem ich gerne saß. Es zog mich zu ihm hin mit einer Kraft, als hätte ich schon eine Ahnung, daß dieser Schreibtisch auch der letzte sein wird, von dem ich das behaupten kann.« 51
Morgensterns Freude über seinen ersten Erfolg als Schriftsteller währte nicht lange. Im Dezember 1935, kurz nach dem Erscheinen des Romans, starb unerwartet sein engster Freund Alban Berg. Hinzu kam noch, daß sich seine wirtschaftliche Lage nach dem Stellenverlust bei der Frankfurter Zeitung zunehmend schwieriger gestaltete. Am 13. März 1938, am Tage des sogenannten Anschlusses Österreichs an Nazideutschland, flüchtete Morgenstern ein weiteres Mal nach Paris.
Dieses zweite Pariser Exil sollte endgültig sein. Morgenstern kehrte nicht mehr nach Österreich zurück. Der zweite Teil seiner Trilogie, der Roman Idyll im Exil , war zu diesem Zeitpunkt bereits im Manuskript fertiggestellt. Seine Frau Ingeborg und den achtjährigen Dan mußte Morgenstern in Wien zurücklassen. Dan litt an Scharlach und war nicht in der Lage, die Reise nach Paris anzutreten. Wenig später konnten Mutter und Sohn nach Dänemark flüchten. Als Tochter des dänischen Komponisten Paul von Klenau besaß Ingeborg Morgenstern auch die dänische Staatsbürgerschaft. Das erleichterte die Ausreise.
In Paris lebte Morgenstern gemeinsam mit Joseph Roth im Hôtel de la Poste. Joseph Roths angestammter Tisch im dem Hotel zugehörigen Café Tournon entwickelte sich zum Treffpunkt der österreichischen Emigranten. Morgenstern schildert diese Zeit ausführlich in seinen Erinnerungen an Joseph Roth, die im Jahr 1994 als erster Band der Werkausgabe unter dem Titel Joseph Roths Flucht und Ende erschienen sind. An Roths Tisch im Café Tournon dürfte Morgenstern auch die Arbeit an dem dritten Teil seiner Trilogie, Das Vermächtnis des verlorenen Sohnes , begonnen haben. Beide Manuskripte – sowohl das des zweiten Bandes Idyll im Exil wie auch das des dritten – mußte Morgenstern in seinem Zimmer im Hôtel de Poste zurücklassen, als er im Mai 1940 von der französischen Polizei verhaftet wurde. Sie fielen wie auch alle weiteren Aufzeichnungen, Briefe und persönlichen Papiere Morgensterns in die Hände der Pariser Geheimpolizei.
Читать дальше