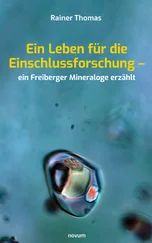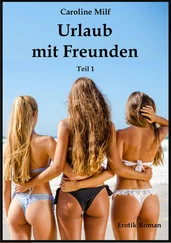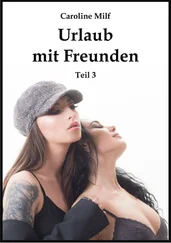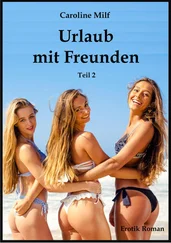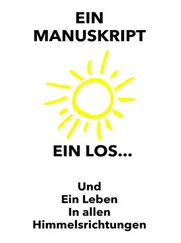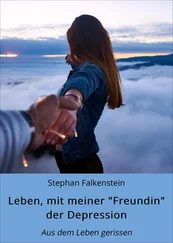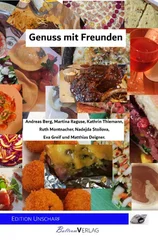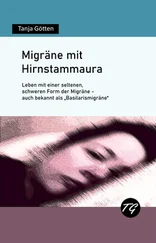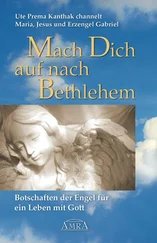1 ...6 7 8 10 11 12 ...15 Im Mai 1939 starb Joseph Roth. Morgenstern, der sich seit längerem vergeblich darum bemüht hatte, die nötigen Papiere für eine Emigration in die USA von den Pariser Ämtern zu bekommen, versuchte, eine Ausreise nach Palästina zu forcieren. Dieses Vorhaben wurde durch den Kriegsbeginn im September 1939 zunichte gemacht. Als ›feindlicher‹ Ausländer kam Morgenstern in französische Internierungshaft. Nachdem er kurzzeitig wieder auf freiem Fuß gewesen war, wurde er beim Beginn der deutschen Invasion im Mai 1940 abermals verhaftet und in das Internierungslager von Audièrne in der Nähe der bretonischen Hafenstadt Quimper deportiert. Von dort gelang ihm im darauffolgenden Monat, als das Lager bereits von deutschen Truppen besetzt war, die Flucht. Gemeinsam mit einem Lagergenossen konnte er sich bis nach Marseille durchschlagen, das in der unbesetzten Zone lag. Diese Erlebnisse hat er im ›Romanbericht‹ Flucht in Frankreich verarbeitet. 52
Nach siebenmonatigem Aufenthalt im unbesetzten Marseille, wo er die verlorenen Teile seines Romans Das Vermächtnis des verlorenen Sohnes zu rekonstruieren versuchte, konnte er sich nach Casablanca durchschlagen und gelangte schließlich nach Lissabon. Dort schiffte er sich auf einem Überseedampfer nach New York ein. Am 1. April 1941 verließ das Schiff Lissabon. Erst neun Jahre später, im Sommer 1950, sollte Morgenstern wieder einen Fuß auf europäischen Boden setzen. Mitte April des Jahres 1941 erreichte Soma Morgenstern New York – ein fünfzigjähriger, exilierter Schriftsteller ohne nennenswerte Reputation, nahezu mittellos und von der Familie getrennt.
In New York angekommen mietete sich Morgenstern im Hotel Park Plaza an der Upper West Side in der Nähe des Central Park ein. Dieses Hotel war offenbar eine Anlaufstelle für viele österreichische Emigranten, so hatten dort auch Walter Mehring, Hermann Kesten, Leonhard Frank und Hertha Pauli eine Unterkunft gefunden. Letztere war auf demselben Weg wie Morgenstern am 12. September 1940 nach New York gekommen. In ihrer Autobiographie Der Riß der Zeit geht durch mein Herz beschreibt sie die Situation im Hotel Park Plaza folgendermaßen: »Kesten quartierte uns in einem Hotel ein, wo er selbst mit seiner Frau Toni wohnte. Es liegt gegenüber dem Naturhistorischen Museum, mit einem freundlichen Blick auf den Central Park West. Damals schien mir das Hotel als ein Feenschloß, heute ist es ganz heruntergekommen. Kesten erzählte, daß Theodore Dreiser hier logiert hat. Adrienne Thomas sei auch da. Später sollten [Walter] Mehring und [Bruno] Frank noch hinzukommen, auf ihrem Weg nach Hollywood. Mit neun meiner zehn Dollar zahlte ich die Rechnung für die erste Woche. Dann begann das Hungern. […] Neben unserem Hotel befand sich ein kleines griechisches Restaurant, in dessen Fenster die Tageskarte hing. Es gab ein Dinner, drei volle Gänge, für 50 Cent. […] für mich in New York waren 50 Cent ein Luxus, den ich mir nicht leisten konnte. Ich pflegte die drei Gänge deshalb mit meinen Blicken durch das Glas zu verschlingen und holte mir dann in der Bäckerei für einen Nickel, d.h. fünf Cent, zwei Krapfen.« 53
Morgenstern befand sich in den ersten Monaten in New York in einer ähnlichen Situation. Auch er erwähnt in seinen Erinnerungen das griechische Café in der Nähe des Hotel Park Plaza. So heißt es in den Kindheitserinnerungen In einer anderen Zeit : »Ich zog mich schnell an und ging hinunter in das griechische Lokal in meiner nächsten Nachbarschaft, das sich Café Museum nennt und mich an das liebe Café Museum in Wien erinnert, obwohl es mit dem Wiener Café soviel Ähnlichkeit hat wie ein Affe mit einem Menschen.« 54Den Angaben seines Sohnes Dan zufolge war sein Vater in den Jahren seines Hotellebens ein täglicher Gast im Café Museum: »Während er im Hotel lebte, ging er in ein griechisches Restaurant um die Ecke, wo sie genau wußten, was er essen wollte. Es hieß Café Museum, was ein lustiger Zufall war.« 55
Im Jahr 1946 erhielt Morgenstern die amerikanische Staatsbürgerschaft. Nun konnte er seine Frau und seinen Sohn nach New York nachholen, die sich nach der Besetzung Dänemarks durch die deutsche Wehrmacht nach Schweden hatten flüchten können. Doch die Eheleute Morgenstern hatten sich während der langen Trennung auseinandergelebt. »Meine Eltern hatten in ihrer Ehe einige Probleme«, beschreibt ihr Sohn Dan die Situation. 56Morgenstern blieb im Hotel Park Plaza wohnen. Für seine Frau und den Sohn besorgte er eine Wohnung. Erst nachdem er infolge eines Herzanfalls im Jahr 1967 nicht mehr allein im Hotel leben konnte, bezog er wieder eine gemeinsame Wohnung mit seiner Frau, die ganz in der Nähe des Hotel Park Plaza gelegen war. Morgenstern erging es ähnlich wie den meisten der vor der Naziherrschaft geflohenen Emigranten. Sein vordringlichstes Problem in den USA war zunächst ein wirtschaftliches, nämlich seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Dem Journalismus hatte er in der französischen Internierung für immer abgeschworen, wie Alfred Hoelzel in seinem 1989 veröffentlichten Artikel über Morgenstern schreibt. 57Aussagen seines Sohnes Dan zufolge versuchte der Vater zunächst Arbeit zu bekommen. Er war vorübergehend für eine Filmfirma tätig und verfaßte Untertitel für fremdsprachige Filme. Diese Tätigkeit gab er jedoch nach kurzer Zeit bereits wieder auf. 58Er sollte nie wieder einer geregelten Arbeit nachgehen, sondern versuchte nach wie vor, als freier Schriftsteller Fuß zu fassen. Auf der Suche nach einem Verleger für den bereits fertiggestellten zweiten Teil seiner Roman-Trilogie gelangte Morgenstern schließlich an die ›Jewish Publication Society of America‹, die ihm für die geplante Veröffentlichung der Roman-Trilogie einen Vorschuß gewährte und auch die Übersetzung der beiden ersten Teile in die Wege leitete. Zudem übernahm der Verlag die Vorbereitungen für die Veröffentlichung des dritten noch nicht fertiggestellten Romans.
Finanzielle Unterstützung erhielt er zudem durch eine von Deutschland ausbezahlte ›Wiedergutmachungsrente‹, eine Entschädigungszahlung für seine Entlassung aus der Frankfurter Zeitung , die ihm zumindest das tägliche Überleben sicherte. Daneben waren es immer wieder die Freunde, von denen er auch monetäre Hilfe bekam. So zum Beispiel von Dr. Conrad Lester, den Morgenstern 1938 in Paris kennengelernt hatte und der inzwischen ebenfalls in die Vereinigten Staaten emigriert war. In den Jahren 1942 und 1943 lebte Morgenstern in Lesters Haus in Hollywood, wo er den Großteil des dritten und letzten Teils seiner Trilogie fertigstellen konnte.
Im Frühjahr 1943 kehrte Morgenstern nach New York zurück. Die nunmehr vollendete Roman-Trilogie erschien in den Jahren 1946 bis 1950 bei der ›Jewish Publication Society of America‹ in amerikanischer Übersetzung unter dem Gesamttitel Sparks in the Abyss . 59Eine Veröffentlichung der Gesamttrilogie in Deutschland sollte Morgenstern nicht mehr erleben. Lediglich der dritte Band wurde 1963 unter dem Titel Der verlorene Sohn bei Kiepenheuer & Witsch in Köln verlegt, allerdings in einer gekürzten und vom Verlag bearbeiteten Textversion, die dem Werk mehr schadete, als daß sie dazu beitrug, Werk und Autor in Deutschland zu größerer Bekanntheit zu verhelfen. 60Die erste Gesamtausgabe der Trilogie in deutscher Sprache erschien im Jahr 1996 unter ihrem Originaltitel Funken im Abgrund im zu Klampen Verlag als vierter, fünfter und sechster Band der Morgenstern-Werkausgabe.
Wie in seinen Wiener Jahren pflegte Morgenstern auch in New York einen ausgedehnten Freundeskreis, der sich auch hier wie seinerzeit in Wien vorwiegend aus dem Intellektuellenmilieu rekrutierte. Zu Morgensterns amerikanischem Bekannten- und Freundeskreis zählten der namhafte New Yorker Theaterkritiker und Journalist Brooks Atkinson, der New Yorker Zeichner und Karikaturist Al Hirschfeld sowie dessen aus Deutschland stammende Ehefrau, die Schauspielerin Dolly Haas, der aus Rumänien stammende, in England aufgewachsene und seit 1914 in den USA lebende Publizist, Erzähler und Übersetzer Maurice Samuel und der deutsch-amerikanische Publizist, Romancier, Übersetzer und Professor der deutschen Literatur Ludwig Lewisohn, der auch die englische Übersetzung zweier Romane Morgensterns übernahm. Zudem begegnete er in New York auch alten Freunden seiner Wiener Jahre wieder, wie zum Beispiel dem Rezitator Ludwig Hardt, zu dem er bis zu dessen frühen Tod – er starb bereits 1947 im Alter von einundsechzig Jahren – einen engen Kontakt pflegte.
Читать дальше