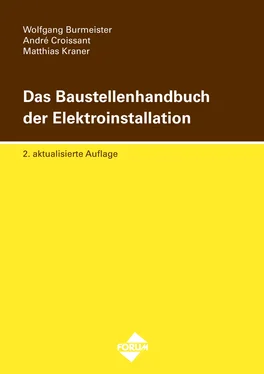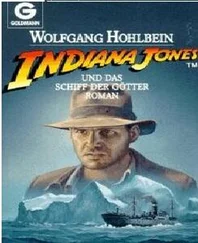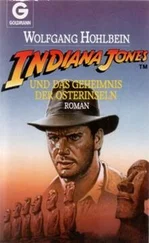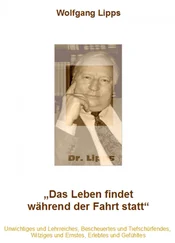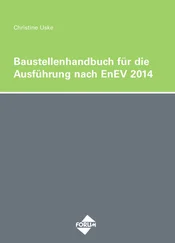Es wird ferner vorausgesetzt, dass jeder, der sich mit der Errichtung oder dem Betrieb elektrischer Anlagen oder von Komponenten hierfür befasst, selbst für die Einhaltung der Anerkannten Regeln verantwortlich ist. Daraus lässt sich z. B. eine Fortbildungspflicht ableiten, denn die Nichteinhaltung dieser Anerkannten Regeln der Technik kann im Schadensfall als fahrlässige Handlung aufgefasst werden.
Anerkannte Regeln der Technik
Die Anerkannten Regeln der Technik sind technische Festlegungen, die von Fachleuten allgemein als richtig betrachtet werden, Fachleuten allgemein zugänglich sind und langfristig erprobt sind.
Eine allgemein gültige Definition oder Zusammenstellung gibt es nicht, da die Dokumente sehr fachspezifisch sind. Allgemein wird angenommen, dass Normen, speziell wenn sie öffentlich erstellt werden, Teil der Anerkannten Regeln der Technik sind. Jedoch ist zu beachten, dass die Erfüllung der Normen nicht gleich bedeutend mit der Einhaltung der
Anerkannten Regeln der Technik sein muss, da diese veraltet sein oder auch Sachverhalte darstellen können, die dem Stand der Technik entsprechen. Jedoch wird davon ausgegangen, dass, wenn ein Errichter die Erfüllung nach Normen nachgewiesen hat, der Betreiber oder Eigentümer der Anlage dem Errichter dann nachweisen muss, dass die Anerkannten Regeln der Technik nicht eingehalten worden sind.
Stand der Technik
Der Stand der Technik stellt den Wissensstand dar, der technisch ausgeführt werden kann. Jedoch sind die Lösungen nicht dauerhaft erprobt (es gibt z. B. Pilotprojekte), oder der Zugriff auf das hierfür nötige Wissen steht nur bestimmten Fachkreisen oder noch nicht allgemein zur Verfügung.
Stand der Wissenschaft und Forschung
Das Wissen über Sachverhalte und für technische Lösungen steht nur Forschern zur Verfügung. Die technischen Lösungen sind experimentell oder rechnerisch nachgewiesen, aber in der Umsetzung nicht erprobt.
Da die Begriffe „Anerkannte Regeln der Technik“, „Stand der Technik“ und „Stand der Wissenschaft“ zum Teil rechtlich festgelegt sind, ist es wichtig, sich für den jeweiligen, spezifischen Fachbereich bei Verbänden, Normenausschüssen Ministerien oder auch Universitäten zu informieren.
Gute Informationsquellen über den aktuellen Stand des Regelwerks bieten:
• Bundestechnologiezentrum für Elektro- und Informationstechnik (bfe)
• Bauministerkonferenz ( http://www.is-argebau.de/?x=1400O)
• www.voltimum.de
Niederspannungsanschlussverordnung
Beruhend auf dem Energiewirtschaftsgesetz wurde 2006 die Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) als „Verordnung über allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die Elektrizitätsversorgung in Niederspannung“ erlassen. Die NAV legt fest, dass für die elektrische Anlage ab dem Zähler der Anschlussnehmer verantwortlich ist. Die Anlage muss nach Gesetz, Verordnungen und den Anerkannten Regeln der Technik errichtet und betrieben werden. Die Installation darf durch den Versorger oder durch Installateure, die in einer Liste des Versorgers aufgenommen sind, ausgeführt werden. Alle eingesetzten Geräte müssen nach § 49 des Energiewirtschaftsgesetzes nach den Anerkannten Regeln der Technik gefertigt sein. Führen diese Geräte ein VDE-, GS-, oder CE-Zeichen wird angenommen, dass die Geräte diese Anforderungen erfüllen. Die Inbetriebnahme der elektrischen Anlage muss dem Versorger angezeigt werden, dies betrifft auch alle Geräte ab einer bestimmten Leistung oder der Möglichkeit einer Netzrückwirkung. Der Versorger kann die elektrische Anlage prüfen, und er kann Anschlussbedingungen (TAB = Technische Anschlussbedingungen) erlassen. Auf den Webseiten der Versorger können die TAB in der Regel heruntergeladen werden.
Technische Anschlussbedingungen
Die Technischen Anschlussbedingungen der Versorger regeln den Anschluss an das Nieder- oder Mittelspannungsnetz. Nachfolgend wird als Beispiel die TAB 2011 Mittelspannung und die TAB Niederspannung der Süwag Netz GmbH vorgestellt.
TAB Mittelspannung
Die TAB Mittelspannung hat zwei Bereiche, die aufgrund der sinkenden Versorgungssicherheit sowie der momentanen Diskussion über die Veränderung der Stromversorgung zukünftig im gewerblichen Bereich stark an Bedeutung gewinnen werden, weswegen neben der kundeneigenen Mittelspannungseinspeisung hier auch verstärkt die Eigenerzeugung behandelt wird.
Die TAB Mittelspannung regelt die Abnahme durch eine kundeneigene Anlage bzw. die Einspeisung durch den Kunden. Folgende Richtlinien des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) gelten hierbei übergeordnet:
• BDEW „TAB Mittelspannungsnetz“ (Mai 2008)
• BDEW „Erzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz“ (Juni 2008)
In den Mittelspannungsbereich fallen Erzeugungsanlagen mit einer maximalen Scheinleistung je Übergabestation, die größer als 100 kVA sind.
Der Kunde ist für die Einhaltung der technischen Anschlussbedingungen, des Regelwerks und der Richtlinien verantwortlich. Für die Anmeldung, den Aufbau und den Betrieb einer kundeneigenen Anlage sind folgende Unterlagen notwendig:
• Meldung der Geräte, die eine Netzrückwirkung verursachen könnten, dies sind z. B.:
– Motoren ab S ≥ 50 kVA,
– Schweißmaschinen, Pressen, Sägen ab S ≥ 20 kVA,
– Stromrichter, Schmelzöfen ab S ≥ 60 kVA.
• Errichtungsplanung, d. h. eine Zusammenstellung aller Projektunterlagen (Pläne, Berechnungen, Ausführungsdetails, Einstellungen, Fabrikate)
• Austausch der Kontaktdaten der Ansprechpartner zwischen Netzbetreiber und Anschlussbetreiber
• Anschlussnutzungsvertrag
• Versorgungsmitteilung des Stromlieferanten an der Entnahmestelle des Netzbetreibers
Die Anbindung der kundeneigenen Anlage erfolgt in der Regel über eine einfache Stichanbindung. Dies kann z. B. aus Gründen der Versorgungssicherheit auch in anderer Form erfolgen. Die Anschlusskosten trägt der Kunde. Dies betrifft auch die Verlegung des Verbindungskabels von der Netzstation zur Mittelspannungsschaltanlage im Umspannwerk. Die Eigentumsgrenze sind die Kabelendverschlüsse der Kabel. Ferner ist vom Kunden eine Tonfrequenzrundsteuerung vorzusehen.
In den TAB werden detailliert alle Daten gegeben, die für die Auslegung der Anlagen für den Netzanschluss von Bedeutung sind. Beispiele hierzu werden im Kapitel Stromversorgung gezeigt.
Für die Einspeisung durch kundeneigene Erzeugungsanlagen sind folgende Unterlagen notwendig:
• Je nach Datum gelten unterschiedliche technische Anforderungen, die im Einzelnen geprüft werden müssen. Besonders viele Regelungen betreffen hier die Windenergieanlagen.
• Antragstellung mit Vordruck, sofern auch eine Übergabestation errichtet werden muss
• Lageplan
• Datenblatt einer Erzeugungsanlage
• Einheitenzertifikat je nach Datum
• Anlagenzertifikat bei Anlagen mit Anschlussleistung > 1 MVA und/oder einer Anschlussleitungslänge > 2 km je nach Datum und für Windenergieanlagen generell
• Inbetriebsetzungsprotokoll für die Übergabestation mit Anwesenheit des Netzbetreibers (Einladung mindestens 14 Tage vor Inbetriebsetzung)
• Inbetriebsetzungsprotokoll für die Anschlussanlage (Erzeuger) mit Anwesenheit des Netzbetreibers (Einladung mindestens 14 Tage vor Inbetriebsetzung)
• Inbetriebsetzungsprotokoll für Erzeugungseinheiten (Anwesenheit des Netzbetreibers ist nicht erforderlich)
Das Einheitenzertifikat, Sachverständigengutachten und Anlagenzertifikat sind nach FGW TR8 (Fördergesellschaft Windenergie und andere erneuerbare Energien, Technische Richtlinie für Erzeugereinheiten und -anlagen „Zertifizierung der Elektrischen Eigenschaften von Erzeugereinheiten und -anlagen am Mittel-, Hoch- und Höchstspannungsnetz“, Teil 8) anzufertigen.
Читать дальше