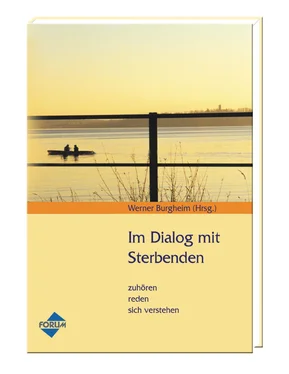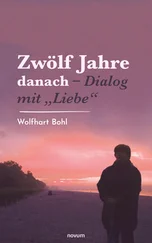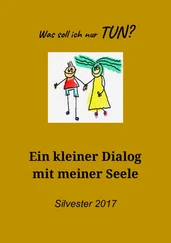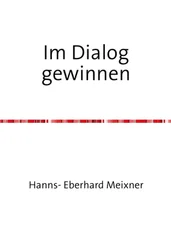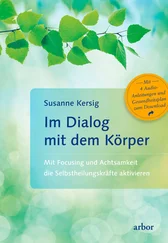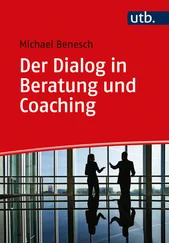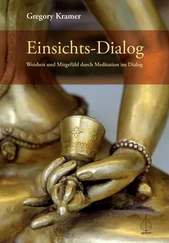Unterschiedliche Kommunikationsstile
Daraus resultiert die systematische Darstellung von acht deutlich unterschiedenen Kommunikationsstilen. Der Band richtet sein Augenmerk auf die Unterschiede zwischen den Menschen und empfiehlt angemessene Schritte zur persönlichen Entwicklung.
Von besonderem Interesse für helfende Berufe ist hierbei der „helfende Stil”. Die Grundpose (Schulz von Thun, 1989, S. 76) stellt sich demnach wie folgt dar.

Abb. 8: Der helfende Stil
Die „hilflosen Helfer“
Demnach wären Status, Rolle, Position zwischen starkem Helfer und schwachem Patienten klar verteilt. Dass dem nicht so ist, hat Wolfgang Schmidtbauers (1977) Studie über die „hilflosen Helfer” (Schlagwort: „Helfersyndrom”) schon lange belegt. Damals wie heute waren und sind die Angehörigen der sozialen Berufe über die Ergebnisse überrascht und betroffen.
Eine sehr praxisbezogene – und an Alltagssituationen beispielhaft verdeutlichte – Loseblattsammlung (zuletzt im Dezember 1999 aktualisiert) legt Antje Czerwinski vor, mit der sie „schwierige Mitarbeitergespräche in der Alten- und Krankenpflege effektiv vorbereiten, erfolgreich durchführen” (so der Titel der Publikation) will.
Empfehlenswert ist auch der Beitrag von Ulrike Oster (2000).
Literatur
Argyle, M.; 1996: Körpersprache & Kommunikation; Paderborn: Junfermann Verlag.
Baumann, R., Reifenberg, P. & Weber, M. (Hrsg.) 2000; Kommunikation mit Schwerstkranken und Sterbenden; Mainz: Mainzer Hospizgesellschaft Christopherus e. V.
Bourne, L.E. & Eckstrand, B. R. 1997: Psychologie; Eschborn: Klotz
Brater, M. 2001: Die Sprache der Verwirrten. I. Teil: Zum Verständnis gerontopsychiatrisch veränderter alter Menschen; in: die Drei. S. 8 – 9 und S. 31 – 46
Brommer, U. 1994: Konfiktmanagement statt Unternehmenskrise. Zü-rich; Orell Füssli Verlag
Burgheim, W. 2003: Didaktik der Krisenpädagogik. Lehren und Helfen als Bildung / Kunst; Aachen, Shaker-Verlag
Cornell, A. W. 1997: Focusing – Der Stimme des Körpers folgend; Reinbek: Rowohlt
Czerwinski, A. 1999: Schwierige Mitarbeitergespräche in der Alten- und Krankenpflege effektiv vorbereiten, erfolgreich durchführen; Kissing: WEKA Fachverlag für Behörden und Institutionen.
Deutsch, F. , Le Baron, D. & Fryer, M. M. 1991: Was bedeutet ein Lä-cheln?; in: Report Psychologie 8, S. 21 – 28
Feurstein, H. J. , Müller, D. & Weiser - Cornell, A. 2000: Focusing im Prozess; Köln: GwG-Verlag
Gendlin, T. E. 1981. Focusing. Technik der Selbsthilfe bei der Lösung persönlicher Probleme; Salzburg: Otto Müller
Hausmann, B. & Neddermeyer, R. 1996: Bewegt sein. Integrative Bewegungs- und Leibtherapie in der Praxis; Paderborn: Innfermann
Hermann, J. 2000: „Die Koffer sind gepackt”. Von der Symbolsprache sterbender Menschen; in: Baumann, R. Reifenberg, P. & Weber, M. (Hrsg.) 2000: Kommunikation mit Schwerstkranken und Sterbenden; Mainz: Mainzer Hospizgesellschaft Christopherus e. V., S. 35
Hofmann, R. 1995: Vom Wert des Zuhörens; in: Heilberufe. 47. S. 26 – 28
Kalckreuth v. E. 2001: Auf dem Weg mit Sterbenden. Alles hat seine Zeit; Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag
Klessmann, M. 1994: Die Sprache der Sterbenden; in: Pflegezeitschrift. 47. S. 168 – 173
Koser-Fischer, T. 2000: Wenn Worte nicht mehr (er)reichen. Möglichkeiten und Grenzen nonverbaler Kommunikation; in: Baumann, Reifenberg & Weber (Hrsg.) Mainz: Mainzer Hospizgesellschaft Christopherus e. V. S. 47 – 57
Kübler-Ross, E. 1990: Verstehen, was Sterbende sagen wollen; Stuttgart: Kreuz-Verlag
Magar, E. M. & Frieling, H. 2000: Ein christliches Gütesiegel. Der Leitbildprozess in der St. Elisabeth Stiftung Dernbach; Waldbreitbach: Maria Hilf GmbH, S. 95 – 101
Mayer, H. 2001: Nonverbale Kommunikation. Was kann sie uns sagen?; in: Endlich leben. Editorial; Neunkirchen (A): Internationale Gesellschaft für Sterbebegleitung und LebensbeIStand
Mennenmann, H. 1998: Sterben lernen heißt leben lernen: Sterbebegleitung aus sozialpädagogischer Perspektive; Münster: LIT
Nothdurft, W. 2000: Zwischenmenschliche Kommunikation II: Kommunikative Kompetenz; Hrsg.: Zentralstelle für Fernstudien an Fachhochschulen – ZFH; Koblenz: ZFH.
Oster, U. 2000: „Verstehen Sie, was ich meine?” Grundsätzliches über die zwischenmenschliche Kommunikation; in: Baumann, Reifenberg & Weber (Hrsg.) Mainz: Mainzer Hospizgesellschaft Christopherus e. v. S. 9 – 22
Rhein-Zeitung. Journal. 22.09.2001. S. 801
Schmidtbauer, W. 1977: Die hilflosen Helfer; Reinbek: Rowohlt
Schulz von Thun, 1989: Miteinander reden 2: Stile, Werte und Persönlichkeitsentwicklung. Differenzielle Psychologie der Kommunikation; Reinbek: Rowohlt
Schulz von Thun, 1998; Miteinander reden 3: Das „Innere Team” und situationsgerechte Kommunikation; Reinbek: Rowohlt
Schulz von Thun, F. 1984: Miteinander reden 1: Störungen und Klärungen. Allgemeine Psychologie der Kommunikation; Reinbek: Rowohlt
Watzlawick, P. , Beavin, J.-H. & Jackson, D. D. 1990: Menschliche Kom-munikation; Bern: Huber.
Weber, M. 2000: Wahrheit und Hoffnung. Was kann, was darf der unheilbar Kranke vom ärztlichen Gespräch erwarten?; in: Baumann, Reifenberg & Weber, M. (Hrsg.) 2000: Kommunikation mit Schwerstkranken und Sterbenden; Mainz: Mainzer Hospizgesellschaft Christopherus e.V. S. 23 – 34
Zwierlein, E. 2000: Leitbild und Mitarbeiter-Umfrage – Kein Tag der Rache, sondern eine wunderbare Chance; in: Magar, E. M. & Frieling, H. 2000: Ein christliches Gütesiegel. Der Leitbildprozess in der St. Elisabeth Stifung Dernbach; Waldbreitbach: Maria Hilf GmbH, S. 138 – 143
1Die folgenden Ausführungen stellen eine leicht veränderte, aber stark gekürzte Fassung meines Beitrags im Rahmen des Fernstudiums Sozialkompetenz dar; Herausgeber: Zentralstelle für Fernstudien an Fachhochschulen – ZFH – Hofmann 2000. S. 12 – 21.
Die Symbolsprache Sterbender
Carola Otterstedt
Definition Wirklichkeit
Was ist Wirklichkeit, was ist Phantasie? In der Definition von Wirklichkeit orientieren wir uns zunächst am sozialen Miteinander: Was viele als wirklich ansehen, das muss wohl auch wirklich sein. Es gibt somit einen Konsens von Wahrnehmungen, der durch langwierige Interaktionen sich immer wieder neu entwickelt. Es besteht keine feste Objektivität, denn aufgrund veränderter sozialer Situationen und sozialem Miteinander verändert sich auch die Wahrnehmung des Einzelnen und die Wirklichkeit der sozialen Gemeinschaft. 1Neben der Wirklichkeit , welche mit der eigenen und sozialen Erlebniswelt verglichen wird, gibt es auch die Illusion , welche wir z. B. in Träumen, Halluzinationen erleben können.
Definition Illusion
Eine Halluzination ist eine Wahrnehmung mit Realitätscharakter unter Einbeziehung einzelner bzw. mehrerer Sinne. Aber wie können Halluzinationen als wahrhaftig erlebt werden, wenn doch die Umwelt sie nicht wahrnehmen, dadurch oft nicht annehmen, akzeptieren kann? Eben weil wir unsere individuell erlebte Wirklichkeit immer auch mit der unserer sozialen Umwelt vergleichen und im Fall einer Halluzination notwendigerweise eine Differenz im Erleben unserer Wirklichkeit erfahren, führen Halluzinationen auch immer zu einer physischen, psychischen, mentalen und sozialen (mitunter auch spirituellen) Irritation in uns. Diese Irritation hat eine unmittelbare Wirkung auf unser Ich -Bewusstsein und unser Selbstvertrauen: Habe ich wirklich einen schwarzen Raben auf meinem Bettholm sitzen gesehen? Vielleicht war es ja nur ein dunkler Schatten?
Читать дальше