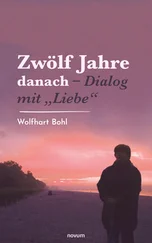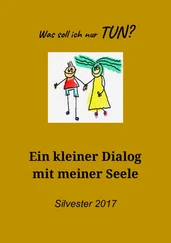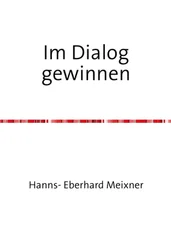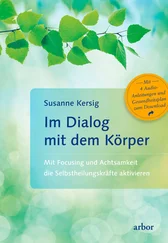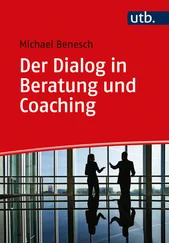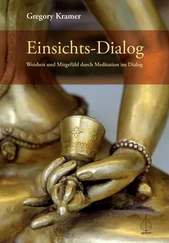Frage nach der örtlichen Hospizgruppe
Mit dem Angebot einer palliativen Medizin erhält der Sterbenskranke die Hoffnung auf relative Schmerzfreiheit und damit eine zu ertragende Lebensqualität. Hinzu kommen die o. g. professionellen oder auch ehrenamtlich ausgebildeten Hospizhelfer, die entsprechend den Definitionen der Bundesarbeitsgemeinschaft Hospiz eine qualifizierte Bildungsmaßnahme im Umgang mit Sterben, Leid und Trauer erfahren haben. Eine gezielte Hilfestellung für Angehörige oder beruflich Interessierte ist deshalb die Frage nach der örtlichen Hospizgruppe, die ehrenamtlich zur Seite stehen kann. Als Ansprechpartner für die Vermittlung steht als Dachverband die Bundesarbeitsgemeinschaft Hospiz (BAG) und als ebenfalls überregionaler Verein die Internationale GeselIschaft für Sterbebegleitung und Lebensbeistand e. V. (IGSL) zur Verfügung. 1
Wo? Wann? Wie? Was? Warum?
Gezielte Hilfestellung kann aber auch die Vorbereitung auf schwierige Gespräche darstellen, bei der die Beantwortung der fünf W-Fragen: Wo?, Wann?, Wie?, Was?, Warum? sehr hilfreich ist.
Wo soll das Gespräch stattfinden? Liegt der Sterbenskranke in einem Einzelzimmer? Wenn nicht, können Sie ihm einen anderen Raum zur Verfügung stellen, sodass Intimität und dennoch Distanz gewahrt bleibt?
Das Thema sterbenskrank ist intimer als die Sexualität, da es die Endlichkeit so greifbar macht, dass es kein Entrinnen gibt. Es zeigt den Menschen hilflos und entblößt.
Wann: Es ist wichtig zu wissen, welchen Tagesrhythmus der Sterbenskranke hat, zu welchen Zeiten er der Ruhe bedarf, wie die schmerztherapeutische Einstellung ist, sodass Sie schmerzfreie Intervalle für Gespräche nutzen.
Wenn Schmerzen das Denken des Kranken beherrschen, ist kein Gespräch möglich. Erst der Sieg über die Schmerzen lässt Menschen auch wieder an andere, für ihn lebenswichtige Dinge denken.
Wie gestalten Sie das Gespräch, welche Atmosphäre müssen Sie herstellen, wie viel Nähe braucht der Sterbende, aber auch wie viel Distanz?
Der Balanceakt von Nähe und Distanz
Der Balanceakt von Nähe und Distanz ist ein besonders wichtiger Parameter, wenn es um gelungene Gesprächsführung geht. Zu viel Nähe kann erdrücken und dem Gegenüber buchstäblich die Luft wegnehmen, ihn ausweglos ausliefern an den Hospizhelfer und den Sterbeprozess. Nur ein Gesprächsteilnehmer, der dem Sterbenskranken seinen Raum lässt, seine Selbstbestimmtheit auch in dieser Phase des Lebens lässt, hat den Auftrag der Begleitung verstanden. Zu viel Distanz heißt den Weg nicht mitgehen, lässt den Erkrankten spüren: „Der ist nicht bei mir.“ Hier zählt vor allem das Prinzip der Authentizität. Sterbenskranke sind sensibel, geradezu empfindlich – sie haben ja auch nichts mehr zu verlieren im Leben außer ihr Leben selbst und so erlauben sie sich eine kritische Haltung dem Gesprächsteilnehmer gegenüber, die für alle Beteiligten aber auch fruchtbar ist.
Was sage ich in dieser Phase? Wie viel Wahrheit wurde vermittelt? Was hat der Erkrankte verstanden?
Unter Einhaltung der Schweigepflicht muss das multidisziplinäre Team einen engen Austausch führen, da der Sterbenskranke sich in einer ambivalenten Situation zwischen nicht wissen der Wahrheit über seine Krankheit einerseits und nicht wahrhaben wollen der Wahrheit andererseits befinden kann.
Vermittlung von Wahrheit
Die Vermittlung von Wahrheit kann auch in der Übung von aktivem Zuhören bestehen. Möglicherweise müssen Sie aber auch alle Ihre Sinne brauchen und gebrauchen, um Wahrheit so zu vermitteln, dass auch Hoffnung in dieser Lebensphase zum Aushalten können führt.
Warum ist die Auseinandersetzung mit der „tödlichen“ Wahrheit so wichtig? Ist nicht das Verschweigen menschlicher und weniger leidvoll für alle Beteiligten? Das ist die häufigste Frage an Hospizhelfer.
Kranke nehmen sich von der Wahrheit so viel wie sie ertragen können
Vor der Aufnahme in ein stationäres Hospiz wird immer die Frage der Wahrheit thematisiert und so manches Mal auch dann erst richtig erörtert. Die Erfahrung aller hospizlich Handelnden zeigt recht eindeutig, wie wichtig die Auseinandersetzung mit eben dieser Wahrheit für den Sterbenskranken ist. Denn nur diese Konfrontation eröffnet ihm den Weg, für sich zu klären, was es noch zu klären gibt: Dinge zu ordnen, sich zu verabschieden und auch loszulassen. Diese Möglichkeit wird durch Sätze wie: „Das wird schon wieder“ genommen. Kranke nehmen sich von der Wahrheit so viel, wie sie ertragen können. Es gibt genug Beispiele von Verdrängungsmechanismen, obwohl der Arzt sehr deutlich vom streuenden Tumor, der unaufhaltsam Besitz ergreift, gesprochen hat. In dieser Situation ist es nicht die Aufgabe des Hospizhelfers, die Wahrheit zu wiederholen, sondern er hat die Aufgabe des Zuhörens, des Begleitens bei der Wut, beim Verdrängen, bei Depressionen ebenso wie in euphorischen Phasen. Und irgendwann wird sie wieder zugelassen – die Wahrheit. Da gilt es zuzuhören, aufzunehmen und sie zu sagen.
Sie eröffnen dem Sterbenskranken damit den Weg, sich selbst Fragen wie: Was will ich noch?, Wie will ich es? und Wer soll da sein? zu stellen, denn diese Fragen sind ebenso drängend wie Lebensbilanzierungen und Ordnung (wie Testament und Patientenverfügung). Somit erscheint das Warum? als eine zerbrechliche Frage, denn auf diese Frage ist keine eindeutige Antwort möglich.
1. Beispiele für Gesprächsführung
Die folgenden Beispiele können nur als Versuch der Beschreibung von Gesprächsverläufen mit Sterbenskranken angesehen werden. Sie beruhen auf Erfahrungswerten und können je nach persönlicher Situation sowohl des Kranken als auch des Begleiters unterschiedlich verlaufen. Deshalb kann der Leser hier keine allgemein gültige und gelungene Anleitung für Gesprächssituationen erwarten.
Die folgenden Beispiele werden mit der vorangestellten These untermauert, die die derzeitige Realität im Umgang mit Sterbenskranken widerspiegelt:
These
Die Individualität des Sterbenskranken und seine soziale Integration zwingen Begleiter, Kommunikation und Interaktion zu überprüfen, um im Umgang mit Sterbenskranken hinzuzulernen.
Respektvolle Nähe
Unter Einbeziehung der fünf Ws könnte eine Gesprächssituation wie folgt aussehen:
Grundvoraussetzung ist immer: Der Sterbenskranke und seine Situation stehen im Vordergrund, und es gilt das Überbringen der schlechten Nachricht einzubetten. Das meint, dass der Betreffende großes Einfühlungsvermögen zeigen muss. Durch das Verbalisieren emotionaler Erlebnisinhalte (VEE), gepaart mit aktivem Zuhören, kann eine Nähe aufgebaut werden, in der sich der Sterbenskranke wohl fühlt und seine Ängste respektiert weiß.
Zeit und Raum berücksichtigen
Unter Einbeziehung der Angehörigen und der Berücksichtigung von Raum und Zeit ist der Überbringer von schlechten Nachrichten in der Pflicht, die Wahrheit dem Sterbenskranken in der Form näher zu bringen, dass entsprechend der These seine Individualität, seine vorangegangene Lebenswelt (soziale Integration) und seine jetzige Situation berücksichtigt werden.
Dabei steht die Persönlichkeit des Sterbenskranken in engem Kontext zur Herkunft und seinem Umfeld.
D. h.:
 Atmosphäre schaffen durch gezielte Suche einer Räumlichkeit, die Intimsphäre und ein Stück „Wohnzimmer” vermittelt.
Atmosphäre schaffen durch gezielte Suche einer Räumlichkeit, die Intimsphäre und ein Stück „Wohnzimmer” vermittelt.
 Unterstützung suchen durch Nahestehende, die den Sterbenskranken auffangen können.
Unterstützung suchen durch Nahestehende, die den Sterbenskranken auffangen können.
Wie viel Wahrheit braucht die Wahrheit
Читать дальше
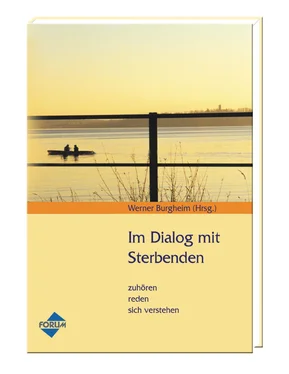
 Atmosphäre schaffen durch gezielte Suche einer Räumlichkeit, die Intimsphäre und ein Stück „Wohnzimmer” vermittelt.
Atmosphäre schaffen durch gezielte Suche einer Räumlichkeit, die Intimsphäre und ein Stück „Wohnzimmer” vermittelt.