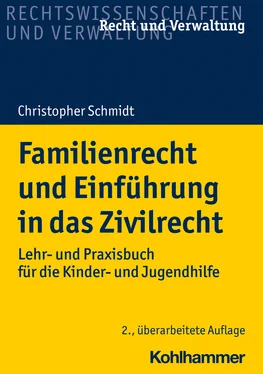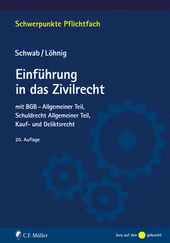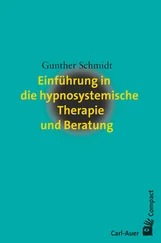II.Unterscheidung zwischen materiellem Recht und Prozessrecht
21Inhaltlich können wir die Rechtsnormen in solche des materiellen Rechts und des Prozessrechts unterscheiden.
22 Materiell-rechtliche Normenregeln inhaltliche Rechte und Pflichten für die jeweils vom Geltungsbereich der Norm Betroffenen. Dies gilt z. B. für das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB), das Gesetz über die eingetragene Lebenspartnerschaft (LPartG), das Gesetz über den Versorgungsausgleich (VersAusglG) und das Gesetz zum zivilrechtlichen Schutz vor Gewalttaten und Nachstellungen (GewSchG).
23Demgegenüber betrifft das Prozessrechtdie vor Gericht geltenden „Spielregeln“, also die Organisation der Gerichte und die Durchführung von Gerichtsverfahren. Beispiele sind insoweit das Gerichtsverfassungsgesetz (GVG), das Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) und die Zivilprozessordnung (ZPO).
III.Methodik der Rechtsauslegung
24Wenn wir eine Rechtsnorm gefunden haben, von der wir vermuten, dass sie uns im konkreten Fall anwendbar sein könnte, müssen wir zunächst ihren Sinn erfassen. Das geschieht durch Auslegung. Für diese Rechtsauslegung kennen die Juristen verschiedene Methoden: die sprachlich-grammatikalische Auslegung, die systematische Auslegung, die historische Auslegung und die teleologische Auslegung. Diese sollen im Folgenden kurz dargestellt werden.
25Ausgangspunkt einer jeden Auslegung ist dabei zunächst der Wortlautder Norm, 4also die sprachlich-grammatikalische Auslegung. Für die Bedeutung der Wörter sind Legaldefinitionen, also Definitionen durch das Gesetz selbst, vorrangig heranzuziehen. Ein Beispiel für eine solche Legaldefinition ist § 1567 Abs. 1 S. 1 BGB: Danach leben Ehegatten getrennt, wenn zwischen ihnen keine häusliche Gemeinschaft besteht und ein Ehegatte sie erkennbar nicht herstellen will, weil er die eheliche Lebensgemeinschaft ablehnt. Wenn nun §§ 1361 ff., 1565 Abs. 2, 1566 BGB von einem Getrenntleben der Ehegatten sprechen, ist insoweit § 1567 Abs. 1 BGB heranzuziehen.
26In vielen Fällen enthält das Gesetz aber keine Legaldefinition. Dann ist bei juristischen Fachausdrücken der Sprachgebrauch der Juristen, im Übrigen der allgemeine Sprachgebrauch zugrunde zu legen. 5
27Soweit der Wortlaut uns zu einem eindeutigen Ergebniskommen lässt, ist eine andere Auslegung nur in Ausnahmefällen möglich.
28Die systematische Auslegungfragt demgegenüber, in welchem Zusammenhang eine Rechtsnorm steht. Dies wird teilweise schon dadurch erkennbar, dass man einige Normen vor bzw. nach der in Betracht kommenden Vorschrift durchsieht. Auch der Titel des entsprechenden (Unter-)Abschnitts im Gesetz kann Aufschluss über den Regelungsgehalt geben. Weiter sind Wertungswidersprüche zu gleich- oder höherrangigem Recht grundsätzlich zu vermeiden.
29Unterfälle der systematischen Auslegung sind die verfassungskonforme Auslegung bzw. die unions- oder richtlinienkonforme Auslegung.
30Die verfassungskonforme Auslegungbedeutet, dass bei mehreren möglichen Auslegungsergebnissen dasjenige anzuwenden ist, bei dem die Rechtsnorm mit der Verfassung in Einklang steht. 6
31Die unions- bzw. richtlinienfonforme Auslegunggeht dahin, dass nationales Recht, insbesondere wenn es zur Umsetzung einer Richtlinie der EU erlassen wurde, so auszulegen ist, dass eine größtmögliche Wirksamkeit des EU-Rechts erreicht wird.
32Die historische Auslegungfragt nach der Entstehungsgeschichte, also nach dem vom seinerzeitigen Gesetzgeber befolgten Zweck. In vielen Fällen finden sich dazu Hinweise in den sog. Materialien, also Gesetzesbegründungen oder Parlamentsprotokollen.
33Zuletzt geht die teleologische Auslegungdavon aus, dass der auszulegenden Norm ein objektiver Sinn und Zweck innewohnt. Dieser ist zu ermitteln, wobei die Norm als Teil einer gerechten und zweckmäßigen Ordnung begriffen wird. 7Das ist freilich nicht unproblematisch, denn die Frage, was gerecht und zweckmäßig ist, mag auch unter Heranziehung der grundsätzlichen Wertentscheidungen der Verfassung durchaus unterschiedlich beurteilt werden.
34Bei der Auslegung verschiedener Rechtsnormen kann man zu widerstreitenden Ergebnissen kommen. Dann stellt sich ähnlich wie im Straßenverkehr die Frage nach der „Vorfahrt“, die wir in diesem Zusammenhang als Konkurrenz bezeichnen: Welche Vorschrift ist gegenüber der anderen vorrangig, wenn eine gleichzeitige Anwendung beider Normen ausscheidet?
35Hier können wir zunächst auf die bereits dargestellte NormenhierarchieBezug nehmen: Wenn es sich um Rechtsnormen unterschiedlicher Ordnung handelt, ist stets das höherrangige Recht anwendbar. Daraus folgt ein grundsätzlicher Vorrang des Europarechts, sodann des Verfassungsrechts auf Bundesebene, also des Grundgesetzes, der einfachen Bundesgesetze und der (Bundes-)Rechtsverordnungen. Erst danach kommen das Verfassungsrecht der Länder, deren einfache Gesetze und Rechtsverordnungen bzw. (kommunales) Satzungsrecht zur Anwendung.
36Handelt es sich um Normen gleicher Ordnung, besteht eine Auslegungsregel, nach der die speziellere VorschriftVorrang vor den allgemeineren hat (lex specialis derogat legi generali). Hintergrund ist die Vermutung, dass der Normgeber den enger gefassten Sachverhalt im Sinne eines Regel-Ausnahme-Verhältnisses hat anders regeln wollen. Ein Beispiel dafür ist, dass die Vorschriften des allgemeinen Teils eines Gesetzes (z. B. §§ 1–240 BGB) nur insoweit gelten, als sich im Besonderen Teil (z. B. §§ 241 ff. BGB) keine abweichenden Vorschriften finden.
37Nach einem weiteren Grundsatz geht die jüngere Vorschriftden älteren vor (lex posterior derogat legi priori), denn insoweit wird vermutet, dass der Normgeber den betreffenden Sachverhalt nach neuem Recht abweichend regeln wollte.
38Keine Konkurrenz liegt demgegenüber vor, wenn bereits durch ein Gesetz selbst klargestellt wird, dass andere Vorschriften vorrangig sind. Denn dann ist der Anwendungsbereich des nachrangigen Gesetzes bereits nach dessen Wortlaut nicht eröffnet.
V.Analogie und Umkehrschluss
39In einigen Fällen führt die Anwendung der bestehenden Rechtsnormen zu ungerechten Ergebnissen, weil der Gesetzgeber schlicht übersehen hat, einen vergleichbaren Sachverhalt entsprechend zu regeln. In diesen Fällen kann eine Norm analogiefähig sein, das heißt: Man wendet eine Vorschrift, die eigentlich nicht „passt“, weil es nämlich an einer Voraussetzung fehlt, dennoch an.
40Voraussetzung einer Analogieist zunächst eine planwidrige Regelungslücke. Denn wenn der Gesetzgeber unterschiedliche Sachverhalte bewusst unterschiedlich geregelt hat, muss das bereits wegen des Grundsatzes der Gewaltenteilung hingenommen werden. Der Rechtsanwender darf also Wertungen des Gesetzgebers nicht über eine Analogie korrigieren.
41Weiter muss die Interessenlageim konkreten Lebenssachverhalt derjenigen in dem ausdrücklich geregelten Fall vergleichbarsein.
Beispiel:
In § 1568 Abs. 1 Alt. 1 BGB finden wir eine Härteklausel, nach der eine Ehe nicht geschieden werden soll, obwohl sie gescheitert ist, wenn und solange ihre Aufrechterhaltung im Interesse der aus der Ehe hervorgegangenen minderjährigen Kinder aus besonderen Gründen ausnahmsweise notwendig ist. Diese Regelung gilt für leibliche und Adoptivkinder gleichermaßen. Für die der Scheidung vergleichbare Aufhebung der eingetragenen Lebenspartnerschaft besteht eine solche Härteklausel dagegen in § 15 Abs. 3 LPartG nicht. Fraglich ist daher, ob § 1568 Abs. 1 Alt. 1 BGB insoweit analog angewendet werden kann.
Читать дальше