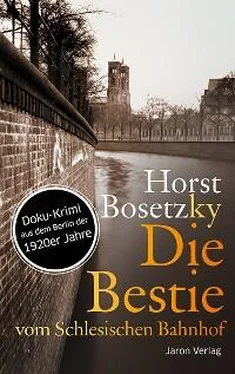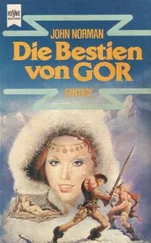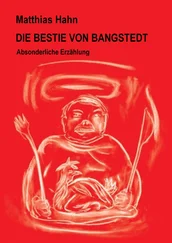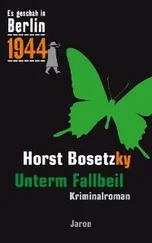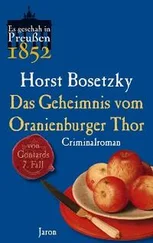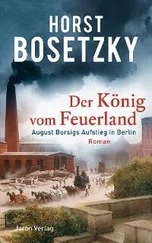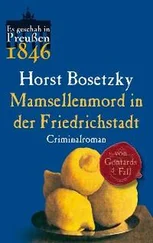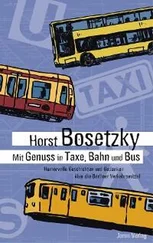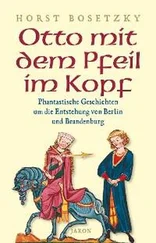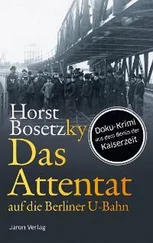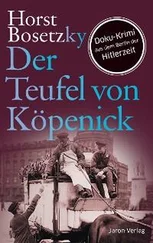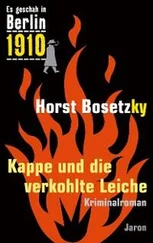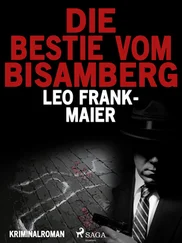Weiter konnte Richard Jerxheimer die Szene leider nicht verfolgen, denn in diesem Augenblick kam Gustav Witzke die Treppe herunter, und nun hatten die geschäftlichen Dinge absolut Vorrang. Der dicke Witzke freute sich, dass er seinen geänderten Anzug gratis ins Haus geliefert bekam, und versprach, in seinem großen Bekanntenkreis für den Händler zu werben. Zufrieden lief Jerxheimer wieder nach Hause.
»Hallo, Papa, da bist du ja endlich!«, rief Sarah. Überraschend früh war seine Tochter heute nach Hause gekommen. Im Hotel Excelsior hatte es nicht viel zu tun gegeben, und da hatte man sie ein paar Stunden früher nach Hause geschickt. Sie setzte das Teewasser auf, und bald saßen sie plaudernd in der guten Stube. Zuerst ging es um den gescheiterten Putsch, doch dann musste Sarah noch etwas anderes loswerden: »Du, ich glaube, ich habe heute früh Fritzi Massary gesehen, bei uns am Anhalter Bahnhof.«
Wie sehr verehrte Sarah die Massary, den großen Operettenstar aus Österreich! 1904 hatte sie noch nicht im Metropol-Theater sitzen können, als Fritzi Massary mit ihrem berühmten Chanson Im Liebesfalle, da sind sie nämlich alle ein bisschen trallala Berlin eroberte. Doch seit sie die Diva zum ersten Mal auf der Bühne erlebt hatte, 1917, mitten im Krieg, in Die Rose von Stambul, war sie ein ausgemachter Fan. Noch vor kurzem hatte sie die Schauspielerin in Oscar Straus’ Der letzte Walzer und in Leo Falls Die spanische Nachtigall im Berliner Theater in der Charlottenstraße bewundert. Doch nun hatte Sarah zu ihrem Bedauern gehört, dass die Massary und ihr Mann, der Charakterschauspieler Max Pallenberg, mit Max Reinhardt nach Österreich gehen wollten.
»Auch da gibt’s keinen Kaiser mehr«, sagte Jerxheimer.
»Wenigstens ist uns der Kapp erspart geblieben.« Sarah war froh, dass es in Deutschland keinen Bürgerkrieg gegeben hatte.
»Aber sie haben so viele Offiziere ins Wasser geschmissen.« Jerxheimer kam gar nicht mehr los von diesen Bildern. »Was haben wir uns das damals gewünscht, auf dem Kasernenhof, als sie uns geschurigelt haben! Doch so was dann wirklich zu machen, ist doch etwas ganz anderes.«
»Es war ’ne Gegenrevolution.« Den Begriff hatte Sarah im Hotel gehört. »Und auch ’ne Gegenrevolution ist ’ne Revolution – und bei ’ner Revolution, da … da …« Sie kam nicht auf den richtigen Vergleich, und ihr Vater brachte den Satz zu Ende.
»… da geht’s nicht zu wie im Mädchenpensionat. Recht haste.« Jerxheimer blickte auf die Uhr. »Nu, was hältste davon, dass wir noch ’nen kleinen Abendspaziergang machen?«
»In’n Tiergarten? Das ist mir noch zu gefährlich.«
»Nein, nur hier einmal ums Karree. Mal sehen, ob wir im Engelbecken nicht noch ’n Offizier finden, den sie da reingeworfen haben.« Jerxheimer erfreute sich an seinem schwarzen Humor. »Es muss ja nicht immer der Landwehrkanal sein, wo ’ne Leiche schwimmt. Die toten Roten schwimmen im Landwehrkanal – und die toten Schwarzen im Engelbecken.«
»Vater, du bist makaber.«
»Nu …« Wieder schmunzelte Jerxheimer. »Ist das ’n Wunder, wo meine Vorfahren Makkabäer gewesen sind!«
Dann zog er sich seinen guten Mantel an und trat mit seiner Tochter auf die Straße hinaus. Ihre Lieblingsroute war die Strecke um den Luisenstädtischen Kanal, der den Landwehrkanal mit der Spree verband. Sie kamen zur Waldemarstraße, blickten rechts auf das riesige Areal des Bethanien-Krankenhauses und wandten sich nach links. Bald standen sie am Engelbecken und bedauerten, kein altes Brot für die schwirrenden Möwen und die begierig heranschwimmenden Enten mitgebracht zu haben. Kein Wunder, dass die Tiere Hunger hatten, denn heute kam kaum einer, sie zu füttern. Die Leute hatten noch immer anderes im Kopf. Jerxheimer und seine Tochter waren die einzigen Menschen weit und breit.
»Sind wir ganz allein«, stellte er fest.
Worauf Sarah – nicht ohne Ironie – den Spruch zitierte, der an der nahen Emmaus-Kirche zu lesen stand und Zuversicht vermitteln sollte: »Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden.«
»Das gilt nur, wenn einer ’n Goi ist, nicht für uns.« Jerxheimer wollte gerade zu einem längeren religionswissenschaftlichen Exkurs ansetzen, da stutzte er. »Sieh mal, da kommt was angeschwommen.«
Sarah konnte nicht anders, als loszukichern. »Ja, dein toter Offizier, den sie ins Wasser geschmissen haben.«
Doch ihr sollte in den nächsten Minuten das Lachen vergehen, denn was da im Engelbecken trieb, war in der Tat ein Leichnam, wenn auch nicht der eines Offiziers, sondern der einer Frau. Und vollständig war die Leiche auch nicht, Kopf und Gliedmaßen fehlten.
»Wann geboren?«, fragte der Gutachter; er hatte die Feder schon aus dem Fass gezogen und die überflüssige Tinte abgestreift.
»Am 13. Dezember 1863«, antwortete Karl Großmann. »Aber da werden Se nich viel wissen von det Jahr, denn gegeben hat es da nicht viel. Das mit die Kriege ist ja erst gekommen, als ich schon hab’ gekonnt laufen. Und unser König ist noch nich jewesen der Kaiser. Und …«
»Ja ja, ist ja schon gut«, stoppte Prof. Dr. Strauch den Redeschwall. Er hatte schon selbst in Büchern recherchiert, und in Großmanns Geburtsjahr – 1863 – hatte die Menschheit in der Tat keine ihrer Sternstunden erleben dürfen. Nicht viel war in die Annalen eingegangen: Lasalle hatte in Leipzig den Allgemeinen deutschen Arbeiterverein gegründet, den Vorläufer der SPD. Großbritannien, Frankreich und Spanien hatten den österreichischen Erzherzog Maximilian zum Kaiser von Mexiko gemacht. Das Rote Kreuz war ebenso gegründet worden wie die Farbenfabrik Friedrich Bayer & Co. Gestorben waren Jacob Grimm und Friedrich Hebbel und auf die Welt gekommen Richard Dehmel, Arno Holz und Edvard Munch. Zwei Dichter und ein Maler. »Immerhin«, brummte Strauch.
»Keine schlechte Gesellschaft für Karl Großmann.« Er wandte sich wieder seinem Gegenüber zu. »Und wo geboren?«
»In Neuruppin.«
Das hatte Karl Großmann mit zwei berühmten Männern gemein: Karl Friedrich Schinkel und Theodor Fontane. So fragte denn Prof. Strauch seinen Probanden auch ganz automatisch, ob er von denen schon einmal etwas gehört habe, letzterem womöglich persönlich begegnet sei.
»Nee. Is mir jedenfalls nicht groß erinnerlich. Hat sich mir keiner mit diesem Namen vorgestellt.«
Der Gutachter musste lächeln, obwohl ihm voll bewusst war, wer ihm da gegenübersaß: die Bestie vom Schlesischen Bahnhof, wie er allenthalben genannt wurde. Zwei Dutzend Frauen, manche sprachen sogar von 100 und mehr, sollte er auf bestialische Art und Weise ermordet haben. Strauch betrachtete Karl Großmann als den großen Glücksfall seiner wissenschaftlichen Karriere, und manchmal schien es ihm, als hätte er nach ewig langer Suche in den Tiefen der Urwälder an Amazonas und Kongo wie in den eisigen Bergen des Himalaya endlich das fehlende Glied zwischen Tier und Mensch gefunden, ein Wesen aus beiden. Ein Raubtier, reißend wie ein Wolf und mordgierig wie ein Marder, das daherkam in Menschengestalt. Tiermensch nannte er es. Strauch war überzeugt, dass in jedem Menschen von Natur aus ein beträchtliches Maß an Mordlust stecke und es nur darauf ankäme, ob eine Gesellschaft diese archaische Triebkraft unter Kontrolle bekäme und wirksam abzubauen verstünde – oder aber multipliziere. Wie etwa in den großen Kriegen, wo Hunderttausende töteten und getötet wurden. Aber auch im Einzelfall, bei den sogenannten Massenmördern, zu denen man Karl Großmann wohl zu rechnen hatte, waren es seiner Erfahrung nach die Lebensumstände, die das Böse so fürchterlich ins Kraut schießen ließen. Also war es seine Aufgabe, sich ein umfassendes Bild von der Kindheit und Jugend seines Probanden zu machen.
Strauch selber kannte die Jahre von 1863 bis 1875 allein aus den Berichten seiner Eltern und Großeltern. Brandenburg war alles andere gewesen als das Paradies auf Erden. Die Zünfte waren zerfallen, und der ehrbare, auf Qualität bedachte und arbeitsame Zunfthandwerker hatte keine Chancen mehr. Die Manufakturen kamen mit Arbeitern aus, die nur schnell angelernt wurden, und konnten ihre Produkte um ein Mehrfaches billiger anbieten. Die Städte wuchsen – und mit ihnen das Proletariat und die Zahl der Armen und Bettler.
Читать дальше