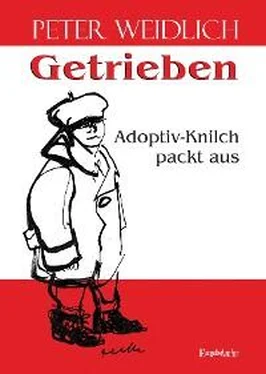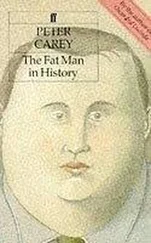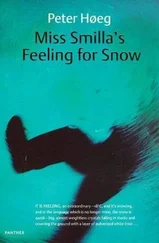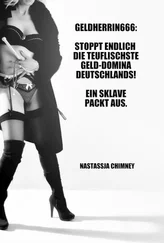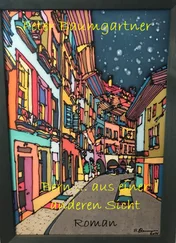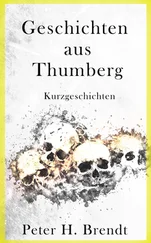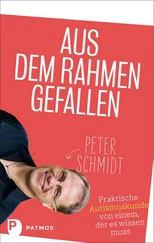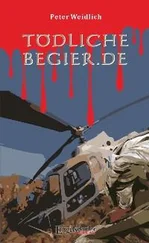Das Adoptionsverfahren in Deutschland hat so seine Tücken und dauert verhältnismäßig lange. Schneller geht es, wenn man ein Kind aus Brasilien oder Indien oder Haiti oder Afrika in unsere beschützende Kultur integriert, ihm unglaublich viel Liebe schenkt und mit Luxusgütern umgibt, als Wiedergutmachung zum vorherigen Leben, in dem es an Hunger, diversen Krankheiten oder als Opfer grausamer Misshandlungen gestorben wäre.
„Es wird keine Dankbarkeit erwartet, wirklich nicht“, sagen alle Adoptiv-Eltern, offiziell, wenn sie gefragt werden.
Heute, am einundzwanzigsten September 2016 feiern wir den Welttag der Dankbarkeit. Man dankt nicht mehr, weder dem Polizisten, noch den Ärzten, den Geistlichen sowieso nicht, den Lehrern ebenfalls nicht. Man nimmt, fordert, alles wie selbstverständlich. Eigenartigerweise freut man sich auf eine kleine Geste des Autofahrers, der, trotz seiner Vorfahrt, einen vorlässt. Oder in der Schlange an der Kasse, wenn einer vorgelassen wird, der nur zwei Kleinigkeiten im Arm hat. Oder wenn einer sagt: „Dankbarkeit ist eine Stufe zum Glück!“
„Ich freue mich, wenn Jakob meine Werte verinnerlicht, die ich ihm vorgelebt habe, aber Dankbarkeit? Dankbarkeit hat so etwas Demütigendes, sich Unterordnendes zur Folge. Das will ich nicht“, sinniert Gerald. Ein merkwürdiger Glanz in seinen Augen verrät verborgene Empfindungen im tiefsten Inneren. Der Glanz bezeugt den heroischen Einsatz, einem jungen Leben Optimales zu bieten, er nimmt seelische Verletzungen in Kauf, die durch dieses älter werdende Mündel überhaupt erst entstehen. Irgendwann werden Herz und Verstand reagieren, so seine unausgesprochene Hoffnung, ein Traum eben, der den Lohn für sein Engagement, seine Freude am Gelingen und eine nicht eingeforderte, unausgesprochene Dankbarkeit einschließt.
„Wenn ich gefragt werde, ob ich ein zweites Mal diese Tortur einer Adoption eines Kindes wagen würde“, sagt Gerald ungefragt, „egal ob Kinder aus anderen Kulturen oder hier aus Europa, würde ich mit NEIN antworten. Wenn das urvertrauende Liebesband zwischen Mutter und Kind zerrissen ist, kann man die Wunde zwar behandeln, nie aber heilen!“
Jakob nimmt nervös seine große Dunkelrandbrille von der Nase, rückt sein stylisches Halstuch zurecht, sein Vater trägt ähnliches, und antwortet, dass er keine Dankbarkeit kenne und nur sich selbst lieben würde, „wen denn sonst?“
Kann es sein, dass Adoptivkinder diesen Traum ihrer Adoptiv-Eltern nach inniger Harmonie und gegenseitiger Dankbarkeit, die Eltern immer mit Kindern verbindet, intuitiv spüren und darum ein keimendes Gefühl der Abwehr dieser ihnen entgegengebrachten Zuneigung zelebrieren müssen? Eine aus der Tiefe erwachsene Abwehr, aus Angst davor, fallengelassen zu werden? Obgleich da Menschen sind, die sich auf das Abenteuer mit ihnen eingelassen haben und trotz aller Rückschläge zu ihnen halten, aber, wer weiß, wie lange? Kann man Gefühle der Dankbarkeit diesen neuen Eltern gegenüber entwickeln, und gleichzeitig zutiefst wütend sein auf die leiblichen? Dieser Spagat an Empfindungen wird heftiger, je älter sie werden.
Im Laufe meiner Heimleitertätigkeit habe ich Adoptiv-Eltern kennengelernt, die die ersten Jahre als Beglückend empfunden haben, später trotz unsäglicher Mühen an dieser Aufgabe und ihren Wunschvorstellungen verzweifelt, oft auch gescheitert sind.
Wie begeistert haben sie die ersten Monate beschrieben, wenn ihnen ihre Kinder mit wachsamen Augen gefolgt sind, jede Nuance ihres Tonfalls registrierend, und lautstark Bedürfnisse durchsetzen konnten. Konflikthafter wurde es, als sie älter und eigensinniger wurden und während der Pubertät Vergleiche zogen zwischen ihren neuen Eltern und ihren oftmals unbekannten Leiblichen, aus Sehnsucht glorifiziert und unantastbar.
Was geht in Adoptiv-Eltern und ihren Anvertrauten vor, habe ich mich gefragt, wenn das Kind zum Nachbarn schleicht, barfuß im Winter, zitternd vor Kälte, und um Süßigkeit bettelt, weil es nichts dergleichen bekommt, nur normales Essen? Wenn es sich nach Jahren mit der Clique ins Koma säuft oder total zukifft, weil keiner es versteht? Wenn die Eltern sich scheiden lassen, weil sie der Lebens-Aufgabe nicht mehr gewachsen sind, das Adoptivkind alle Anstrengungen unternimmt, beide wieder zusammenzubringen und nach dem Misslingen Vater, Mutter oder sich selbst umzubringen trachtet? Wenn die Erwartungen des Kindes übermächtig und unerfüllbar werden, besonders, wenn leibliche Kinder ihnen als Konkurrenten die Rangfolge streitig machen? Wenn sie trotz aller Fürsorge und Hingabe einen kriminellen Weg einschlagen mit der Begründung, eine schwere Kindheit ohne Liebe und Verständnis gehabt zu haben?
Albert und Dorothea haben eine mittlerweile verheiratete Tochter mit einer Behinderung, einen gesunden Sohn, der sich als Geschäftsnachfolger bewährt und einen Adoptiv-Sohn, der ihnen allen das Zusammenleben zur Hölle macht.
Geplant war, diesem Jungen eine liebevolle Nestwärme, gute Erziehung und zukunftsorientierte Bildung zu bieten. Um das Leben der Tochter zu bereichern, organisierten die Eltern Spenden-Aktionen zugunsten des Behinderten-Vereins, in dem ihre Tochter gefördert wurde. Ihrem Sohn ermöglichten sie, die Meisterprüfung zu absolvieren, um ihren Betrieb übernehmen zu können. Sie hatten die besten Vorstellungen, ihren Kindern neben der liebevollen Fürsorge, einer intensiven Förderung und einer kontinuierlichen Präsenz den Grundstein für ein angenehmes Leben zu legen.
Die Realität brachte die Familie an den Rand der Verzweiflung. Konkurrierendes Verhalten zwischen den Söhnen, angereichert von Vorwürfen beider Jungen, benachteiligt zu werden, führte zu massiven Auseinandersetzungen innerhalb der Familie. Der eine, angepasst und strebsam, der andere verhaltensgestört und kriminell.
Irgendwann konnten sie die Vorwürfe nicht mehr ertragen, ihren leiblichen Sohn mehr zu lieben, ständig vorzuziehen, ihn aber, den Angenommenen, trotz seiner schwierigen Kindheit und seiner Verhaltensweisen, für die er nichts könne, im Grunde ihres Herzens abzulehnen.
Schlussendlich festigte sich die Ablehnung des adoptierten Jungen und provozierte einen Teufelskreis, der immer unerträglicher wurde und trotz professioneller Beratung eskalierte. Nach unendlich vielen inneren und äußeren Kämpfen wurde die Beziehung gekappt. Tiefe Verletzungen führten zur Desillusionierung und der Resonanz: Nie wieder eine Adoption!
Christian, bereits etwas reiferen Alters, sinnierte während unseres Gesprächs über den Wert einer Adoption allgemein und ob er so ein kleines Kind wirklich lieben könnte. Er hatte bereits drei leibliche, die bei seiner ersten Frau lebten oder bereits mit Partnern verbandelt waren. Aber ein völlig fremdes Kind, gerade ein Jahr alt, eine Brasilianerin, mit Feuer im Blut wie seine zweite Angetraute?
Ich hörte ihm zu, als er begeistert und dennoch vorsichtig von der bevorstehenden Adoption sprach.
„Für das hiesige Jugendamt bin ich zu alt, aber nicht zu alt für meine Frau. Und sie wünscht sich unbedingt ein Kind. Was machen da die zwanzig Jahre Unterschied? Sie kann keine Kinder bekommen. Also, haben wir uns an Pater Walfried in Rio gewandt. Er leitet dort ein Waisenhaus. Dahin geht’s in einer Woche!“
So ähnlich muss es gewesen sein, als meine Eltern kurz vor meiner Adoption standen, dachte ich. Und dann kam ich, kein Säugling mehr, sondern ein Stromer, ein Stempelwüstling.
Christian sah das Wasser in meinen Augen, fragte erschrocken, was los sei. Ich erzählte ihm meine Geschichte.
Interessiert, mit einem Adoptivkind reden zu können, dessen Befindlichkeiten aus erster Hand erzählt zu bekommen, stellte er Fragen über Fragen, die seine Ur-Ängste oder Unsicherheiten abbauen sollten.
Eine Woche später brachten wir ihn mit seiner Frau zum Flughafen. Ein Teddy für Christina sollte sie begleiten.
Читать дальше