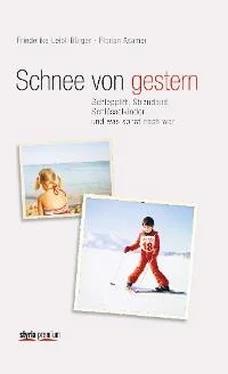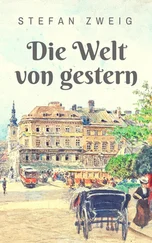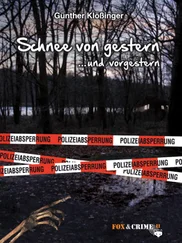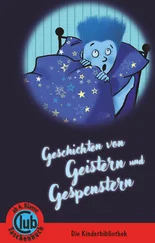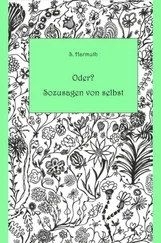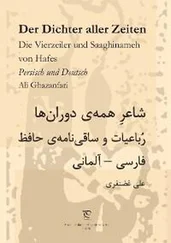Anstehende Mädchen zu taxieren war für aufs Aussehen fixierte Burschen gar nicht so einfach. Denn unter einer Anorakwolke, die fast bis zu den Knien reichte, war die Figur darunter nur schwer auszumachen. Und nicht einmal, ob das Gesicht den Schönheitsanforderungen entsprach, ließ sich wegen monströser Hauben und unförmiger Skibrillen verlässlich sagen. So haben wir unsere blauen Wunder erlebt: Da schälten sich aus entstellenden Daunenhaufen zarte Schönheiten heraus, umgekehrt waren gute Skifahrerinnen, die uns auf der Piste begehrenswert erschienen waren, in Zivilkleidung plötzlich völlig entzaubert.
Wenn man sich schon kannte, begann das Was-sich-liebt-das-neckt-sich-Spiel am Skilift. Man zog sich an den Hauben, rutschte einander näher: Natürlich ging es vor allem um das Herstellen von Körperkontakt. Schaffte man es am Sessellift zwar nicht neben die Richtige, aber zumindest auf den Sessel davor, konnte man sich während der ganzen Fahrt umdrehen, nach hinten schauen und rufen. Die Objekte der Begierde waren so für zumindest die Dauer der Fahrt rettungslos ausgeliefert.
Der Schlepplift bot ganz andere Möglichkeiten. Ein besonders perfider Streich war Burschen vorbehalten: Man öffnete unbemerkt das Schnapperl der Tyrolia-Bindung, kurz bevor das Opfer den Schlepplift bestieg. Ging dann der Bügel auf Zug, öffnete sich die Bindung und der Betreffende wurde aus der Spur katapultiert. Danach musste meist der Lift kurz abgeschaltet werden, da das Opfer mitten im Einstiegsbereich zu liegen kam. Es wurde viel gelacht und viel geschimpft. Der Liftwart drohte, uns den Skipass abzunehmen.
Beim Schleppliftfahren gab es eine Reihe von Methoden, den Mädchen zu imponieren. Wir verließen die Spur, um uns durch den Tiefschnee schleppen zu lassen, öffneten einander die Bindung oder zogen freiwillig einen Ski aus, um uns danach publikumswirksam gegen das Hinausfallen zu wehren. Es gab auch eine Brachialmethode, um Kontakt zu knüpfen. Man ließ sich absichtlich fallen, wartete neben der Spur und versuchte, als Dritter an einem „Mädchenbügel“ mitzufahren. Was fast immer mit dem Ausfall von allen dreien endete. Diese Methode führte aber eher nicht zu irgendeinem nennenswerten Ergebnis.
Für das Ausgehen am Abend waren wir noch zu jung. Es wurden Nummern ausgetauscht – natürlich Festnetz, oft stimmten sie nicht. Nur in den seltensten Fällen traf man sich in Zivilkleidung im Zivilleben wieder. Die Erinnerung an kalte Küsse hoch oben auf dem Sessellift schien dann wie aus einer anderen Welt. Das Fördervolumen der Lifte ist im Lauf der Jahre immer größer geworden. Am Sechsersessellift will sich niemand mehr küssen. Und beim Anstellen haben alle ihre Handys in der Hand. Und keine Augen für die anderen.
Skifahren, das war auch ein Fernsehsport
In der Welt, von der wir erzählen, gab es noch strenge Tabus. Damit sind nicht nur die moralisch-sexuellen gemeint. Tabus lauerten noch hinter jeder Ecke. Ein großes Tabu war das Fernsehen untertags. Nur im Krankheitsfall durfte der Fernsehapparat schon am Vormittag eingeschaltet werden. Da gab es die mittlerweile zum Kult gewordenen Sprachkurse, und die Physiognomie der Russischlehrerin prägte eine ganze Bubengeneration. Danach kam der klassische Vormittagsfilm. Er brachte uns Kindern neben dem Nuscheln von Hans Moser auch Wesentliches bei. Etwa dass Heimatliebe viel mit Singen und noch viel mehr mit blühenden Bäumen und großen Dekolletés zu tun hatte. Oder dass es keinen stärkeren Mann als Bud Spencer gab. Nur bei ihm klatschten Ohrfeigen richtig laut und brachen Sessel krachend auseinander. Wir versuchten, ebenso schallende Watschen zu verteilen, bevorzugt an jüngere Geschwister, scheiterten aber trotz vieler Versuche am gewünschten Sound. Heute bringen Toneffekte keine Kinder mehr aus dem Häuschen.
Dank der Elvis-Presley-Filme lernten wir eine Sehnsucht kennen, die wir später als Fernweh benennen konnten. Und Sissi war für die Mädchen unter uns die Prinzessin, die man selbst so gerne gewesen wäre. Der Vormittagsfilm half angeblich beim Gesundwerden, aber auch der Mutter beim Durchschnaufen. Damals wurde streng darauf geachtet, dass die fieberfreien Tage (mindestens zwei) eingehalten wurden, bevor wir wieder in die Schule durften. Unseren Kindern gönnen wir das heute nicht mehr.
Im Normalfall durfte der Fernsehapparat frühestens um 17 Uhr eingeschaltet werden. Was prinzipiell auch nicht so schwierig war, da es ohnehin nur zwei Sender gab. Welche Auswahl uns später zur Verfügung stehen und dass es einmal eine Fernbedienung geben würde, konnten wir noch nicht ahnen. Es wurde manuell umgeschaltet, wobei diese bedeutsame Handlung nicht von allen Familienmitgliedern gleichberechtigt gesetzt werden durfte.
Kinderprogramm lief nur am sogenannten Vorabend. Die schlimmste vorstellbare Form des verbotenen Tagsüber-Fernsehens war das Fernsehen während des Essens. Ein sogenannter „Fernsehfraß“ war schon abends eine riesengroße Ausnahme. Und wurde vor allem dann praktiziert, wenn der Herr des Hauses – auch so etwas war noch gang und gäbe –, dieses verlassen hatte. Zum Beispiel für einen Abendtermin oder eine Dienstreise. Dann erlaubten es die Mütter, ganz ausnahmsweise das Abendessen vor den Fernsehapparat zu verlegen. „Wickie und die starken Männer“, „Biene Maja“ und „Heidi“ liefen da zum Beispiel oder „Mein Onkel vom Mars“ und „Mondbasis Alpha 1“, wenn wir am niedrigen Tisch vor der Sitzgruppe unser Abendessen einnehmen durften. Auch wenn sich Fernsehen seit damals revolutioniert hat: Das meiste, was wir damals sahen, läuft heute immer noch. Auch unsere Kinder lieben Maja. Und hassen das Fräulein Rottenmeier.
Doch wurde ein Skirennen im Fernsehen übertragen, war auf einmal alles anders. Plötzlich war es der ganzen Familie erlaubt, beim Mittagessen – die Skiübertragungen liefen meistens zu Mittag – vom Esstisch aus zum Fernseher zu schauen. Denn das Skifahren war auch als Fernsehsport ein Volkssport. Die Kommentatoren des öffentlich-rechtlichen Fernsehens waren Teil der Familie. Über Jahrzehnte hinweg wurden die Rennen von denselben Reportern begleitet, die regelmäßig die Fassung verloren. Entweder wegen eines überraschenden Erfolges oder einer schmerzhaften Niederlage. Journalistische Ansprüche gab es keine. Nationalismus und Emotionen beherrschten die Skiübertragungen.
So wie die Deutschen damals für uns in allen anderen Bereichen der (kaum bezwingbare) Konkurrent waren, stellten im Skisport die Schweizer den Gegenpol dar. Eine Niederlage war dann nur halb so wild, wenn auch kein Eidgenosse auf dem Stockerl stand. Und ein Sieg war doppelt so schön, wenn kein Schweizer unter den besten Zehn platziert war. Das absolut Schrecklichste war ein Schweizer Abfahrtssieg auf der Streif in Kitzbühel. Oder – Gott bewahre – ein Schweizer Abfahrtsolympiasieger.
Die Abfahrtsrennen der Herren (überdrehte Disziplinen wie Super-G oder Super-Kombi gab es selbstverständlich noch nicht) auf den klassischen Abfahrtsstrecken warfen schon Tage vorher mit diversen Trainingsläufen ihre Schatten voraus. Wenn dann unsere Skihelden im Starthaus standen, um sich über die Kamelbuckel in Gröden zu schmeißen, im Ziel-S in Wengen noch einmal alles zu geben, obwohl die Oberschenkel sicher schon blau waren, oder – am Höhepunkt der Saison – die Streif zu bezwingen, durfte der Fernseher auch am helllichten Tag laufen. Einige Zeitungen hatten Startlisten abgedruckt, in die man die Zeiten eintragen konnte.
Vor allem das Rennwochenende von Kitzbühel, wenn zwischen Mausefalle, Ausfahrt Steilhang, Haneggschuss, Hausbergkante und Zielschuss für ein weiteres Jahr über das Selbstbewusstsein einer ganzen Nation entschieden wurde, war ein Pflichttermin. Da saßen wir alle um den Mittagstisch und starrten gebannt auf die Bilder, wir hielten unseren Atem an, wenn einer unsere Favoriten mit Verspätung bei der Zwischenzeit auftauchte, und rissen mit den Zuschauern im Ziel und mit der überschlagenden Stimme des Kommentators im Ohr die Arme in die Höhe, wenn neben der Schlusszeit ein Einser auftauchte. Schließlich ging es um alles.
Читать дальше