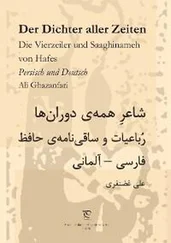Wir selbst machten als Eltern den Fehler, den Kindern selber das Skifahren beibringen zu wollen. Und obwohl uns heute noch die Oberschenkel und der Rücken brennen, wenn wir daran denken, wie wir mit dem Schleppliftbügel unterhalb der Knie die endlos scheinende Liftfahrt durchgestanden haben, lernten unsere Kinder nie mehr so gut Ski fahren wie wir damals. Das Skifahren ist übrigens eine der führenden „Bruttosportarten“. Das heißt, man verbringt den größten Teil der Zeit mit Anreise, Vorbereitung, Liftfahrten und Nachbereitung. Kleine Kinder pistenfertig zu machen dauert noch einmal so lange. Das macht das „Netto“, also jene Momente, in denen man dann tatsächlich talwärts fährt, so besonders kostbar.
Das Ausschalten des Skilehrers in den ersten Lehrjahren könnte also mitverantwortlich sein für das Ende des Skifahrens als Volkssport.
Vom „Lehrplan“ her gab es im Skikurs eine klare Vorgangsweise. Nachdem es gelungen war, nicht mehr ständig im Stehen umzufallen, begann man im flachen Bereich zu rutschen. Als auch das einigermaßen verlässlich ohne Sturz funktionierte, standen wir vor dem größten Problem. Wie bremsen? Dafür war der Schneepflug angeblich das Mittel der Wahl. Aber schwierig zu erlernen. Daher fuhren wir, als wir halbwegs sicher auf Skiern standen, erst einmal eine ganze Zeit lang nur Schuss und kümmerten uns erst ums Bremsmanöver, wenn ein unüberwindbares Hindernis auftauchte. Zäune, Hüttenwände und dergleichen.
Beim Skikurs wurde in der Spur gefahren. Entweder fuhr der Skilehrer voraus, und die Gruppe stand oben an wie an einer Supermarktkasse, um dann einzeln den Hang (möglichst in der Spur des Skilehrers) nachzufahren. Oder man fuhr in einer Schlange den ganzen Hang hinunter. Immer darauf achtend, nicht dem Vordermann hineinzufahren und doch den Bogen an der Stelle hinzubringen, an dem der Skilehrer ihn gemacht hatte. In der Spur nachfahren war allerdings ein bisschen wie Autofahren mit dem Navi. Wenn man es später ohne machen sollte, fand man den richtigen Weg nicht mehr.
Sobald man schließlich eigenständig den ganzen Tag unterwegs war, interessierte einen die Piste selbst eher weniger. Das war die Reaktion auf das ständige In-der-Spur-bleiben-Müssen. Die zwei Dinge mit magischer Anziehungskraft waren Schanzen und das freie Gelände. Schanzen suchten oder bauten wir. Vom Lift aus begutachteten wir jede Kante auf ihre Sprungtauglichkeit hin. Wir waren zwar durchaus risikobereit, aber keine Hasardeure. Es durfte weder Verkehr im Anlauf sein, noch durften im Auslauf Leute herumstehen. So dauerte es oft einen ganzen Vormittag und zig Fahrten rauf und runter, die im Grunde nur den einen richtigen Sprung über die Schanze zum Ziel hatten. Vor allem jene Schanzen, bei denen man im Flachen landete, können wir heute noch in den Knien spüren. Wir sind häufig gestürzt. Neben dem Schanzenspringen waren Hohlwege und Waldwege unsere große Leidenschaft. In Hohlwegen konnte man wie in einer Bobbahn Kurven in der Waagrechten ausfahren, Waldwege waren ein einziger Hindernisparcours. Wenn wir darüber nachdenken, was wir alles gemacht haben, sind wir vielleicht doch froh, dass unsere Kinder ihre Nachmittage vor der Xbox verbringen. Nein, eigentlich sind wir das nicht.
Der beste Teil am Skifahren ist – heute wie damals – das Danach. Nichts von dem, was gemeinhin als Après-Ski beschrieben wird, fühlt sich so gut an, wie das Ausziehen der Skischuhe nach der letzten Abfahrt. Das Kribbeln der Beine, die langsam wieder ausreichend durchblutet werden. Der Schmerz in den Zehen, wenn sich die Kälte langsam zurückzieht und das Gefühl zurückkehrt. Die ersten Minuten irgendwo im Warmen, wenn die Heizung zu wirken beginnt und man sich aus dem feuchten Anorak schälen kann und die Wangen zu glühen beginnen. Der große Appetit auf Schokoriegel und Traubenzucker, die nie so gut schmeckten wie nach einem langen Skitag. Daran hat sich wenig geändert.
Das echte Après-Ski, also in Hütten, Bars und Discos in Skischuhen zu tanzen (wenigstens konnte einem niemand auf die Zehen treten) und so lange der Wodka-Feige zuzusprechen, bis der nächste Skitag erst nach Mittag beginnen konnte, blieb uns noch verwehrt.
Ein richtiger Skitag begann mit einem opulenten Frühstück. Im Skiurlaub stimmte der Spruch von der wichtigsten Mahlzeit des Tages, der uns während der Schulzeit das flaue Gefühl im Magen nicht nehmen konnte. Wir aßen, was wir kriegen konnten. Eier in allen Zubereitungsformen und dazu frische, aber meist zähe Semmeln. Marmelade war entweder sehr orange oder sehr rot, sehr süß, und in ihr war kein einziges Fruchtstückchen zu finden. Manchmal sehnen wir uns heute noch nach dieser durch und durch künstlichen Marmelade, während uns ein Cranberry-Wacholder-Weichsel-Aufstrich mit ganzen Fruchtstücken und garantiert ohne Geschmacksverstärker serviert wird.
Der Zeit nach dem Skifahren kam große Bedeutung zu, weil es einen großen Teil des Tages betraf. Denn selbst wenn wir die Liftkarten ausgefahren, die Punktekarte bis auf den letzten Punkt ausgequetscht und mit der letzten Gondelbergfahrt noch einmal ganz hinauf gefahren waren: Es blieb noch jede Menge Tag übrig. Wo heute in jedem Hotel ein Wellnessbereich auf seine Gäste wartet, mussten wir uns, wenn überhaupt, mit dem örtlichen Hallenbad behelfen. Manchmal zogen wir, während sich die Eltern vor dem Abendessen noch einmal hingelegt hatten, unsere Moonboots an – das glatte Gegenteil von Skischuhen, warm und weich und unendlich bequem und noch nicht von Hansi Hinterseer unmöglich gemacht – und spazierten in der Dämmerung durch den Ort. Wir kletterten in den hohen Schneehaufen, die von riesigen Baggern den Winter über aufgetürmt worden waren, um Straßen und Parkplätze freizubekommen. Doch die eigentliche Faszination unserer Skiferienabende lag unter der Erde. Dort war so gut wie immer der Skikeller untergebracht. Da wurden abends noch von fachkundigen Einheimischen die Ski gewachst, von einem alten Bügeleisen tropfte da rosafarbenes oder gelbes Wachs auf die Skier – den Geruch haben wir noch heute in der Nase. Manchmal durften wir beim Abziehen helfen. Und schauten dann noch einmal zu, wie der Besitzer des Hotels die Kanten der Skier schliff. Vor dem alles entscheidenden Abschlussrennen des Skikurses wurde unseren Skiern diese Spezialbehandlung auch zuteil. Wir haben uns wahnsinnig schnell gefühlt, gewonnen haben wir dann trotzdem nicht.
Neben dem Skikeller gab es meist einen Aufenthaltsraum. Je nach Größe der Pension oder des Hotels standen dort nur ein paar Tische und Regale mit diversen Brett- und Kartenspielen, manchmal sogar ein Tischtennis- oder ein Billardtisch. Dort unten verbrachten wir jede freie Minute, quasi als Ausgleich zur vielen frischen Bergluft, die wir tagsüber abbekamen. Unser Highlight waren die ersten Videospielautomaten. Da gab es etwa das legendäre Teletennis, einen schwarz-weißen Fernseher, der in einen Tisch eingelassen war, mit zwei kleinen weißen Strichen, die man mit zwei Knöpfen nach links und rechts lenken konnte. Dazwischen zischte ein winziger weißer Pixelball hin und her. Wir konnten uns, selbst wenn wir nur zuschauen durften, wie andere spielten, kaum losreißen. Später dann gab es auch die ersten Pacman-Spiele, sogar schon mit verschiedenen Farben. So verbrachten wir unsere Tage wechselweise ganz weit oben oder tief unten im Keller.
Zwiebellook und Heckeinstieg
Skifahren früher, das war viel kälter. Der Wunderstoff Goretex war zwar Ende der 1970er-Jahre schon erfunden, aber es dauerte noch lange, ehe er die Sportbekleidung revolutionierte. Die Finger waren klamm in nassen Handschuhen, man fror im Skianzug, der schon nach wenigen Stürzen feucht war und nie mehr trocknete. Skifahren früher, das hieß auch, endlose Schichten an „Untendrunter“ zu tragen. Wir, die Kinder der 70er, haben damals den Zwiebellook erfunden, aber der war nicht leicht und schick, es war ein Gewurschtel, kratzig, und schnürte einem die Luft ab.
Читать дальше