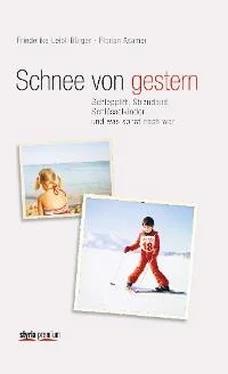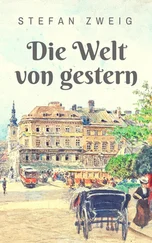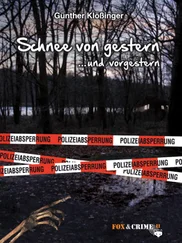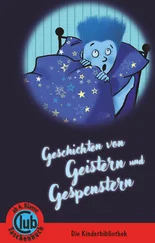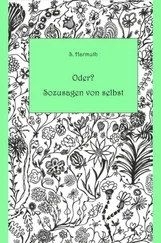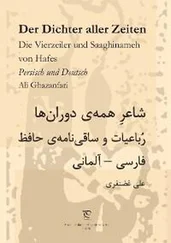Die Skischuhe waren wie Schraubstöcke. Entweder man ließ die Schnallen auf Stufe eins und rutschte im Schuh herum. Oder man zog die Schnallen an, dann war der Schmerz nach kurzer Zeit zwar vorbei, aber nur deshalb, weil wir die Füße gar nicht mehr spürten. Die Skischuhe waren noch so bockig und steif, dass man die Schnallen, wenn man sie einmal unvorsichtigerweise öffnete, weil man sich kurze Erleichterung erhoffte, nicht mehr schließen konnte. Und obwohl wir teilweise zwei Paar Skisocken übereinander trugen, froren wir uns die Zehen blau. Neidisch schauten wir auf die paar wenigen Privilegierten, die geschäumte Skischuhe trugen. Was wir nicht wussten: Wenn sich der Fuß zum Beispiel wegen einer Schwellung während eines Skiurlaubes geringfügig änderte oder es im Frühling sehr warm wurde, drückte nichts mehr als diese Luxusmaßanfertigung.
Bei den Skischuhen galt übrigens: je mehr Schnallen, desto besser. Fünf Schnallen waren zum Beispiel ähnlich attraktiv wie acht Zylinder bei einem Auto. Dann irgendwann kamen einschnallige Skischuhe mit dem sogenannten Heckeinstieg auf den Markt. Die Einschnaller waren ein Zeit lang sehr gefragt: Man konnte mit ihnen hervorragend gehen, aber mangels Halt leider nicht Ski fahren. Der sportliche Aspekt besiegte schließlich die Bequemlichkeit, die Schnallen kehrten zurück.
Auch eine andere kurzzeitig dominierende Erscheinung entpuppte sich als Eintagsfliege: die Parablacks. Vor allem Skifahrer aus dem Osten des Landes befestigten die zwei Aufsätze hinter den Skispitzen und glaubten das Versprechen, damit das Überkreuzen der Skier zu verhindern – man fuhr ja so eng wie möglich. Die Idee der Parablacks war gewinnend, leider scheiterte es an der Umsetzung. Hatte man die Skier einmal überkreuzt, blieben sie dank Parablacks für immer überkreuzt. Die Bindung war natürlich immer möglichst so eingestellt, dass sie beim nun unvermeidlichen Sturz keinesfalls aufging.
Hermann Maier statt Wolfgang Schüssel
Wie man Ski fährt, ist eine Stilfrage, somit geschmacksabhängig. Wobei – eigentlich nicht so ganz. Der Westösterreicher erkannte den Ostösterreicher auf den ersten Blick, speziell den Wintersportler aus Wien: an seinem verkrampften Bemühen, die Beine zusammenzuhalten. Der Parallelschwung war das Maß aller Dinge, aber nicht alle beherrschten ihn. Dieses Kurzschwingen um jeden Preis, egal wie Gelände und Schnee auch beschaffen waren, galt dem Pistenkönig aus dem Osten als Ausweis seiner Meisterschaft, für die Einheimischen war es ein Grund zum Lachen. Genauso wie eine Plakette vom bevorzugten Skiurlaubsort am Autoheck. Die Ost-Wedler wedelten in erster Linie mit den Schultern und dem Hintern, an den Skiern konnte man kaum mehr eine Richtungsänderung wahrnehmen. Aber auch sie lernten dazu. Nach der Jahrtausendwende haben wir diese Form des Skifahrens schließlich noch einmal gesehen, als der damalige Bundeskanzler Wolfgang Schüssel seine Wedelkünste vor der Kamera an die Wähler bringen wollte.
Auch hier müssen wir neidlos zugestehen, dass Carvingskier die Wende zum Besseren brachten und dem guten alten Riesentorlaufschwung, der immer schon der König der Schwünge war, zum Durchbruch verhalfen. Hermann Maier gilt bis heute noch als Vorbild für die Frage, wie das gute Skifahren auszusehen hat. Der Richtungsstreit wurde zugunsten von breitbeinig entschieden. Nur ein paar Verklemmte klemmen immer noch die Beine zusammen.
Unser Feind, der Snowboarder
Zum Skifahren gab es damals grundsätzlich nicht so viele Alternativen. Im Sommer ging man Rad fahren und schwimmen, im Winter rodeln und Ski fahren. Langlaufen war für uns Spazierengehen mit Skiern an den Füßen. Und mit Spazierengehen konnte man uns jagen. Sonst spielten weder die Verlockungen von Computerkonsolen noch die Alternativen von Winterurlaub in warmen Gegenden eine ernsthafte Rolle. Doch wurde uns auch auf der Piste eine wichtige Entscheidung abgenommen. Es gab nur Skier, keine Snowboards. Wo heute Kinder und Jugendliche hin- und hergerissen sind, weil sie sich nicht zwischen Skiern und Snowboards entscheiden können – und oft am Ende beides nicht ordentlich erlernen –, gab es früher keine Alternative. Die größten Exoten waren Skibob- und Telemark-Skifahrer. Aber dass wir unsere Pisten einmal mit einer völlig anderen Spezies würden teilen müssen, war für uns völlig unvorstellbar.
Als die ersten Monoskier auftauchten, amüsierten uns die ungelenken Versuche Einzelner, eine Piste zu bezwingen, ohne die Beine bewegen zu können. Noch waren wir unbesiegbar, wir ahnten nicht, dass die Snowboarder unsere Welt aus den Angeln heben würden. Alles, was wir Skifahrer an Disziplin und Ehrenkodex erlernt hatten, zogen Snowboarder mit provokanter Lässigkeit ins Lächerliche. Uns war etwa eingeimpft worden, wenn dann nur am Pistenrand zu pausieren – im Idealfall fuhr man, ohne anzuhalten, bis zum nächsten Lift – und sich niemals hinter einer Kuppe zu versammeln. Dort war nun ohnehin kein Platz mehr. Wenn den Snowboardern nach Pause war, ließen sie sich wie fette Schmeißfliegen im Schwarm bevorzugt hinter einer Kante mitten auf der Piste nieder und hatten alle Zeit der Welt.
Waren wir ausdrücklich angehalten worden, im unberührten Tiefschnee Spuren dicht an dicht zu setzen, damit auch für andere noch genug unverspurter Hang übrig blieb, pflügten die Snowboarder mit großzügigen Schwüngen quer über den Berg. Um ihn zu markieren, meinten wir und hassten die demonstrative Individualität, die sie unserer Angepasstheit entgegensetzten. Mit den Snowboardern hielt eine Rücksichtslosigkeit, aber auch Unbeschwertheit auf den Bergen Einzug, die beide für uns dort nichts zu suchen hatten. Dennoch beneideten wir sie insgeheim, den Berg so unbekümmert für sich allein zu beanspruchen. Und besser angezogen waren sie obendrein.
So wie ein Franzose heute noch Erklärungsbedarf hat, wenn er ein Auto aus nicht französischer Produktion fährt, mussten es für uns natürlich österreichische Skier sein. Die Devise: Einen Völkl fährt man nicht. Niemals. Den fuhren deutsche Touristen, die sich schlecht benahmen und noch schlechter Ski fuhren. Auch ein Rossignol-Ski war völlig ausgeschlossen. Doch auch heimische Fabrikate signalisierten strenge Fraktionszugehörigkeit. Ein Kästle war ein Skilehrerski (den konnte man nur fahren, wenn man gut genug war), Fischer, Blizzard und Atomic so unterschiedlich wie die Weltreligionen. Und Kneissl blieb immer abgeschlagen. Nur als Franz Klammer mit Kneissl Rennen gewann, kam so manches Weltbild ins Wanken.
Das Material war wichtig. Und es musste uns gehören. Dass ein Leihski auch Vorteile mit sich bringen könnte, hatte sich noch nicht herumgesprochen. Skiausleihen war etwas für Gelegenheitssportler. Wir wünschten uns eine neue Ausrüstung zu Weihnachten und hatten ganz genaue Vorstellungen, welches Produkt es zu sein hatte. Ein Ski musste grundsätzlich möglichst hart und lang sein. Je besser der Fahrer, desto größer die Differenz zwischen Körper- und Skilänge. Jeder Schwung wollte erkämpft sein. Noch immer fühlen wir uns ein bisschen lächerlich, wenn ein Carvingski fünf Zentimeter unter unserem Kinn endet.
Auch die Wahl der Bindung war ein Offenbarungseid. Es gab zwei gängige Modelle: Salomon oder Tyrolia. Während man in die Salomonbindung einfach hineinsteigen konnte, musste man die Tyroliabindung, bevor man mit dem Skischuh hineinsteigen konnte, noch einmal fixieren, dabei gab es eine Variante für den wahren Kenner: die Markerbindung. Unsere Bindung an die Lieblingsmarke hält bis heute an.
Aus der Jethose ins Schneehemd
Das Outfit auf der Piste war natürlich wichtig. Grundsätzlich gab es zwei Skimoden-Philosophien. Die eine war eher am Rennsport orientiert. Man trug eine Jethose, eng anliegend, oft mit gepolsterten Knien und straffen Hosenträgern, die gar nicht notwendig gewesen wären, weil ohnehin nichts mehr rutschen konnte. Oben herum kombinierte man dazu in kalten Monaten einen Anorak, den Osterskilauf bestritt man in Pullover und Jethose, was als besonders schick galt. Zur Jethose passten gut Rennhandschuhe, die ein bisschen höher hinaufreichten als bis zum Handgelenk. Sie waren gepolstert, um sich nicht an den Stangen zu verletzen – obwohl wir natürlich nicht zwischen Stangen fuhren. Zum Rennoutfit gehörten eine Zeit lang auch gebogene Stöcke, die man in der Hocke besonders aerodynamisch unter die Arme klemmen konnte. Zum normalen Skifahren bewährten sie sich allerdings kaum.
Читать дальше