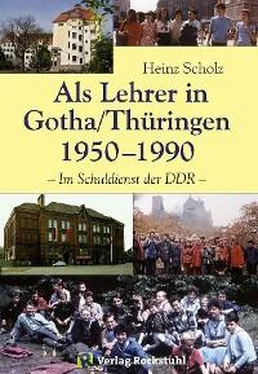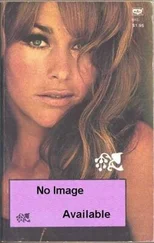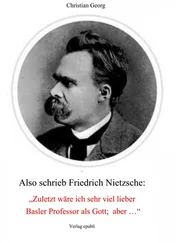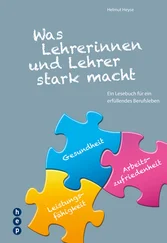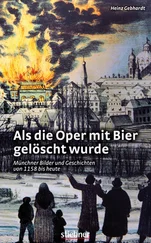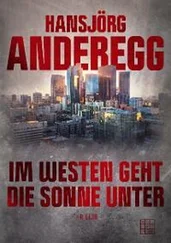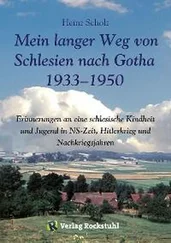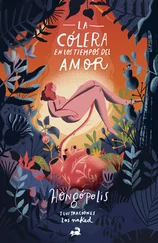Nun will ich nicht weiter vorgreifen, aber doch sagen: Ich war sehr angetan von Brechts Theaterstücken und der Spielweise seines „Epischen Theaters“. Ich begriff seine marxistische Weltsicht und darüber hinaus vor allem das, was er mit seinem „Epischen Theater“ bezweckte. Nämlich, dass er den Zuschauer vor Illusionen und vordergründiger emotionaler Manipulation (wie beim „dramatischen“ Theater) bewahren und mit seinen Gestaltungsmitteln des Epischen Theaters hauptsächlich zu vernunftgemäßen Wahrnehmungen und zum dialektischen Denken anregen wollte. Der Zuschauer sollte nicht primär „tief gerührt“, sondern primär angeregt bzw. befähigt werden, gezeigte Charaktere, gesellschaftliche Umstände und Konflikte tiefer zu durchdenken und zu bewerten. Brecht hat keine heroischen „sozialistischen Helden“ zur begeisterten Nacheiferung und Parteilichkeit vorgeführt, keinen oberflächlichen „sozialistischen Realismus“ à la Ulbricht und Abusch demonstriert, keinen indirekten Gesinnungszwang ausgeübt, sondern hat mit seiner Theaterkunst selbständiges Denken und rationale Auseinandersetzung mit Argumenten und Haltungen herausgefordert. Und gerade das schien mir so wichtig. Genauer besehen, widersprach das der befohlenen „sozialistischen“ Kunstauffassung und einer vernunftwidrigen Parteipropaganda. So sah ich mich in meiner eigenen Meinung bestätigt und begann zu hoffen, dass sich, wenn ein so bedeutender kommunistisch gesinnter Dichter nach Freiheit im Denken verlangt, dass sich dann auch in unserem gesellschaftlichen Leben womöglich mehr Vernunft und Toleranz durchsetzen könne.
Ein von mir selbst gewähltes „Wahlthema“ für die mündlichen Prüfungen bei Abschluss meines Fernstudiums hieß: „Bertolt Brechts Theaterkunst!“ Frau Dr. W., mit in der Prüfungskommission, hat mir anerkennend zugenickt. Eine „Zwei“ habe ich bekommen!
Das Brechtsche Fünkchen Hoffnung in mir wurde weiter genährt durch unerwartete politische Vorgänge in Moskau, Warschau und Budapest. Wie wir wissen, auf dem XX. Parteitag 1956 hatte Chrustschow in einer Geheimrede „die Folgen des Stalinschen Personenkults“ und des „Dogmatismus“ in der Parteipolitik der KPdSU enthüllt! Diese Nachricht fiel auf mich ein wie eine plötzliche Erhellung, obwohl die SED zunächst zögerlich damit umging und nur in internen Parteiinformationen nähere Ausführungen dazu machte. Schließlich sah sich auch Parteichef Ulbricht genötigt zuzugeben, dass „der ‚Personenkult‘ auch in unserer Partei, besonders in der ideologischen Arbeit, weit verbreitet war“ (2). In der Folge wurden diese Vergehen abschwächend umschrieben und hauptsächlich nur auf die Person Stalins gemünzt, so dass man wissen sollte: „Na ja, so schlimm war’s bei uns nicht!“ Doch wir DDR-Zeitungsleser hatten ja die gloriosen, lautstarken Hymnen über den „größten Genius der Menschheit“ längst nicht vergessen. – Jedenfalls schien mit der Kritik am „Stalinismus“ eine öffentliche Klärung der problematischen SED-Diktatur in der DDR unvermeidbar zu werden. Der Begriff „Tauwetter“, Titel eines stalinkritischen Romans des sowjetischen Schriftstellers Ilja Ehrenburg, ließ mich jetzt auf eine Ausbreitung dieses politischen Tauwetters bis in unsere DDR hoffen.
Nach dem 17. Juni 1953 hatte ich begonnen, bestimmte Zeitungen aufzuheben oder mir wichtig erscheinende Zeitungsartikel zu sammeln. Ich habe jetzt meine Zeitungsmappe 3 aufgeschlagen und könnte nun Berichte über zwei markante Ereignisse aus dem Jahr 1956 vorlesen.
Mit Zitaten könnte ich belegen, wie unsere parteigelenkte Presse jenes Aufbegehren im polnischen Volk vom „Juniaufstand“ 1956 in Posen bis hin zum Polnischen Oktober 1956 kommentiert hat. Auch wie dann mit Genugtuung berichtet wurde, dass die Polnische Vereinigte Arbeiterpartei nach erfolgreichen „Beratungen“ mit Abgesandten der KPdSU die „Schwierigkeiten“ in Volkspolen wieder überwunden hat. Doch gewisse Ergebnisse waren für uns schon bemerkenswert: Wladislaw Gomulka, Altkommunist und nach 1949 mehrere Jahre in Haft, war nun, plötzlich rehabilitiert, zum Ersten Sekretär der PVA gemacht worden, und die Pflicht zur Kollektivwirtschaft wurde aufgehoben; Bauern durften in Polen jetzt wieder privat wirtschaften und leben! Es war also zu erkennen: Trotz – oder mit – sowjetischer Intervention hatte man nachgeben müssen!
Äußerst interessiert und mit Anteilnahme hatten wir dann die Ereignisse in Ungarn verfolgt. Wie es im Herbst 1956 dort zu starken Unruhen gekommen war, die sich im Oktober/November zugespitzt und zu einem Volksaufstand in Budapest geführt hatten, der dann nur durch das militärische Eingreifen der sowjetischen Streitkräfte mit blutiger Gewalt niedergeschlagen werden konnte. – Ich erinnere mich, wie eines Abends, vom westdeutschen Rundfunk übertragen, die letzte eindrucksvolle Rede des ungarischen Ministerpräsidenten Imre Nagy zu hören war. Der Hilferuf eines Kommunisten, der mit dem gemäßigten Flügel der Partei den stalinistischen Kurs überwinden und einen reformierten Sozialismus anstreben wollte. Angesichts des Vordringens sowjetischer Panzerverbände auf Budapest hatte er in seinem letzten verzweifelten Hilferuf die übrige Welt um Unterstützung für das ungarische Volk gebeten. Wir waren tief berührt und wirklich traurig über den tragischen Ausgang dieser hoffnungsvollen sozialistischen Revolution. Natürlich wussten wir damals nichts Genaueres über Hergang und Ausmaß der Kämpfe, auch noch nicht, dass man wenig später Imre Nagy gegriffen, in die Sowjetunion verschleppt und 1958 zum Tode verurteilt hatte.
Aus meinen Zeitungsartikeln konnte ich damals lesen, dass es natürlich „die verbrecherischen, konterrevolutionären Feinde und Putschisten“ waren, die „angestachelt von imperialistischen Agenten und Einflüssen“ die „Ungarische Volksdemokratie beseitigen“ wollten, und dass es der Solidarität der sowjetischen Genossen und Soldaten zu verdanken sei, dass der Sozialismus in Ungarn und damit der Weltfriede gerettet worden sei und so weiter und so weiter.
„Die Revolution entlässt ihre Kinder“
Irgendwann in jener Zeit 1956/57, als ich abends den deutschsprachigen Londoner Rundfunk hörte, gewann ich Zugang zu einer interessanten Serie gesendeter Lesungen aus Wolfgang Leonards Buch „Die Revolution entlässt ihre Kinder“. Ich hatte diese Lesungen von Buchausschnitten mit großem Interesse verfolgt. Wohl ein Jahr danach drückte mir eine befreundete Kollegin ein Exemplar dieses Buches in die Hand. Irgendwer hatte es ihr „aus dem Westen“ mitgebracht! Es war sehr aufschlussreich für mich, was der kommunistische deutsche Emigrant Wolfgang Leonard über seine Erfahrungen mit dem Stalinismus in Moskau und auf der sowjetischen Antifa-Schule zu berichten wusste. Es war das erste Mal, dass ich aus einem authentischen subjektiven Erfahrungsbericht Näheres über interne parteipolitische Vorgänge und stalinistische Machenschaften innerhalb der Sowjetunion erfuhr. Vor allem darüber, wie Stalin mit redlichen Kommunisten und kommunistischen Emigranten umgegangen war. Auch über Strategie und Taktik der „Gruppe Ulbricht“, mit der Wolfgang Leonard als zugehöriges Mitglied Ende des Krieges aus Moskau nach Berlin zurückgekommen war, konnte ich interessante Einzelheiten und Einschätzungen erfahren.
Es ist wohl zu ersehen, wie unsereins mit jedweden aufregenden politischen Ereignissen und Informationen beschäftigt war. Aufmerksam verfolgte ich, was in unserer erstarrten Welt in Gang gekommen und in Bewegung geraten war. Von Mal zu Mal saßen wir im Freundeskreis zusammen, wo wir, aus verschiedenen beruflichen Erfahrungen und Blickwinkeln gesehen, über das Neueste diskutierten. Mit der Zeit kam ein Gefühl von Hoffnung in mir auf, das mich denken ließ: Vielleicht lohnt es sich doch durchzuhalten …
Читать дальше