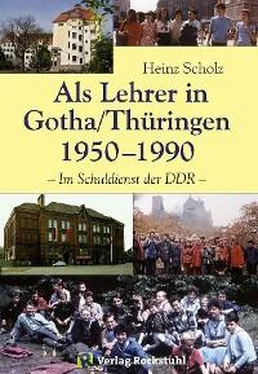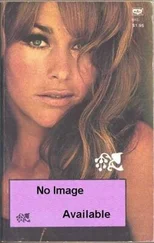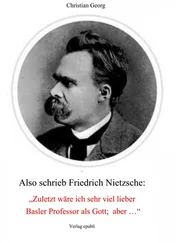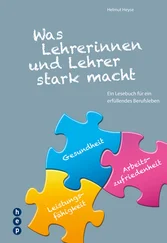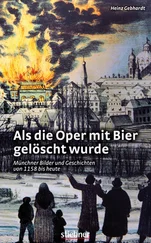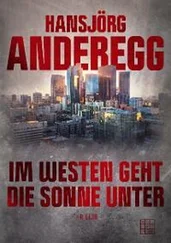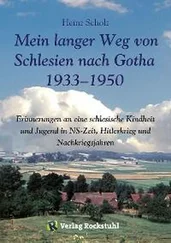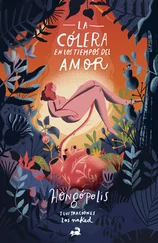Ich muss eine ganze Weile verharrt haben, ohne was zu sagen, tat auch wohl so, als überlegte ich. Da traten noch andere Leute heran, und ich ging zur Seite, froh, Zeit zu gewinnen. Mit bangen Blicken starrte ich nun auf die vor mir liegende Barackenwelt, die sich in meinen Gedanken plötzlich bildhaft verwandelte: Das Bild meines Liegnitzer Arbeitsdienstlagers von 1942 stieg vor mir auf, schon gleich das vom Barackenlager auf dem Truppenübungsplatz Ohrdruf von 1943, und dann blieb ich haften an einem noch schlimmeren Bild: Da sah ich vor mir die schrecklichen Läusebaracken unseres Gefangenenlagers von Stalingrad 1944/45. Es war wie ein Trauma, was mich überfiel, und ich schien wie gelähmt. – Aber das ist doch was anderes hier! – Ja, schon, aber ich kam nicht weg von diesen Bildern. Indem ich sie verdrängen wollte, kam mir Gotha in den Sinn: Ilse mit unserem einjährigen Eckehard zu Hause. Wie soll das alles werden, ich hier in diesem Lager „gefangen“ und allein, sie mit dem Kleinen dort? Das alles und mehr ist mir durch den Kopf gegangen damals, und ich war unfähig, mich zu entschließen und den Schritt zu wagen – hinein ins Lager. – Ich weiß, ich kam mir miserabel vor, als ich unverrichteter Dinge vor dem Schlagbaum umkehrte und mit dem nächsten Zug zurückfuhr zu meinem Freund nach Frankfurt. Der war ärgerlich, konnte mich nicht verstehen. „Da musst du einfach durch, wie viele andere auch!“ und lauter solche Reden. „Überleg’ dir das noch mal gründlich!“ und so fort …
Am nächsten Tag bin ich heimgefahren nach Gotha – mit dem Zug. Schnell, möglichst schnell sollte das gehen. Deshalb hatte ich diesmal mein Fahrrad im Packwagen aufgegeben.
Mein Frau war – über alle beschlossene Pläne hinweg – froh, mich wiederzuhaben. Und ich hielt ziemlich glücklich wieder meinen kleinen Sohn im Arm. Später ist mir bewusst geworden, dass neben meinem Baracken-Trauma und der familiären Ungewissheit mich unbewusst noch ein anderes Bild verunsichert hatte: Die schon erwähnte lateinisierende Akademikerrunde am Nebentisch in jenem rheinischen Restaurant ist mir noch oft in den Sinn gekommen. Dieses Bild ließ mich daran erinnern oder mich in meinem damaligen Zustand glauben machen, dass meine niedere Bildung und Ausbildung für den Westen womöglich nicht ausreichte, dass ich unterliegen könnte drüben: als „Neulehrer“ vor jenen unbehelligten Studienräten nach altem Schrot und Korn.
Es war das erste Mal, dass ich zu mir sagte: Ob du es wahrhaben willst oder nicht, du bist ein Kind dieser DDR. Auch wenn es nicht so recht „deine“ DDR ist! – So ließ ich meinen Plan „abzuhauen“ erst mal fallen. – Jahre später, in schwierigen Situationen oder zugespitzten Fällen, habe ich deswegen mit mir gehadert.
Wieder in Gotha – in der Löfflerschule wie bisher
Die tägliche Arbeit in der Schule, die Familie und natürlich die Partei mit samt dem politischen Getriebe nahmen mich wieder fest in die Zügel. Vor allem mein Fernstudium zwang mich an Schreibtisch und in Bibliotheken. An einem bestimmten Tag in der Woche war ich ausgeplant in der Schule. Meine 26 Unterrichtsstunden waren auf die übrigen fünf Wochentage gelegt, so dass ich den „Studientag“ frei behielt für das individuelle Studium bzw. für die Konsultationen mit unserer Mentorin. In den Sommerferien musste ich an einem dreiwöchigen Seminarkurs in Weimar teilnehmen – mit Vorlesungen, Klausuren, Zwischenprüfungen und 1957 abschließend mit Diplomarbeit und Staatsexamen.
Zu all dem nahmen mich natürlich meine Aufgaben als Klassenlehrer und als stellvertretender Schulleiter voll in Anspruch. Ich kam kaum zur Besinnung, wohl an die 12 – 14 Stunden täglich hatte ich zu arbeiten. Manchmal noch mehr. Für Korrekturen der Schülerarbeiten musste ich meist des Sonntags Zeit finden. Auch die Ferientage zu anderen Jahreszeiten blieben größtenteils aufgespart, um notwendige Studien nachzuholen und um für Schule und Unterricht nach- oder vorzuarbeiten. Es war eine harte Zeit, und unser familiäres Vorhaben, „in den Westen zu gehen“, trat ganz in den Hintergrund.
Zudem richteten die geforderten Studien mein Interesse auch auf literarische Themen und Werke, die mir besonders zusagten und denen ich auch gern tiefer nachgehen wollte. So wurde beispielsweise meine Begegnung mit Werk und Person von Bertolt Brecht für mich ein echtes Bildungserlebnis. Es kam wie eine Offenbarung über mich, weil ich vorher – völlig ohne Kenntnisse – mit Brecht nicht viel anzufangen wusste. – Das erste Mal war ich auf ihn gestoßen, als ich 1951 im Theater in Gotha das Brecht-Stück „Die Mutter“ zu sehen bekam. In der Pause bin ich rausgegangen! Was da stattfand auf der Bühne mit roten Fahnen und Sprechchören, das empfand ich als pure politische Agitation, so wie man sie derzeit auf unseren Straßen und Plätzen bei Aufmärschen und Demonstrationen erlebte. Das war doch kein Theater, wie ich es bislang verstand! 1955, während meines Fernstudiums, als wir nur oberflächlich die deutsche Literatur der zwanziger Jahre behandelten, hatte einer nach Brecht gefragt. Warum dieser so quasi übergangen würde, er wäre doch wichtig? Unsere Mentorin wich aus: Nun ja, der mache zwar sein Theater am Berliner Schiffbauerdamm, aber er sei ein eigenwilliger Mann, und sein „Episches Theater“ habe mit dem modernen „sozialistischen Realismus“ wenig zu tun. Sie messe ihm keine herausragende Bedeutung bei.
Solch einer Wertung misstraute ich. Wenig später, nachdem Brecht 1956 gestorben war und man ihn plötzlich im Übermaß öffentlich zu loben begann, reiste auf einmal, der neuen Linie angepasst, unsere Mentorin Frau Dr. W. als Referentin der „Nationalen Front des demokratischen Deutschland“ in Städten unseres Kreises umher – mit einem Vortrag über den bedeutenden deutschen Dichter Bertolt Brecht! Dieser plötzliche Wandel in der öffentlichen Bewertung Brechts gab mir erneut zu denken und machte mich erst recht neugierig. Dann hörte ich sagen: „Da nun tot, kann er sich nicht mehr wehren!“
Zu dieser Zeit kam mir mehr per Zufall ein Propagandaheftchen vom „Deutschen Friedensrat – Berlin“ (Ag 201/56 DDR – 125) unter die Hände. Und ich muss unbedingt zitieren, was darin Karl Kleinschmidt; Dompfarrer von Schwerin, in einem Nachwort über seinen Freund Bertolt Brecht gesagt hat:
„Bert Brecht war nicht nur seinen politischen Gegnern, er war auch uns, seinen politischen Freunden, unbequem, auf eine andere, viel tiefere Weise als seinen Feinden. Er war uns unbequem auf eine besonders abgefeimte Weise, uns immer wieder nicht nur auf einzelne Mängel, sondern auf den Grundfehler unserer Überzeugungsarbeit hinzuweisen, ….auf den Grundfehler, dass sie Überredungs- und keine Überzeugungsarbeit ist. Das Unbequemste daran ist, dass es sich nicht nur um eine andere Taktik oder Technik handelt, sondern um eine höhere Stufe der Menschlichkeit, um einen Respekt vor dem Andersdenkenden, der es ihm verbot, ihn zu überreden, wenn er ihn nicht zu überzeugen vermochte.“ (6)
Diese in der Öffentlichkeit kaum bemerkte, von mir entdeckte Würdigung Brechts war für mich eine ungeheuer interessante Erklärung, deren Wahrheit ich nun sofort zu prüfen gedachte. Mein Entschluss stand fest: Du musst jetzt Brecht lesen und sein Theater genauer kennen lernen. So besorgte ich mir die „Stücke“, deren ich habhaft werden konnte, und begann – trotz Zeitnot – zu lesen und merkte bald, dass ich mich zugleich mit seiner Theorie vom „Epischen Theater“ beschäftigen müsse. Natürlich wollte ich jetzt unbedingt Brecht-Inszenierungen auf dem Theater sehen. Abgesehen vom Theater Meinigen, wo Fritz Bennewitz (an einem abgeschiedenen Rand der DDR-Kulturszene) schon in den 50er Jahren hatte ungeschoren Brecht-Stücke inszenieren können, gab es erst mit Beginn der 60er Jahre rundum mehr Brecht-Aufführungen. (Ich erinnere mich an die „Dreigroschenoper“ in Weimar, an die „Mutter Courage“ in Erfurt, an den „Kaukasischen Kreidekreis“ …, an „ … Arturo Uri“, an „Das Leben des Galilei“ und an weitere Brecht-Erlebnisse in Weimar, Erfurt und Eisenach und später auch in Berlin am „B.E.“)
Читать дальше