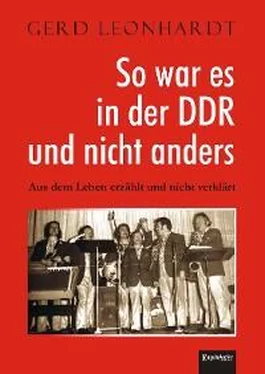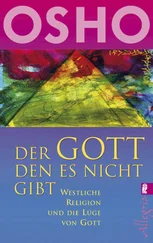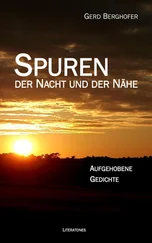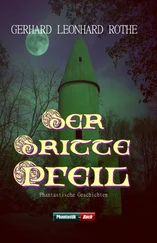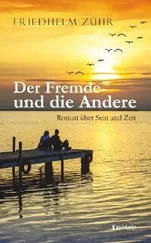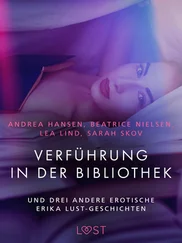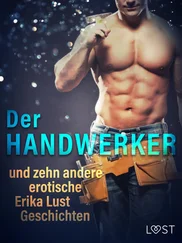Gerd Leonhardt - So war es in der DDR und nicht anders
Здесь есть возможность читать онлайн «Gerd Leonhardt - So war es in der DDR und nicht anders» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:So war es in der DDR und nicht anders
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
So war es in der DDR und nicht anders: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «So war es in der DDR und nicht anders»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
So war es in der DDR und nicht anders — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «So war es in der DDR und nicht anders», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Im Jahr 1969 sang ich am Opernhaus in Karl-Marx-Stadt vor, wurde aber nicht engagiert. Zwar sagte man mir:“Sie haben ausgezeichnet gesungen ...“, doch es ist so „Tradition“, wer nicht direkt von der Schule kommt, fällt erst einmal durch. Ein Jahr später bekam ich meinen Vertrag, und hier gleich als Chorsolist.
Ich hatte Glück, da ein sehr guter erster Tenor an die „Komische Oper“ nach Berlin gehen durfte. So wurde ich, zum Neidwesen verschiedener Kollegen, in allen Inszenierungen an dessen Stelle gesetzt, und diese war meistens ganz vorn.
„Unsere“ Gastarbeiter!?
Im östlichen Teilstaat gab es genügend Arbeit für alle. Die Löhne wurden tief gehalten und demzufolge immer und überall Arbeitskräfte gesucht. Das Dilemma begann etwa im Jahr 1964. Viele neue und große, staatlich bezahlte Wohnungen wurden gebaut. Die meisten zwar in Ostberlin, doch der Rest kam auch nicht schlecht weg. Die meisten Betriebe in und um Chemnitz waren oder wurden wieder aufgebaut. Nur vielen Werken fehlten ausreichend Mitarbeiter. So entschloss sich die nicht gewählte Regierung der DDR, aus den befreundeten Staaten Arbeiter zu rekrutieren. Zuerst wurden Verträge mit Ungarn abgeschlossen, um für eine bestimmte Zeit Bürger dieses Landes bei uns arbeiten zu lassen, da es dort weniger Arbeit gab.
Die ehemalige Gießereifirma „Krautheim“ in Borna bei Karl-Marx-Stadt suchte seit langem viele Mitarbeiter. Hier kamen nun die ersten ungarischen Bürger an, junge Männer im Alter zwischen 20 und 30 Jahren. Kurzerhand baute man für sie, in der Nähe des Betriebes, eine große Baracke für etwa 50 bis 60 Personen, und die Sache schien gelaufen. Weit gefehlt! Allen Ungarn hatten die „Herrschaften“ in Ostberlin ein höheres Gehalt versprochen als den Einheimischen, und dies auch gehalten. Wenige Zeit später gab es Krawall. Durch einen Freund von mir, der dort arbeitete, erfuhr ich alles brühwarm. Es wurde eine Versammlung in der großen Betriebskantine anberaumt. „Die Ungarn kriegen mehr Geld als wir“, so lautete der Protest. Der Vertreter der Gewerkschaft, die letztendlich keine war, erklärte, alle sollten weiter arbeiten und die Sache würde geregelt. Nichts da! Keiner der Arbeiter stand auf. Die Alteingesessenen protestierten: „Das kommt gar nicht in Frage, jetzt wird das geklärt!“ Dann erschien wohl noch die „BPO“, also die Betriebsparteiorganisation der SED oder auch Unterorganisation der Staatssicherheit. Dies führte letztendlich zu der Regelung, dass ein jeder etwas davon haben sollte: Die Ungarn bekamen Arbeit und die Deutschen etwas mehr Geld. Weil die „Gastarbeiter“ aus Ungarn eine Minimiete bezahlen sollten, wurde diese daraufhin noch weiter gekürzt, und somit war der erste Frieden gerettet.
Wohnungen waren knapp, und jeder, der in seinem Betrieb einen AWG-Vertrag abschließen konnte, war froh. Derjenige wusste, in ein paar Jahren konnte er mit der Familie eine staatsfinanzierte Neubauwohnung beziehen. Die AWG, genannt „Arbeiter- und Wohnungsbaugenossenschaft“, war eine staatlich-betriebliche Organisation, in die eigentlich jeder eintreten konnte. Er sollte jedoch verheiratet sein, wenigstens ein Kind haben, in Schicht arbeiten oder auch bei den bewaffneten Organen tätig sein. Hinzu kamen noch viele andere Aspekte die bei einer solchen Vergabe die entscheidende Rolle spielten. Ein Teil wurde auch vom Staat, sprich vom entsprechenden Betrieb, mitfinanziert, und der andere Teil musste bezahlt und mit Eigenleistungen erbracht werden.
Kurze Zeit danach kam der nächste Mitarbeiter-Schub aus Ungarn. Und diesen neuen Arbeitskräften wurde mitten in der Stadt ein komplettes Hochhaus zugesagt. Dieses Haus war gerade erst fertiggestellt worden, und die Bürger von Karl-Marx-Stadt sollten dort einziehen. Viele der Ein-, Drei- und Vierraumwohnungen waren bereits für die Bürger der Stadt eingeplant, und sie hatten jahrelang gewartet. Rigoros wurde ihnen mitgeteilt, es gäbe im Moment noch keine Wohnungen. Wie war das doch mit dem „Staatseigentum“? Wer sind denn nun die Herren in der DDR? Die einfachen Bürger keinesfalls. Dieses Hochhaus wurde daraufhin im Volksmund auch „Paprikaturm“ genannt. Nichts gegen die ungarischen Bürger, sie freuten sich und hatten Arbeit. Die Mädchen aus der Stadt belagerten förmlich den „heißen“ Turm, und wir versuchten mit ihnen auszukommen.
Da es in Borna (bei Karl-Marx-Stadt) nur zwei Gaststätten gab, waren die „Buden“ abends immer voll. Voll waren sie aber auch schon, bevor die Ungarn kamen. Also zeigten sich langsam die ersten Spannungen. Man versuchte zuerst noch im Billardländerwettkampf die dicke Luft zu zerstäuben, doch nachdem die beiden Seiten genügend verloren hatten, kam, was kommen musste: Wir standen uns im Weg. Meine Freunde und ich hielten uns raus aus den „Plänkeleien“. Erst gab es fast jeden Tag abends Keilereien, und später stahlen ein paar Idioten den Ungarn ihre Motorräder, die sie sich hart erarbeitet hatten. Aber es sollte noch anders kommen.
Im Laufe der nächsten Jahre wurden verschiedene Gebiete der DDR, in denen die Industrie vorrangig war, mit „Saisonarbeitern“ förmlich überschwemmt. Nach den Ungarn trafen die Polen in unserer Stadt ein.
Da jeder Arbeit hatte, konnte auch niemand sagen, die würden uns die Arbeit wegnehmen. Nein, ganz im Gegenteil! In der DDR hatte ein jeder laut Gesetz nicht nur das „Recht auf Arbeit, sondern auch die Pflicht zur Arbeit“. Wer länger als eine Woche keiner geregelten Tätigkeit nachging, konnte von der Volkspolizei vorgeführt werden und wegen „Landstreicherei“ – Sie kennen das schon – mit Gefängnis bestraft werden! In diesem Staat existierten keine Arbeitslosen. Wer nicht arbeitete, erhielt auch kein Geld! Es gab keine Sozialhilfe oder ähnliches. Warum auch? Arbeit war mehr als ausreichend vorhanden, und qualifizieren konnte sich jeder. Natürlich blieb den meisten ihr Berufswunsch verwehrt, aber zählt das, wenn man überhaupt erst einmal Arbeit hat?!
Mit den Polen kamen die ersten weiblichen Arbeitskräfte, die auch in der DDR einen Berufsabschluss machen konnten. Die polnischen Arbeiter verstreute man im ganzen Land, von Frankfurt/Oder bis nach Annaberg-Buchholz im Erzgebirge. Im Norden waren viele Frauen von ihnen in der Fleischindustrie beschäftigt, wo man sich im Fernsehen darüber beschwerte, die Deutschen würden zu schnell arbeiten. Im Süden waren sie beim VEB „Kupferring“ im Erzgebirge tätig. Ich habe vereinzelte Polinnen kennengelernt. Darunter fanden sich einige bildhübsche junge Damen. Nur die Zähne – eine sehr traurige Kombination! Des Weiteren kamen nach Karl-Marx-Stadt Menschen aus Bulgarien, Kuba (genannt Kubbis), Vietnam (genannt Fidschis), Mosambikaner (genannt Mosis) und Russen, diese vertreten in der gesamten DDR mit über 750 Stützpunkten! Aber letztere waren nicht zum Arbeiten da, sondern um auf uns aufzupassen und auszubeuten. Es waren ja unsere „Brüder“, und diese werden einem ja vorgesetzt! Freunde kann man sich bekanntlich aussuchen. Viele der „Saisonarbeiter“ konnten ihren ersten ordentlichen Beruf erlernen, den sie dann in ihrer Heimat ausüben konnten. Im Allgemeinen waren sie so zwischen drei bis sieben Jahren da, um anschließend mit anderen Mitbürgern ihres Staates ausgetauscht zu werden. Dies erwies sich für die DDR als große Stütze, zumal ja der Ostteil Deutschlands in Osteuropa das „Aushängeschild“ war und Vorbildcharakter haben sollte. In den Jahren 1969 bis 1970 ging es nach unseren bescheidenen Lebensvorstellungen wohl auch ganz schön vorwärts. Ulbricht musste etwas tun, sprich einkaufen, denn die Genossen hatten sich kurz nach dem Bau der Mauer verpflichtet, in sieben Jahren die Bundesrepublik Deutschland nicht nur einzuholen. Nein, es galt der Spruch: „Überholen ohne einzuholen.“ Ein sinnloser Versuch, die florierende Marktwirtschaft im Westen mit „Rotem Terror“ und Unterdrückung der Bevölkerung gleichzusetzen.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «So war es in der DDR und nicht anders»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «So war es in der DDR und nicht anders» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «So war es in der DDR und nicht anders» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.