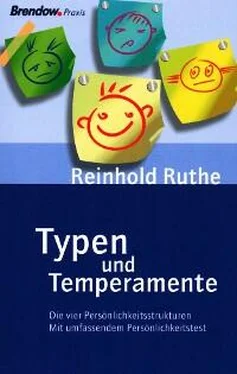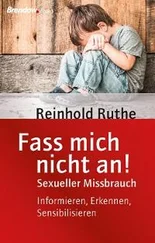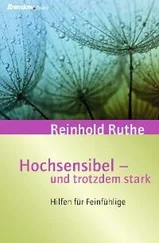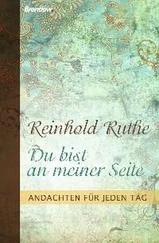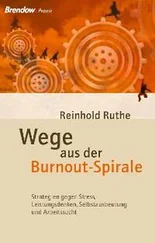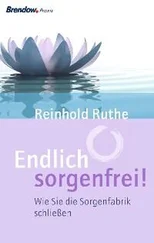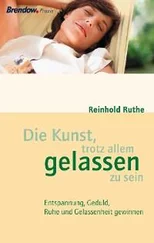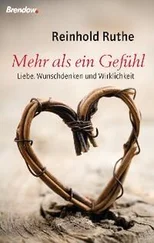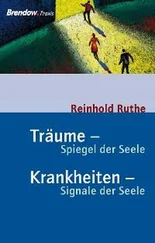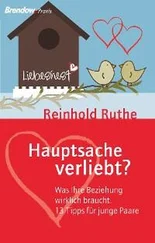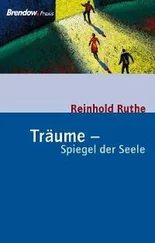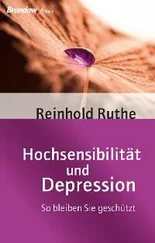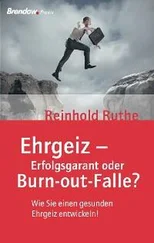mit der er die Menschen wahrnimmt,
mit der er Konflikte und Auseinandersetzungen registriert,
mit der er alle Lebensvorgänge interpretiert.
Ist diese Brille, dieser Deutungsrahmen nicht richtig eingestellt, werden alle Erfahrungen »schief« gedeutet.
So kommen Lebensirrtümer zu Stande,
so entwickeln sich falsche Überzeugungen,
so kommen Fehldeutungen von Beziehungen und Menschen zu Stande,
so entstehen Glaubensfehleinschätzungen,
so werden Fanatiker »gezüchtet«,
so werden Idealisten geboren,
so entwickeln sich Menschenfeinde und Menschenfreunde.
Es handelt sich um Verhaltensmuster, die in den vier Persönlichkeitsstrukturen eine große Rolle spielen.
2.2 Welche Erfahrungen haben wir gemacht?
Drei Verhaltensmuster oder Grundhaltungen haben im menschlichen Leben eine große Bedeutung: Angst, Vertrauen und Hoffnung. Auch unsere Erfahrung wird von diesen drei Faktoren bestimmt. Jeder von uns hat Angst, Vertrauen und Hoffnung erlebt, sie verarbeitet und in sein Lebenskonzept eingebaut. Betrachten wir sie im Einzelnen einmal näher: Angst »hat« man nicht nur, Angst kann auch benutzt werden. Angst ist ein Gefühl, das in Dienst gestellt wird. Ebenso ist es mit Vertrauen und Hoffnung.
Alle drei Muster sind sozusagen Werkzeuge, die von uns zur Lebensbewältigung eingesetzt werden. Diese Werkzeuge können positiv genutzt oder missbraucht werden.
Von der Mutterbrust an lernt ein Säugling, was Angst, Vertrauen, Urvertrauen und Hoffnung beinhalten. Er zieht Schlüsse und geht entsprechend damit um. Jeder Mensch hat mit diesen Grundhaltungen Erfahrungen gemacht. Verdeutlichen wir uns das an Beispielen:
Da ist ein kleines Kind, das gelernt hat, sich mit Angst durchzusetzen. Angst ist ein Mittel, auf das seine Mutter am stärksten reagiert. Die Folge davon ist:
Die Mutter schützt das Kind,
die Mutter entschuldigt das Kind,
die Mutter verteidigt das Kind.
Die Konsequenz für das Kind ist: Jetzt darf es im Schlafzimmer der Eltern schlafen. Es verhindert, dass Vater und Mutter abends ausgehen können. Geschickt versteht es, sich vor bestimmten Aufgaben zu drücken. Unbewusst, nicht boshaft, hat das Kind seine Eltern trainiert: Mit Angst regiere ich meine Familie. Auch im späteren Leben wird dieser Mensch Angst erfolgreich einsetzen.
In der Schule wird Angst in Form von Hilflosigkeit eingesetzt. Die Mutter muss einige Stunden mit dem Kind oder für das Kind Aufgaben lösen. In der Ehe wird Angst in Form von Platzangst eingesetzt. Der Partner darf den anderen nicht allein lassen. Überallhin muss er ihn begleiten. Die Angst erlaubt ihm keine selbstständigen Schritte mehr.
Im Alter kommt oft Verlassenheitsangst vor. Die Angehörigen dürfen nicht verreisen, dürfen sich nicht weit und nicht lange Zeit entfernen.
Vertrauen ist ebenso ein Verhaltensmuster, das im zwischenmenschlichen Umgang verschieden eingesetzt wird. Das eine Kind geht vertrauensvoll auf Menschen zu, es packt zuversichtlich Lebensaufgaben an, es beteiligt sich ohne Angst und voller Vertrauen im Unterricht. Später, als Erwachsener, vertraut es seinen Freunden, seinen Mitmenschen, seinen Mitchristen und lässt sich trotz Enttäuschung nicht beirren. Es heiratet und setzt Kinder in die Welt. Auch im Glauben lässt sich dieser Mensch nicht irre machen, er glaubt an Gottes Güte und Liebe.
Mit der Hoffnung ist es ähnlich. Hoffnung ist ebenfalls ein Verhaltensmuster, das man lernen muss. Hoffnung ist nicht in erster Linie eine Eigenschaft, die angeboren ist.
Hoffnung muss erfahren,
Hoffnung muss gelernt,
Hoffnung muss trainiert werden.
Hoffnung ist in erster Linie eine Haltung, eine Gesinnung und kein Gefühl. Hoffnung ist ein Wagnis, das Menschen im Vertrauen auf Gott riskieren oder sein lassen.
2.3 Lebensentwürfe und private Logik
Mithilfe seiner spezifischen Erfahrungen entwirft also jeder Mensch seine eigene Lebensgeschichte. Die Grundzüge unseres Lebensstils bilden wir schon, bevor wir richtig sprechen können. Wir handeln so, als ob wir wüssten, was wir planen, in Szene setzen und für die Zukunft entwerfen. Wir wissen es in diesem Alter natürlich nicht, aber wir handeln so. Der Lebensstil, die Summe unserer Lebenserfahrungen und Grundüberzeugungen, stellt unsere Strategie dar, zu überleben und in der Welt zurechtzukommen.
Diese Vor-Urteile und Schablonen des Denkens, die jedes Kind sich zugelegt hat, sind wie die Tönung einer Brille, durch die es jetzt und zukünftig alles wahrnimmt. Schon das Baby hat eine Nase dafür, welche Methoden sich bewähren, welche »Tricks« ihm möglich erscheinen und welche Reaktionen sich vorteilhaft einsetzen lassen. Sie sind nicht vererbt, sie sind erfahren.
Wenn wir sieben Jahre alt sind, ist unsere Geschichte zum größten Teil fertig. In der späteren Kindheit schmücken wir sie mit weiteren Einzelheiten aus. Selbstverständlich können wir als Jugendliche noch neue Erfahrungen machen, am Lebensentwurf basteln und dieses und jenes revidieren. Und natürlich können heilsame Begegnungen unser Leben verändern und Bekehrungserlebnisse unser Lebenskonzept erneuern. Aber die ursprünglichen Persönlichkeitsstrukturen schimmern durch alle Ritzen unseres Lebens hindurch.
Der Lebensentwurf des Kindes und des späteren Erwachsenen basiert auf seiner privaten Logik. Die private Logik ist die Selbstschutzfunktion dieses Menschen, die Wirklichkeit so zu sehen und umzugestalten, dass er sie bewältigen kann. (Die Konfliktpsychologie bezeichnet diese Vorgänge als»Derealisation«.) Es handelt sich also um Deutungen, die die Wirklichkeit subjektiv verfärben. Wir können auch von Rationalisierung sprechen, vom Rechtfertigen eines Verhaltens, von innerer Ausrede.
Ein bestimmter Lebensentwurf beinhaltet eine bestimmte Persönlichkeitsstruktur. Das schöpferische Streben des Kindes ist aber weit mehr als eine Reaktion auf die Erwartungen, Befehle und Anordnungen der Erziehungspersonen. Das Kind registriert, deutet und trifft seine Entscheidungen. Ein Lebensentwurf ist eine schöpferisch aktive und antwortende Stellungnahme. So bestimmt das Kind sein Selbstbild, und so entwickelt es sein Selbstwertgefühl. Der Adler-Schüler Rudolf Dreikurs geht davon aus, dass Charakter und Lebensstil identisch sind. Bei ihm heißt es:
»Der Charakter eines Menschen ist nichts anderes als die Manifestation eines bestimmten Planes, den sich das Kind für seine weitere Lebensführung zugelegt hat. Der Lebensplan (Lebensentwurf, Lebensstil) eines Kindes wird sich weder aus einer bestimmten Einzelheit noch aus einmaligen Erlebnissen ergeben, sondern aus seiner Art, Schwierigkeiten zu überwinden, gleichgültig, ob diese nun wirklich vorhanden waren oder nur als solche angenommen wurden.«1
Wir können also aus dem eben Gesagten festhalten, dass die folgenden drei Faktoren die menschliche Persönlichkeit ausmachen:
1. Vererbung:
Größe, Augenfarbe;
bestimmte Krankheiten oder Krankheitsdispositionen;
rassische Merkmale;
Geschlechtsmerkmale.
2. Umwelt:
Erziehung, Familie;
Sozialisation;
Medien, geheime Miterzieher.
3. Schöpferische Aktivität:
Kreativität;
der Mensch macht Erfahrungen und
lernt aus Versuch und Irrtum;
der Mensch zieht Schlüsse und
er trifft Entscheidungen.
Merksatz:
»Es ist nicht wichtig, was der Mensch mit auf die Welt bringt, sondern was er damit anfängt« (R. Dreikurs).
2.4 Sind negative Erfahrungsmuster korrigierbar?
Читать дальше