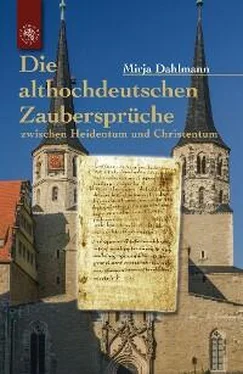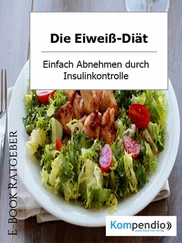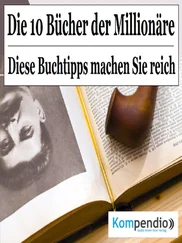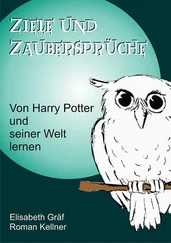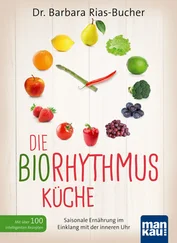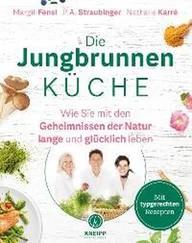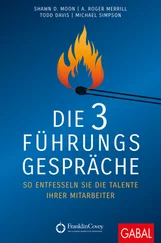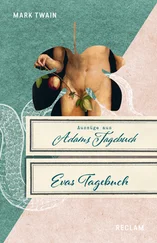3.3.4 Pars pro toto
Monika Schulz zeigt, dass die Vorstellung, dass der ganze Mensch durch einzelne Teile wie Fingernägel oder Haare repräsentiert wird, „für magische Operationen wesentlich und bereits in ältesten Beschwörungen belegt“ 93ist. Bereits in altorientalischen Texten werden „Schuppen, Speichel, Kleidung, Fußwickel, Körperausscheidungen [oder] Besitztum“ 94als Repräsentanten für den ganzen Menschen angesehen. Diese Konzepte beruhen auf der Vorstellung, dass der Zaubernde dazu fähig ist, eine Person „durch entsprechende Einwirkung auf von ihr abgetrennte Teile“ 95zu manipulieren. Durch diese Denkweise ist das Gesetz des pars pro toto auch mit dem Gesetz der Berührung verbunden, denn „things which have once been conjoined must remain ever afterwards.“ 96Nach Frazer ist es „a material medium of some sort which unite[s] distant objects and […] conveys impressions from one to the other.“ 97
Es können aber nicht nur abgetrennte Teile, die durch das Gesetz der Sympathie mit ihrem Besitzer verbunden sind, manipuliert werden, sondern es kann auch ein einzelner Vertreter seiner Art symbolisch für die ganze Gattung stehen. Ein Wurmsegen aus dem CSB , dem Corpus deutscher Segen- und Beschwörungsformeln , zeigt, dass der Tod eines Wurmes auch den Tod aller Würmer, die beseitigt werden sollen, auslöst: „Wan nun der wurm in dem feder kengell stirbt, so stirbt auch der ander.“ 98Der Wurm steht also stellvertretend für die anderen Würmer. Dieser Denkart entsprechen auch die magischen Handlungsanweisungen, die durch das Vergießen von Wasser Regen bewirken sollen. Schulz zitiert hier Cassirer:
[D]er Regen [wird] nicht nur bildlich empfunden, sondern in jedem Wassertropfen als real gegenwärtig empfunden […]. Der Regen als mythische Kraft, der „Dämon“ des Regens ist ganz und ungeteilt in dem ausgegossenen Wasser vorhanden und in ihm der magischen Einwirkung unmittelbar zugänglich. 99
Schulz bezeichnet „das Prinzip des pars pro toto […] als Sonderfall der Kontiguität“, 100da „das Verhältnis von Teilen zu ihrem Ganzen stets auch die Vorstellung eines immerwährenden Kontakts bedingt.“ 101Nach den Denkweisen der Magie bietet dies eine unerschöpfliche Möglichkeit an magischen Handlungen. 102
3.3.5 Animismus und Präanimismus
Weitere Elemente des magischen Denkens sind der Präanimismus 103 und der Animismus 104 . Werden die Objekte von „wirkenden, willenmäßigen doch unpersönlichen Kräften erfüllt“, 105kann man von Präanimismus sprechen. Käser spricht in diesem Zusammenhang noch von dem Begriff des Animatismus . 106 Animatismus oder Präanimismus „[…] ist die Vorstellung, dass Unbelebtes in der Natur als belebt angesehen wird in dem Sinn, dass es eigenen Willen, eigene Emotionen und Denkfähigkeit besitzt, z. B. Vulkane, Unwetter usw.“ 107
Sind diese Kräfte „verpersönlicht als Geister, Dämonen und Seelen, die an Objekte gebunden sind“, 108spricht man von Animismus . Die vergleichende Religionsethnologie und die Religionswissenschaft definiert Animismus als „den Glauben an die Existenz und Wirksamkeit von anthropomorph (menschenähnlich) und theriomorphen (tierähnlich) gedachten geistartigen Wesen (Seelen und Geister).“ 109Auf dem Animismus beruht der Dämonenglaube, der sich in allen Kulturen findet. 110Im magischen Denken werden oft Dämonen als Ursache von Krankheiten gesehen, da sich der in der Heilkunst unkundige Mensch die Ursache seiner Krankheit nicht erklären konnte. Er musste also annehmen, dass die Ursache seiner Erkrankung aus der Außenwelt in ihn eingedrungen sein musste. 111Hampp nennt drei Arten der volksmedizinischen Krankheitserklärungen: „die Erklärung durch Krankheitsdämonen, durch Zauberkraft des Menschen und durch natürliche Ursachen.“ 112Krankheitsdämonen können verschiedene Formen haben. Man kann zwischen Dämonen in Tiergestalt und elbischen Wesen, die in verschieden Gestalten auftreten können, unterscheiden. 113Auch ist es möglich, dass die Krankheit selbst als dämonisches Wesen personifiziert wird. 114Eine weitere Variante des dämonischen Krankheitsverursachers ist der zaubernde Mensch. 115
Der Mensch, der ein animistisches Weltbild hat, erklärt damit nicht nur Krankheitsursachen. Käser erläutert, dass „Animismus Naturwissenschaft“ sei. 116Die Weltsicht des Animismus „hält unter anderem Erklärungen darüber bereit, wie physikalische oder chemische Erscheinungen zustande kommen.“ So erklärt sich ein Stamm aus der südafrikanischen Wüste Kalahari den Himmel, indem er sagt, dass die Sterne „Lagerfeuer von Totenseelen“ seien. 117
Des Weiteren ist Animismus nicht nur Naturwissenschaft, sondern auch Philosophie:
[…] denn er gibt Antwort auf die Frage, wie die Dinge und der Mensch ihrem eigentlichen Wesen nach beschaffen sind, woher sie kommen, wohin sie gehen und wozu sie letztlich bestimmt sind. 118
Im Zusammenhang mit dem Animismus und dem magischen Denken ist es noch wichtig, die Bedeutung einer Kraft, dem Mana , zu erklären.
3.3.6 Mana
Mana ist eine Kraft, mit der „das außerordentlich Wirkungsvolle“ 119bezeichnet wird. Der Begriff Mana wurde nach Erscheinen der Arbeit The Melanesians. Studies of their anthropology and folklore des Missionars R. H. Codrington zur gängigen Bezeichnung. 120 Mana ist der Begriff für das Heilige und Sakrale bei polynesischen Gruppen. Die Namen dieser Kraft variieren bei verschiedenen Völkern. Bei den Griechen kann das Wort hierós „am ehesten […] dem Begriffspaar Mana und Tabu zugeordnet werden.“ 121
Sobald etwas, zum Beispiel ein Ding oder ein Vorgang, Mana besitzt, erlangt es den „Charakter des Heiligen“. 122Dinge ohne Mana , also ohne magischen oder religiösen Zusammenhang, haben hingegen den „Charakter des Profanen.“ 123In Stammeskulturen, aber auch in dörflichen Gemeinschaften gibt es, speziell bei religiösen und magischen Inhalten, besondere Verhaltensweisen und Normen, da „alles Heilige dadurch gekennzeichnet [ist], dass es nicht jedermann und jederzeit zugänglich ist.“ 124 Mana ist ein Begriff, der sprachlich variabel ist. Käser schreibt, dass „es […] adjektivischen oder substantiven Charakter haben [kann], […] ein Wesen, Ding oder Vorgang können mana sein oder Mana besitzen.“ 125Cassirer bezieht sich auf Codrington, wenn er sagt, dass der magische Glaube den Glauben an
eine „übernatürliche Kraft“ [aufweist], die das gesamte Sein und Geschehen durchdringt, die bald in bloßen Dingen, bald in Personen oder Geistern gegenwärtig und wirksam ist, die aber niemals ausschließlich an irgendeinen bestimmten einzelnen Gegenstand oder an ein einzelnes Subjekt als ihren Träger gebunden ist, sondern sich von Ort zu Ort, von Ding zu Ding, von einer Person zur anderen übertragen lässt. 126
Man kann Mana also als „Eigenschaft von Vorgängen, Dingen, Orten, Zeiten und Wesen“ 127bezeichnen, die sich „als unerwartet oder außerordentlich wirkungsvoll erweisen.“ 128Der Begriff Mana ist allerdings nicht nur religiösen Bereichen zuzuordnen, sondern auch in alltäglichen Zusammenhängen zu finden. Je nach Kultur benennt der Begriff auch „Autorität, Status [und] Glück.“ 129
Käser sieht den Begriff Mana als „wertneutral“ 130an. Allerdings gibt es „gutes und böses Mana“. 131Unter gutes Mana kann ein Heilzauber fallen, unter schlechtes Mana ein Schadenszauber. Es kommt darauf an, ob die Auswirkungen als „nützlich oder schädlich erfahren werden.“ 132
Die Vorstellung, dass bestimmte Dinge mit Mana versehen sind, findet sich unter anderen Begrifflichkeiten auch in unserer Kultur. Wenn Käser also schreibt, dass Menschen „vom Mana eines Ortes […] Heilung von Krankheiten und Beschwerden aller Art [erwarten]“ 133und „markante Steine, Felsen, Quellen, Wasserfälle, Flüsse, Berge, Haine [und] Grabstätten“ 134als „Kraftorte“ 135nennt, so erinnert dies stark an die von den Germanen verehrten Heiligtümer. 136Auch im frühen Mittelalter hielten die Menschen an der Verehrung von Orten, wie Seen oder Quellen, fest. 137Bei Zaubersprüchen, bei denen eine Zeitangabe als Ritusanzeige gegeben ist, ist die genaue Zeit wichtig für den Erfolg des Zauberspruchs. Hampp gibt hier „magische Zeiten wie Beerdigung und Mondnacht“ 138an, „in denen die Sympathie wirkt.“ 139
Читать дальше