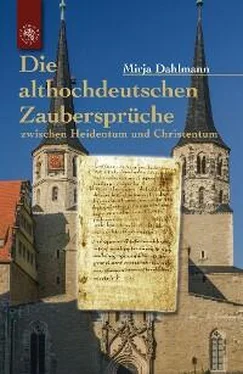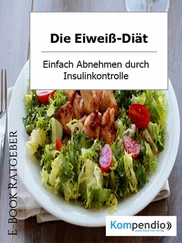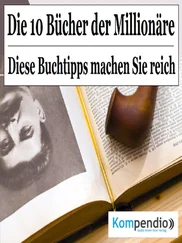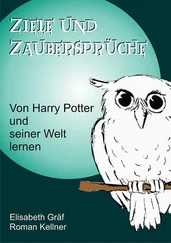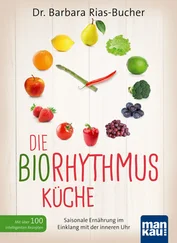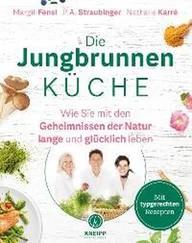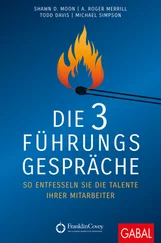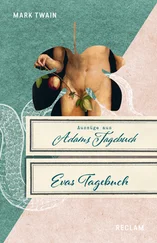Magie ist hier eine „wesentliche kulturelle Funktion“, 47da sie hilft, „Lücken und Unzulänglichkeiten zu überbrücken […], die vom Menschen noch nicht völlig beherrscht werden.“ 48Dies geschieht, indem die Magie dem „primitiven Menschen“ 49Selbstvertrauen einflößt. Er wird mit „einem festen Glauben an seine Erfolgskraft“ 50unterstützt und die Magie befähigt ihn, „seine lebenswichtigen Aufgaben zuversichtlich auszuführen.“ 51
3.2 Die magische und die religiöse Weltsicht
Magischen Handlungen liegt eine bestimmte psychische Disposition zugrunde. Irmgard Hampp nennt den „magischen Glauben“ 52im Gegensatz zum „religiösen Glauben“ 53als Grundvoraussetzung dafür, Magie auszuüben. Im religiösen Glauben unterstellt sich der Mensch der göttlichen Macht und akzeptiert, dass er auf das Schicksal keinen Einfluss hat. Im magischen Glauben will der Mensch Einfluss nehmen, indem er versucht, eine übersinnliche Macht zu zwingen. 54Der Ausdruck des religiösen Glaubens ist, neben anderen Riten, das Gebet. Der magische Glaube drückt sich, neben anderen Formen der Magie, im Zauberspruch aus. 55Hampp bezeichnet die Magie als „Vorstufe der Technik“ 56, da der Zaubernde danach strebt, die „geheimen Mächte“ 57zu kontrollieren und für sich zu nutzen. Magie ist der Versuch „des Menschen, die Welt zu begreifen, sich ihrer zu bemächtigen und sie zu bewältigen.“ 58Nach Irmgard Hampp existieren die religiöse und die magische Weltsicht nicht getrennt voneinander, sondern als „ursprüngliches Neben- und Ineinander.“ 59Beide Glaubensformen weisen Ähnlichkeiten auf:
Beide [Glaubensformen] werden hervorgetrieben aus dem Gefühl der Abhängigkeit vom Numinosen, von übersinnlichen Mächten, und in beiden reagiert der Mensch auf das Abhängigkeitsgefühl mit einer Hinwendung zu diesen Mächten, sei es im Gebet, sei es im Zauberspruch. 60
Da beide Glaubensformen sehr ähnlich sind und religiöse und magische Handlungen ähnliche Formen haben, ist es manchmal schwer, sie exakt voneinander abzugrenzen. Ein gravierender Unterschied zwischen religiösem und magischem Denken ist aber die innere Haltung. Der Zaubernde will etwas (er)zwingen, der Betende bittet darum.
3.3 Die magischen Denkmuster
Es gibt verschiedene magische Gesetze, die alle auf der Lehre von der Sympathie des Alls beruhen.
Der Magier, der diese Prinzipien anwendet, nimmt an, dass „the Laws of Similarity and Contact are of universal application.“ 61Frazer ordnet den reflektierten Gebrauch der Sympathien der „Theoretical Magic“ 62zu, während er vom „primitive magician“ sagt, „he knows magic only on its practical side.“ 63Des Weiteren führt er aus, dass „he never analyses the mental process on which his practice is based […].“ 64
Im Sympathieglauben haben „die magischen Gesetze der Ähnlichkeit ( simila similibus ), des Gegensatzes ( contraria contrariis ) und der Berührung sowie das Gesetz der Stellvertretung ( pars pro toto )“ 65ihren Ursprung. Zuvor hatte schon Frazer in seinem Werk The Golden Bough auf die Prinzipien der sympathischen Magie hingewiesen: „The two principles of Sympathetic Magic are the Law of Similarity and the Law of Contact or Contagion.“ 66
3.3.1 Similia similibus
Monika Schulz teilt die Meinung von Irmgard Hampp, dass „die Kategorie der similitudo […] als zentrales Instrument magischer Manipulation zu begreifen“ 67ist. Denn eine Krankheit, wie zum Beispiel ein Gerstenkorn, kann zwar besprochen, aber nicht „[durch Magie] behandelnd manipuliert werden.“ 68Symbolische Handlungen werden an einem „manipulierbaren Substitut“ 69durchgeführt. Im Falle des Gerstenkorns kann dies eine Erbse oder ein ähnlich aussehender Gegenstand sein. 70Die Ähnlichkeit erschließt sich nicht immer sofort. Der Einsatz des Eisenhutes (der Pflanze) bei Augenleiden lässt nicht sofort einen Zusammenhang erkennen. Es sind die Samen des Eisenhutes, die Ähnlichkeit mit dem menschlichen Auge aufweisen. 71Ein weiteres Beispiel von Ähnlichkeitsmagie nennt Birkhan. Die Mondmagie ist hierfür ein gutes Beispiel, denn „alles, was zunehmen soll, muß bei zunehmenden, was abnehmen soll, bei abnehmenden Mond verrichtet werden.“ 72Er nennt die Mondgläubigkeit der Germanen als Beispiel. Bei der Begegnung Caesars mit dem Suebenführer Ariovist weigern sich die Sueben zunächst, die Schlacht zu schlagen, da die führenden Frauen des Stammes davon abraten, bei abnehmendem Mond zu kämpfen:

[…] ut matres familiae eorum sortibus vaticinationibusque declararent, utrum proelium committi ex usu esset necne; eas ita dicere: non esse fas Germanos superare, si ante novam lunam proelio contendissent. 73
… daß die Familienmütter mit Hilfe von Runen und Weissagungen bestimmten, wann es richtig sei, eine Schlacht zu schlagen und wann nicht. Sie hätten erklärt, die Götter seien gegen den Sieg der Germanen, wenn sie vor dem folgenden Neumond eine Schlacht lieferten. 74
Diese Anweisung beruht auf dem Glauben, dass das Schlachtenglück bei abnehmendem Mond ebenfalls abnehme.
3.3.2 Contraria contrariis
Während das Gesetz der similia similibus besagt, dass „Ähnliches mit Ähnlichem“ bekämpft werden soll, verhält es sich bei contraria contrariis genau umgekehrt. Ein anschauliches Beispiel sind Krankheiten, bei denen hohes Fieber auftritt. Diese werden im Zauberspruch mit Feuer gleichgesetzt und müssen demnach mit Wasser oder Sand gelöscht werden. 75
Gegen den Brandgrind
Man füllt eine Schale mit Wasser und spricht, während
man sie zum Mund führt, um zu trinken:
Ich trink daraus wie ein Reh und Rind
Du sollst wegnehmen diesen Brandgrind.
Brand, fall auf Sand †
Fall in die See †
Und nicht auf Fleisch †
Brand, Brand, ich blase dich;
Heil’ge Jungfrau leite mich. 76
Der Sand, die See und das Blasen auf den Brandgrind soll helfen, diese Krankheit zu heilen.
3.3.3 Gesetz der Berührung
Das „Gesetz der Berührung“ spiegelt sich in der magischen Denkweise wider, die man „kontagiöse Magie“ 77oder auch „Berührungszauber“ 78nennt. Wer einen Berührungszauber anwendet, setzt voraus, „daß eine äußerliche Berührung zu einer inneren Beziehung“ 79führt.
Die Denkweise, dass sich „magische Kräfte […] in den Händen sammeln und durch die Hände übermittelt werden“, 80ist sehr alt. Das Anfassen des Leidenden spielt bei Zaubersprüchen eine große Rolle. 81Manchmal wird der Kontakt durch Berührung auch im Zauberspruch selbst genannt:
Ich greif an die Haut
ich greif an das Fleisch
ich greif an das Bein
ich greif an das Mark und Blut
das ist für alle Schwinden gut. 82
Die „Gebärde des Greifens oder Streichens“ 83wird durch die Erwähnung im Spruch durch die „Kraft des Wortes“ 84, auf die noch eingegangen werden wird, noch verstärkt. 85Auch der Atem 86und der Speichel 87haben heilende Kräfte. Nach Hampp ist „der Glaube an die besondere Kraft der Hand, des Atems und des Speichels uralt und über die ganze Erde verbreitet.“ 88
Auch in der Bibel wird von magischen Heilungen berichtet: Christus heilt einen Taubstummen, indem er seine Ohren mit den Fingern berührt und seine Zunge mit Speichel benetzt. 89Eine zweite Heilung ist die eines Blinden, dem Jesus seinen mit Erde vermengten Speichel auf die Augen aufträgt. 90
Auch bei den Germanen galten Blut und Speichel als „eine Art Seelenträger“ 91und ihre Vermischung schuf „personale Lebens- und Schicksalsgemeinschaft[en].“ 92
Читать дальше