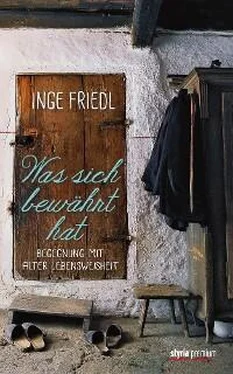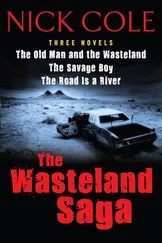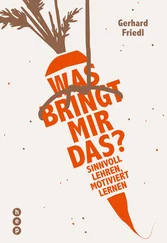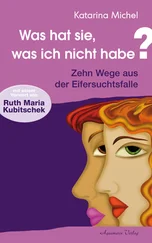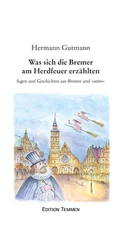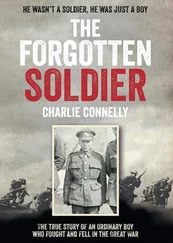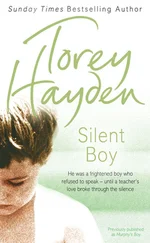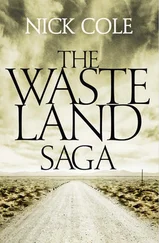Eine Innviertler Bauerntochter erzählte, dass sie in ihrer Jugend über weniger Geld verfügte als eine Magd, die zumindest ein kleines, aber regelmäßiges Einkommen erhielt. Wenn sie hingegen Geld benötigte, musste sie ihre Mutter um ein paar Groschen bitten. Jede Bäuerin hatte einen kleinen Zuverdienst durch den Verkauf von Hühnereiern. Das war übrigens das einzige Bargeld, über das die Bäuerinnen frei verfügen konnten. Die Mutter zweigte vom „Hühnergeld“ ein wenig ab und gab es der Tochter, die damit vielleicht beim Kaufmann ein Stück Stoff oder eine Kleinigkeit am Kirtag kaufte.
Wo wenig Geld vorhanden war, wurde wenig Geld ausgegeben. Ein sparsamer Lebensstil war nicht nur Pflicht, sondern die einzige Möglichkeit, sein Auskommen zu finden. Es ist paradox, dass gerade diese Zeit von meinen Gesprächspartnern als die zufriedenste bezeichnet wird.
Sparsamkeit – nicht zu verwechseln mit Geiz und Knausrigkeit – macht tatsächlich zufrieden. Die US-Psychologin Miriam Tatzel sorgte international für Schlagzeilen, als sie behauptete: „Sparsame Menschen sind sehr glücklich!“ Sie wollte herausfinden, welcher Typ von Konsument am zufriedensten ist. Der Schnäppchenjäger? Der, der sich alles leisten kann? Der Konsumverweigerer? Das Ergebnis war überraschend. Am zufriedensten sind zwei Konsumententypen: Die Sparsamen und die Genießer. Der Genießer gibt sein Geld für Erlebnisse, etwa für Reisen oder für Konzerte aus. Der Sparsame ist nicht einer, der nach Sonderangeboten jagt, sondern jemand, der Nein zu Kaufverlockungen sagen kann und der weiß, wann es genug ist. Eher unzufrieden und nicht sehr glücklich sind hingegen Menschen, die nach Statussymbolen, nach teuren Autos, Villen, Kleidung, Schmuck streben. Diese Menschen haben oft Schulden und sind eher impulsive Käufer.
Dass Geld nicht auf Dauer glücklich macht, merken wir, wenn wir eine Gehaltserhöhung bekommen. Geld spielt durchaus eine große Rolle, wenn wir arm sind. Aber ab einem ausreichenden Einkommen steigt unsere Zufriedenheit nicht weiter an, wenn wir mehr Geld verdienen. Eine Gehaltserhöhung macht nur kurzfristig glücklich, und zwar genau so lange, bis wir uns an den scheinbar besseren und auf jeden Fall teureren Lebensstil gewöhnt haben. Vor nicht allzu langer Zeit waren wir noch zufrieden, wenn wir ein oder zwei Fernsehkanäle in Schwarz-Weiß empfangen konnten. Heute erwarten wir, Dutzende von Sendern empfangen zu können, selbstverständlich farbig und in HD.
DIE QUAL DER WAHL. Die Last, eine Entscheidung angesichts einer unüberschaubaren Auswahl treffen zu müssen, kennt heute wohl jeder. Es beginnt bei der Berufsausbildung. Eine Lehre? Wenn ja, welche? Oder lieber doch eine weiterführende Schule, eine berufsbildende Schule oder gar eine Lehre mit Matura? Alles geht. Soll man danach gleich arbeiten oder lieber eine Hochschule, Universität oder Fachhochschule besuchen? Ein Auslandssemester – ja oder nein? Wehe, man trifft die falsche Entscheidung!
Und erst die Frage nach dem richtigen Lebenspartner. Auch hier scheint alles möglich. Soll man im Bekanntenkreis suchen oder doch lieber im Internet? Und hat man jemanden gefunden – ist er oder sie wirklich der oder die Richtige? Wartet nicht irgendwo da draußen vielleicht noch ein „perfekterer“ Partner?
Eine große Drogeriekette warb mit dem Slogan „Mehr Auswahl als es Wünsche gibt“. Ist es nicht genau das, was sich Konsumenten wünschen? Man stelle sich vor, eine Kundin will ein Parfum kaufen.
Nun hat sie in diesem Geschäft im wahrsten Sinne des Wortes die Qual der Wahl. Sie kann unter vielleicht hundert Düften wählen. Sie will den einen, den für sie richtigen Duft auswählen und riecht einmal an dem einen Flakon, einmal an dem anderen. Sie prüft lange, bringt einige Parfums in die engere Auswahl und entscheidet sich schließlich nach langem Hin und Her für eines. Aber nein, sollte sie nicht doch ein anderes nehmen … Vielleicht ein billigeres, ein teureres, ein blumigeres oder doch lieber eines mit einer Zitrusnote?
Hätte die Kundin nur vier oder fünf Parfums zur Auswahl gehabt, dann wäre sie am Ende mit ihrer Wahl wahrscheinlich zufrieden gewesen. So aber bleibt der Zweifel: Wäre nicht doch ein anderer Duft besser gewesen?
Wir stecken in einem Dilemma: Je mehr Auswahlmöglichkeiten wir haben, desto unzufriedener und unschlüssiger werden wir. Barry Schwartz beschreibt das sehr treffend in seinem Buch „Anleitung zur Unzufriedenheit“: Je mehr Möglichkeiten es gibt, desto mehr Hätte-ich-Dochs lassen sich finden. Und so wird die Zufriedenheit mit der getroffenen Wahl ständig ein bisschen kleiner. Jeder kennt das Phänomen an der Supermarktkassa. Wo auch immer man sich anstellt, die andere Schlange ist die schnellere, und man denkt sich: „Hätte ich doch …!“
Wir können uns vor lauter Möglichkeiten schwer oder gar nicht entscheiden, welchen Weg wir einschlagen sollen. Eine ganze Generation ist unentschlossen und hin- und hergerissen: „Vielleicht ja, vielleicht nein.“ Der Autor des Buches „Generation Maybe“ drückt es so aus: „Ich bin ein Maybe. Ich wäre zwar gern keiner, aber es ist nun mal so. Ich tue mir schwer, Entscheidungen zu treffen. Mich festzulegen. Mich einer Sache intensiv zu widmen. Ich sehe all die Optionen vor mir, die Verlockungen einer ultramodernen Welt, in der alles möglich ist. Egal, was wir wollen, was ich will, es ist meist nur einen Mausklick entfernt.“ So viele Angebote! Und mit jedem Angebot geht die Gefahr einher, sich falsch zu entscheiden und zu scheitern.
DIE GUTE ALTE DORFGREISSLEREI IST EIN GUTES BEISPIEL für Überschaubarkeit. Unendlich viele Wahlmöglichkeiten gab es hier nicht. Wer zum Kaufmann ging, hatte seine Kaufentscheidung schon vorher getroffen, denn erstens hatte man kaum Geld und zweitens gab es dort keine große Auswahl.
Ich traue mich wetten, dass die Kunden der alten Dorfkaufleute zufriedener mit ihren Einkäufen waren als Kunden eines heutigen Supermarktes mit gigantischer Produktauswahl. Dass eine kleinere Auswahl zufriedener macht, lässt sich sogar wissenschaftlich beweisen. In einem Delikatessengeschäft wurden den Kunden zwei Probiertische mit Marmeladen angeboten, einer war mit sechs, der andere mit vierundzwanzig Sorten bestückt. Tatsächlich blieben deutlich mehr Kunden beim Tisch mit der größeren Auswahl stehen. Allerdings konnten sich nur wenige von ihnen zum Kauf entscheiden. Sie grübelten, zweifelten und wirkten verunsichert. Ganz anders dagegen die Kunden, denen die kleine Auswahl vorgesetzt wurde. Sie schienen genau zu wissen, was sie wollen und kauften ein.
Je kleiner die Auswahl, desto sicherer können wir Entscheidungen treffen. Das gilt nicht nur für Marmelade, sondern auch für alle anderen Entscheidungen im Leben. Es muss kein Nachteil sein, nur zwischen wenigen Berufen wählen zu können oder gar einen von den Eltern vorherbestimmten Beruf ausüben zu müssen. Eine Bauerstochter wusste, sie kann entweder als Magd am Hof bleiben, den der Bruder übernimmt, oder einen anderen Bauern heiraten. Der Sohn eines Schmiedes wurde selbst Schmied. Die Tochter eines Gastwirtes übernahm den Betrieb. Diese Menschen wussten schon als Kind, was auf sie zukommt. Die Arbeitswelt der Eltern war ihnen nicht fremd, wie es heute oft der Fall ist. Die allermeisten dieser Menschen waren sehr zufrieden mit dem ihnen zugefallenen Beruf – ausgesucht haben sie ihn ja nicht.
Wir entscheiden heute über Dinge, die früher nicht zur Diskussion standen, etwa ob man Kinder bekommt oder nicht. Das überfordert uns oft und ist anstrengend. Zusätzlich müssen wir noch jeden Tag Tausende kleine Blitzentscheidungen treffen. Welchen Sender stelle ich im Radio ein? Beantworte ich ein E-Mail sofort oder später? Welche der unzähligen Kekssorten kaufe ich?
Früher waren viele Dinge vorhersehbar. Jeder Tag hatte seinen eigenen gleichbleibenden Rhythmus, jede Arbeitswoche endete in der Sonntagsruhe und jedes Jahr hatte seine immer gleichen Ruhezeiten, Festzeiten und Arbeitszeiten. Diese Regelmäßigkeit schuf Sicherheit. Auf Arbeit folgten Ruhephasen, auf den Alltag ein Fest, auf den arbeitsreichen Sommer der Herbst und der ruhige Winter.
Читать дальше