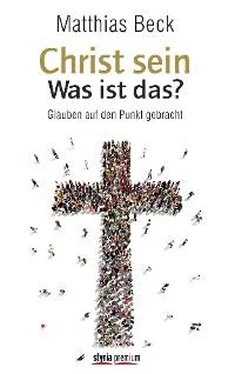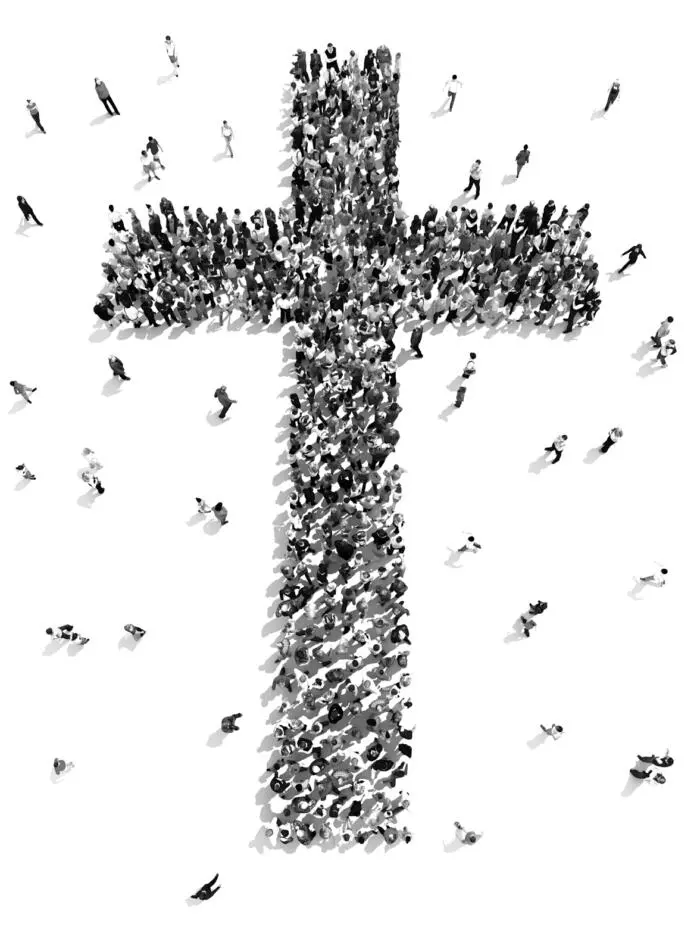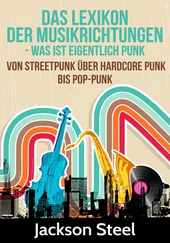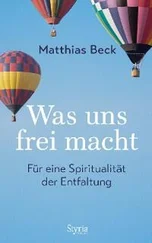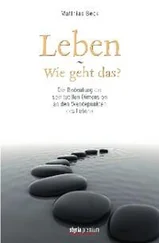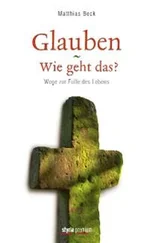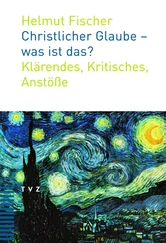Der göttliche Geist schafft die Welt so, dass Ordnung herrscht im gesamten Weltall, in der Natur, im Menschen. Der Mensch kann diese Ordnung schrittweise entziffern lernen. Er findet Naturgesetze und kann mithilfe der Kosmologie, der Naturwissenschaften und vielen anderen Zugängen immer besser verstehen, wie der Kosmos, die Natur, die Lebewesen, die Menschen „funktionieren“. Naturwissenschaftlich gesprochen meint diese Ordnung keine starre Ordnung einer mechanischen Maschine, sondern die dynamische Ordnung des Lebendigen, das auch das Chaos und den Zufall kennt. Es braucht die Ordnung der Planetenbahnen und jene des Organismus, aber auch die Flexibilität des Zufalls. Ohne Ordnung gäbe es keinen Zufall. Wenn alles Zufall wäre, gäbe es den Zufall nicht und die Welt würde kollabieren. Ordnung und Zufall gehören zusammen, sie ermöglichen „Freiheitsgrade“.
Auf der Seite der Theologie geht es um die Reflexion der Selbstoffenbarung des Schöpfergottes, der die Welt – womöglich mit dem Urknall – ins Sein gebracht hat. Es geht um die Beschreibung seines befreienden Handelns und um die Übergabe der Zehn Gebote. Sie sind dazu da, dem Menschen zu helfen, seine erlangte Freiheit nicht wieder zu verlieren. Der Normenkatalog der Zehn Gebote dient der Freiheit. In der Präambel zu den Zehn Geboten heißt es: „Ich bin Jahwe, Dein Gott, der Dich aus Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus“ (Ex 20,2). Schon im Volk Israel wird klar, dass das Volk Gefahr läuft, aus der Freiheit wieder in die alte Knechtschaft und Unfreiheit zurückzufallen. Diese Unfreiheit des Menschen hatte in der Paradiesgeschichte mit der Abwendung des Menschen von Gott begonnen. Vertreibung aus dem Paradies, Brudermord, Gewalt, Sintflut waren die Folgen dieser Abkoppelung. Jetzt wird von Gott her ein neuer Anfang gemacht zur äußeren Befreiung des Volkes. Dieses befreiende Handeln Gottes wird fortgesetzt und vertieft im Neuen Testament mit der inneren Befreiung jedes einzelnen Menschen.
Die Normen der Zehn Gebote dienen der Freiheit, so wie die Tugenden des Aristoteles dem Glück dienten. Beide Zugänge werden im Neuen Testament vertieft: die aristotelischen Tugenden hin zu den christlichen Tugenden von Glaube, Hoffnung und Liebe und die äußere Freiheit hin zur Befreiung des inneren Menschen, der zu sich selbst befreit werden soll. Die Normen des Gesetzes werden zur „Norm“ der Liebe, in der alles zusammengefasst ist.
Im Fortgang des Buches wird nicht einfach erklärt, was die Tugenden von Glaube, Hoffnung und Liebe bedeuten, sondern es werden in einem ersten Schritt die allgemeinen Glaubensinhalte in ihren wesentlichen Punkten dargestellt, um von dort aus zum persönlichen Glaubensvollzug überzugehen. Der inhaltlich bestimmbare und persönlich zu lebende Glauben führt als Hoffnung über den Tod hinaus und offenbart in allem die göttliche und menschliche Liebe. Es geht um die gegenseitige Durchdringung der drei Tugenden.
Zentrale Inhalte
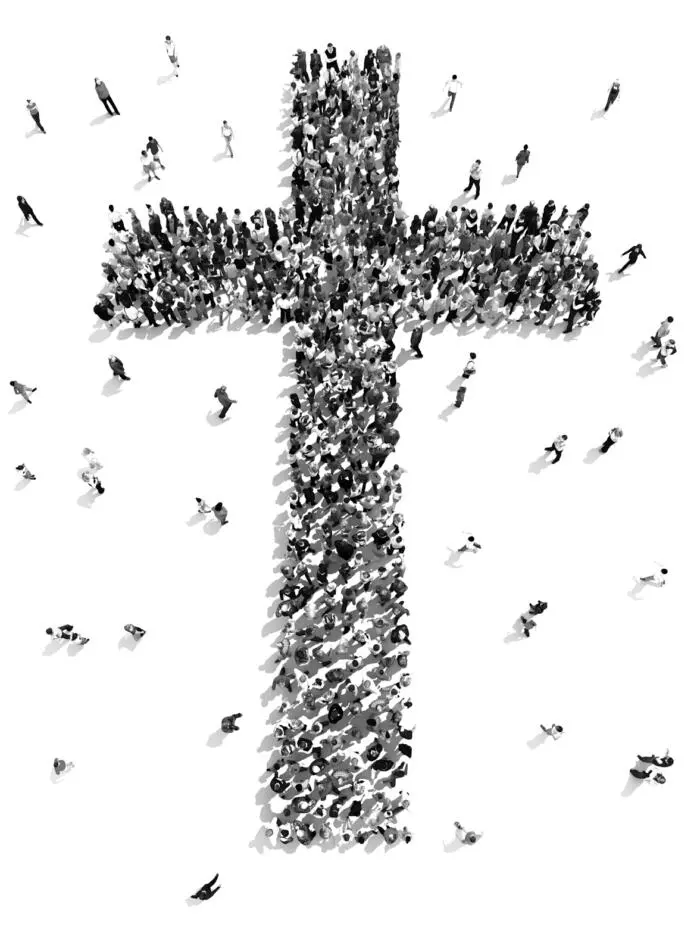
Vom Judentum ausgehend war vom Sprechen und Handeln Jahwes die Rede. Dieses Sprechen und Handeln wird im Hebräischen mit dem Wort dabar bezeichnet. Dabar wird ins Griechische übersetzt mit logos und dann ins Deutsche mit „Wort“. Dabei findet ein mehrfacher Bedeutungswandel statt. Der erste ist jener von dabar, das „Sprechen“ und „Handeln“ bedeutet, hin zu logos, was eher ein abstrakter Begriff ist und auf „Denken“, „Geist“, „Logik“, „Sinn“, „Vernunft“ hinweist. Von dort findet ein zweiter Bedeutungswandel statt zur deutschen Übersetzung „Wort“.
So kommt es zu der eigenartigen Formulierung: „Und das Wort ist Fleisch geworden“ (Joh 1,14). Anders ausgedrückt: Der göttliche Logos wird Mensch, er ist ganz menschlich. Der göttliche Logos kommt dem Menschen ganz nahe, er wird verständlich und „begreifbar“. Man kann ihn be-greifen im Sinne von anfassen. Geistig begreifen kann man ihn nicht immer, aber man kann sich ihm annähern. Zum Aushalten dieser Annäherung und der Nähe Gottes musste der Mensch sich auch weiterentwickeln.
Bei der Übersetzung von dabar mit logos kann der Satz „Im Anfang war der Logos“ (Joh 1,1) so interpretiert werden, dass dieser Logos Gottes nicht nur in Jesus Christus Mensch geworden ist, sondern sich auch in der Natur sowie in jedem Menschen zeigt. In der Natur zeigt er sich in der „Logik“ des Kosmos, der Organismen sowie den Naturgesetzen. Im Menschen zeigt er sich zusätzlich auf andere Weise. Auch hier ist es die Logik des Denkens und die Logik der Physiologie des Organismus, aber auch die Logik des Wortes und der Verantwortung. Hier ist die deutsche Übersetzung mit „Wort“ hilfreich. Das innere göttliche Wort ist in jedem Menschen anwesend. Auf dieses Wort soll der Mensch ant-worten, also gegen-worten. Gott spricht den Menschen von innen her durch den göttlichen Geist sowie das göttliche Wort an und von außen durch das Mensch gewordene Wort Gottes sowie die Ereignisse und Begegnungen. Diesem An-spruch soll der Mensch antworten. Die Übersetzung von dabar mit logos weist auf die geordnete Grundstruktur der Welt hin und jene von logos mit „Wort“ auf die letzte Ver-ant-wortung des Menschen.
Es heißt ausdrücklich „Im Anfang“ und nicht „Am Anfang“. Es geht darum, dass dieser Logos in allem, was ursprünglich aufspringt und ins Sein tritt, gegenwärtig ist. „(…) allem Anfang wohnt ein Zauber inne“,18 heißt es bei Hermann Hesse (1877 – 1962). Bei Hesse geht es um den irdischen Neubeginn in den unterschiedlichen Lebensstufen, diesem „Neubeginnen“ liegt aber als Bedingung der Möglichkeit (Kant) das je neue und ursprüngliche Wirken des Göttlichen zugrunde.
Die Übersetzung von dabar mit logos und der Verweis auf das Anfanghafte in allem weist hin auf eine innerweltliche „Logik“, die sich auch im Wortstamm von Wissenschaften wie Bio-logie, Psycho-logie, Sozio-logie und Theo-logie zeigt. Alle diese Wissenschaften können die Welt nur anfanghaft und bruchstückhaft erfassen. Gemeinsam können sie in komplementären Zugängen mehr begreifen als jede allein. Logos ist aber auch Vernunft, Sinn, Geist und verweist auf den göttlichen Geist im Menschen sowie auf dessen Spiritualität. Die Übersetzung mit „Wort“ weist schließlich hin auf Ver-ant-wortung und Ethik. So ist das Christentum keine irrationale Religion, sondern eine höchst vernünftige, „logische“, spirituelle und ethische. Dabei partizipiert die innerweltliche Logik und Vernunft an der göttlichen, die die menschlichen Dimensionen übersteigt. Durch die Ausrichtung des Menschen auf die göttliche Vernunft wird der Mensch erst in seiner Ganzheit erfasst.
Im Christentum bekommt der Logos Gottes ein Gesicht. Man darf sich ein Bild von ihm machen, allerdings nicht so, als wenn man alles verstünde. Aber Jesus Christus ist das Bild Gottes. Er ist ganz durchsichtig auf Gott hin und sagt: „Wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat“ (Joh 12,45). Er ist ganz transparent auf Gott hin, er ist Gott. Und gerade durch diese innere Ausrichtung und Anbindung ist er ganz Mensch. Er ist ganz menschlich, kommt dem Menschen entgegen und lebt vor, wie das Leben gemeint ist. Der Gott, der dem Volk Israel nur aus der Ferne begegnet ist, tut es jetzt aus der Nähe. Aber auch ihm bleiben als Mensch Fragen: „Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen?“ (Mk 15,34)
2. Die Zwei-Naturen-Lehre Jesu
Das Phänomen, dass das Göttliche ganz menschlich ist, wird ausgesagt in der Lehre von den zwei Naturen Jesu. In ihm sind die „göttliche Natur“ und die „menschliche Natur“ als eine Einheit gegeben. Er ist beides: ganz Gott und ganz Mensch. Er ist eine Einheit in Verschiedenheit. Man darf die beiden Naturen nicht vermischen, aber auch nicht voneinander trennen: Sie liegen unvermischt und ungetrennt vor. Wenn gesagt wird, Jesus Christus war ganz Mensch, dann heißt das, dass er alle Höhen und Tiefen des menschlichen Lebens durchlebt hat. Man könnte auch sagen: Wer wissen will, wie das menschliche Leben geht, soll auf ihn schauen. Er ist ganz Mensch, er ist der Mensch. Und er ist gerade deswegen ganz Mensch, weil er ganz in seinem göttlichen Vater verankert ist. Er ist es so sehr, dass er sagen kann: „Ich und der Vater sind eins“ (Joh 10,30).
Читать дальше